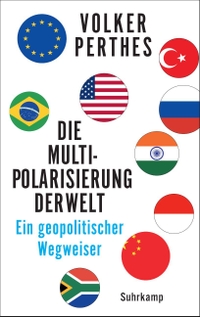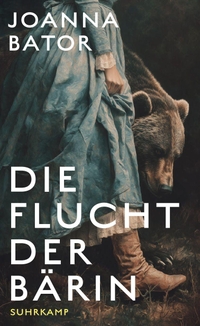Vom Nachttisch geräumt
Unrechtsstaat BRD?
Von Arno Widmann
02.07.2018. Josef Foschepoth untersucht das KPD-Verbot im Kalten Krieg und urteilt: "Verfassungswidrig! Der 1947 in Werl geborene Historiker Josef Foschepoth kam in seiner akademischen Karriere nie über eine außerplanmäßige Professur hinaus. Das hinderte ihn nicht daran, im Rahmen seiner Forschungen zur Rolle der KPD im deutsch-deutschen Systemkonflikt mehrere Millionen bisher geheim gehaltener Akten der Bundesregierung zu entdecken. Seit 2009 werden "die Verschlusssachen systematisch bearbeitet und nach einem festen Zeitplan bis 2024 freigegeben." (Wikipedia) Ein erstes Ergebnis veröffentlichte Foschepoth in seiner Studie "Überwachtes Deutschland. Post- und Telefonüberwachung in der alten Bundesrepublik" (Vandenhoek & Ruprecht). 2013 erläuterte Foschepoth in einem Interview mit der Zeit die gesetzliche Situation in Sachen Abhören so: "Seit der Grundgesetzänderung von 1968 gilt, dass bei einer Überwachung der Betroffene nicht informiert werden muss und der Rechtsweg ausgeschlossen ist. Es gibt also keine Kontrollen. Die Exekutive sagt, sie wisse von nichts oder sie dürfe nichts sagen. Die Gerichte sind ausgeschaltet. Und im Parlament kontrolliert die G-10-Maßnahmen eine vierköpfige Kommission, die auf Informationen der Dienste angewiesen sind, genauso wie das geheim tagende Parlamentarische Kontrollgremium. Überwachungsmaßnahmen der USA und der Alliierten hat die G-10-Kommission immer zugestimmt. Faktisch gibt es im Rechtsstaat Bundesrepublik keine wirksame Kontrolle der geheimen Dienste."
Der 1947 in Werl geborene Historiker Josef Foschepoth kam in seiner akademischen Karriere nie über eine außerplanmäßige Professur hinaus. Das hinderte ihn nicht daran, im Rahmen seiner Forschungen zur Rolle der KPD im deutsch-deutschen Systemkonflikt mehrere Millionen bisher geheim gehaltener Akten der Bundesregierung zu entdecken. Seit 2009 werden "die Verschlusssachen systematisch bearbeitet und nach einem festen Zeitplan bis 2024 freigegeben." (Wikipedia) Ein erstes Ergebnis veröffentlichte Foschepoth in seiner Studie "Überwachtes Deutschland. Post- und Telefonüberwachung in der alten Bundesrepublik" (Vandenhoek & Ruprecht). 2013 erläuterte Foschepoth in einem Interview mit der Zeit die gesetzliche Situation in Sachen Abhören so: "Seit der Grundgesetzänderung von 1968 gilt, dass bei einer Überwachung der Betroffene nicht informiert werden muss und der Rechtsweg ausgeschlossen ist. Es gibt also keine Kontrollen. Die Exekutive sagt, sie wisse von nichts oder sie dürfe nichts sagen. Die Gerichte sind ausgeschaltet. Und im Parlament kontrolliert die G-10-Maßnahmen eine vierköpfige Kommission, die auf Informationen der Dienste angewiesen sind, genauso wie das geheim tagende Parlamentarische Kontrollgremium. Überwachungsmaßnahmen der USA und der Alliierten hat die G-10-Kommission immer zugestimmt. Faktisch gibt es im Rechtsstaat Bundesrepublik keine wirksame Kontrolle der geheimen Dienste."In seinem neuen Buch "Verfassungswidrig! Das KPD-Verbot im Kalten Bürgerkrieg" zeigt Foschepoth, was die von ihm erschlossenen Quellen zum Beispiel zu dieser Frage zur Zusammenarbeit zwischen Verfassungsgericht und Exekutive zu sagen haben. Die Auseinandersetzung um das KPD-Verbot fiel in eine Zeit, da noch darum gestritten wurde, ob das "erstmals geschaffene höchste Gericht ein eigenständiges und unabhängiges 'Verfassungsorgan' ist, wie die Karlsruher Richter meinten, oder ein zwar hohes, ansonsten aber ganz normales Gericht, eingebunden in die Gerichtsbarkeit des jungen Staates, wie die Bundesregierung immer wieder betonte." Es war auch ein Machtkampf. Die Regierung war der Auffassung, die KPD sei verfassungswidrig, und darum habe das Bundesverfassungsgericht auch die Verfassungswidrigkeit der Partei festzustellen, sobald ihm Beweise dafür vorlägen. Die Richter des 1. Senats des Bundesverfassungsgerichts waren dagegen weder von der politischen Zweckmäßigkeit eines Verbots noch von seiner rechtlichen Notwendigkeit überzeugt.
Bis zur letzten Minute versuchte das Verfassungsgericht, die Bundesregierung davon abzubringen, einen Antrag auf Feststellung der Verfassungswidrigkeit zu stellen. Es fehlte an hinlänglichen Beweisen. Am 24. Januar 1952 nahm das Bundesverfassungsgericht die Anträge auf Verbote von KPD und der sich selbst in der Tradition der NSDAP sehenden Sozialistischen Reichspartei an. Am 23. Oktober 1952 wurde die SRP verboten. Die KPD wurde erst am 17. August 1956 verboten. Foschepoth zeigt, wie es dazu kam.
Noch am Abend des 24. Januar 1952 nahm das Bundesverfassungsgericht die "Anregung" von Bundesjustizminister Thomas Dehler (FDP) auf und ließ umgehend die Räumlichkeiten von SRP und KPD nach Beweismaterial durchsuchen. In der Öffentlichkeit - auch gegenüber dem Parlament - wurde getan, als habe es nie eine "Anregung" der Exekutive gegeben, als folge die vielmehr bei der Durchsuchung der Räumlichkeiten einer Anweisung des Bundesverfassungsgerichts.
Der Chef der prozessführenden Stelle der Bundesregierung war Staatssekretär Hans Ritter von Lex (1893-1970). Im März 1933 hatte er mit Adolf Hitler über die Bildung einer Koalitionsregierung aus der Bayerischen Volkspartei und der NSDAP in Bayern verhandelt. Bei diesen Gesprächen wurde ihm das Amt des Innenministers angeboten. Hans Ritter von Lex lehnte letztlich sowohl das Amt als auch die Bildung einer Koalition ab. Bald darauf wurde er in der Justizvollzugsanstalt Stadelheim inhaftiert. Jedoch gelang es ihm, kurze Zeit später freizukommen. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Lex Mitglied der Christlich-Sozialen Union (CSU). Sein Gegenüber war Erwin Stein (1903-1992), Mitglied der CDU, der innerhalb des Bundesverfassungsgerichts für das KPD-Verbot zuständig war. Stein war mit einer Jüdin verheiratet, so dass er 1933 aus dem Staatsdienst austrat und als Rechtsanwalt in Offenbach arbeitete. "Nachdem Hedwig Stein im März 1943 mittels Postkarte die Aufforderung erhalten hatte, sich bei der örtlichen Dienststelle der Gestapo in Offenbach zu melden, plante Erwin Stein die Flucht seiner Frau in die Schweiz. Sie beging am 23. März 1943 Suizid, um sich einer bevorstehenden Deportation in ein Konzentrationslager zu entziehen. Kurze Zeit später wurde Erwin Stein als Panzerschütze in die Wehrmacht eingezogen und geriet kurzzeitig in britische Kriegsgefangenschaft." (Wikipedia)
Die rechtliche Grundlage der Hausdurchsuchungen sollte der §35 des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes sein, das dem Gericht weitgehend freie Hand gab. Auf einer Tagung der verschiedenen involvierten Institutionen wurde erklärt, "wenn der Verfassungsschutz als Vollzugsorgan des Bundesverfassungsgerichts tätig werde, übe er nur 'übertragene Befugnisse' aus, 'landesrechtliche Bedenken würden deswegen nicht entgegenstehen'. Darum könnten bereits von Anfang an Sachverständige des Verfassungsschutzes hinzugezogen werden, aber auch die Polizei könne zunächst alles beschlagnehmen und dann dem Landesamt zur Prüfung übermitteln. Alle Behörden hätten Rechts- und Amtshilfe zu leisten. Foschepoth meint dazu: "Eine bemerkenswerte Auffassung der Herren Verfassungsrichter! Besagt sie doch, dass die geforderte Amtshilfe auch dann zu leisten ist, wenn diese gegen den ausdrücklichen gesetzlichen Auftrag des Verfassungsschutzes verstieß. Obwohl natürlich auch das Bundesverfassungsgericht an Recht und Gesetz gebunden war, glaubten die Richter offensichtlich, sich auch hier auf Grund des §35 BVerfGG über allgemeine gesetzliche Regelungen, insbesondere die Verfassungsschutzgesetze des Bundes und der Länder hinwegsetzen zu können."
Verfassungsschutz und Polizei sollten gemeinsam entscheiden, was konfisziert werden sollte. Dabei durften Verfassungsschützer gerade keine polizeilichen Aufgaben wahrnehmen. Außerdem wären, folgte man den Gesetzen der Bundesrepublik Deutschland, nur Gerichte ermächtigt gewesen, das vorgeblich "staatsfeindliche Material" zu sondieren. Hinzu kam, dass es nicht etwa im Gericht deponiert wurde, sondern im Bundesamt für Verfassungsschutz. Auch das ein eindeutiger Verstoß, so Foschepoth, gegen die Strafprozessordnung.
Das ist nur ein einziges, winziges Beispiel für die fortwährende - freilich immer auch wieder konfliktreiche - Zusammenarbeit zwischen der Exekutive und dem Bundesverfassungsgericht. Rechtsstaatlich ging es nicht zu beim KPD-Verbot.
Josef Foschepoth: Verfassungswidrig! Das KPD-Verbot im Kalten Bürgerkrieg, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2017, 492 Seiten, s/w Abbildungen, 40 Euro
Kommentieren