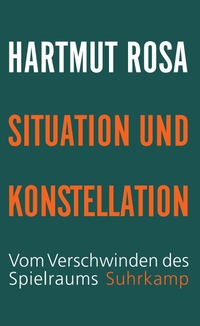Essay
Aussage über das Spiel
Von Franz Josef Czernin
29.01.2008. Warum soll es geradezu eine hinreichende Bedingung für dichterisches Schreiben sein, dass sein Sinn (weitgehend) unkontrollierbar ist, etwas, das den Dichter - fast ohne sein Zutun - am Ende vor vollendete sprachliche Tatsachen stellt? Eine Antwort auf Felix Philipp Ingold. Was zu Poetiken gedacht wird, ist häufig ein Teil von ihnen und auch der Poesie selbst - eben dies eröffnet vielleicht ebenso viele Erkenntnismöglichkeiten, wie es solche verschließt. Über Poetiken und Poesie werturteilen bedeutet zumeist, an einem Spiel teilzunehmen: Eine Aussage über das Spiel ist dann zugleich einer seiner Züge - und noch dazu ein Zug, der die Spielregeln ein wenig verändert: Ja, auch dieses Feld lässt sich kaum beschreiben, ohne es zu verändern.
Daraus abzuleiten, dass es Gedanken zur Poetik oder zur Poesie an Verbindlichkeit oder Objektivität mangelt, wäre dennoch falsch; diese Ableitung beruhte auf einem zu engen Begriff von Objektivität - oder auf einem zu weiten von Subjektivität.
Poetik und Poesie zu kommentieren und kritisch einzuschätzen und zwar in der Annahme, Angemessenes, Verbindliches oder Treffendes sagen zu können, ist also durchaus gerechtfertigt - und es ist manchmal auch notwendig. Und wohl nicht zufällig sind die entsprechenden Praktiken konstitutiv für das Feld Literatur.
*
Felix Philipp Ingolds Beobachtungen und Anmerkungen zur Poetik (mehr hier) sind ebenso offenherzig wie seine Beispiele und Kommentare zur Poesie - was in der von allzu viel Rücksicht geprägten literarischen Welt nicht selbstverständlich ist. Seine detaillierte Kritik an Gedichten und seine beispieluntermauerte Diagnose eines in der Gegenwartslyrik häufigen lyrischen Plaudertons sind so aufschlussreich wie fruchtbar. Allerdings stimme ich keineswegs mit allen seinen negativen Werturteilen überein.
Auch Ingolds Kritik am Niveau poetologischer Äußerungen halte ich in vielen Fällen für berechtigt, seine Zitate und Beispiele unterstützen wenigstens einige seiner negativen Befunde hinreichend.
Nun wirft Ingold jedoch poetologischen Äußerungen von Schriftstellern vor, dass sie in ein metaphorisches Räsonnieren zurückfallen, "das die Poetik tendenziell wieder in Poesie aufgehn lässt und den Erkenntnisgewinn auf einen mehr oder minder erhellenden Aha!-Effekt reduziert." Wenn also die grundlegende Annahme von Ingolds Poetik-Kritik ist, dass metaphorisierende Poetik Erkenntnisverlust impliziert, dann bin ich mit ihr keineswegs einverstanden.
Schließt metaphorisches Reden über Poetik und Poesie Erkenntnis aus? Könnte man nicht - gerade durch die Poesie selbst belehrt - ebensogut gegenteiliger Ansicht sein? Dass die Poesie wenn auch nicht nur metaphorisch, so doch über weite Strecken figürlich redet, ist selbstverständlich und ein Gemeinplatz. Warum sollte eine Poetik, vielleicht weil sie sich ihrem Gegenstand aus guten Gründen anzugleichen sucht, nicht ebenso verfahren? Man lese beispielsweise poetologische Äußerungen von Celan oder Blanchot, von Novalis oder Hölderlin. Überall figürliche und insbesonders auch metaphorische Rede, überall poesie-sympathetisches Analogisieren - wenn auch in ständigem Widerspiel von Begrifflichem und Theoretischem.
Natürlich kann man mit einigem Recht verlangen, dass in Texten mit begrifflich-theoretischem Anspruch Metaphorisches, wenn nicht auszuschließen, so doch nur mit Vorsicht, mit Zurückhaltung und bei klarem Bewusstsein des Unterschieds von wörtlicher und metaphorischer Rede zu gebrauchen sei. Und vielleicht gibt es auch den ein oder anderen poetologischen Text eines Dichters, der sich stark am Maßstab des Begrifflichen und Theoretischen orientiert und deshalb daran zu messen ist. Nur sprechen die von Ingold gewählten Zitate dagegen, dass es sich um Texte dieser Art handelt. Kritik an poetologischen Äußerungen müsste also, glaube ich, anders und vor allem differenzierter, nämlich orientiert an der Schreibweise des einzelnen Texts, erfolgen.
*
Ingold gibt aber in seinem Text auch etwas von seiner eigener Poetik preis:
"Dichterisches Schreiben ist riskantes Schreiben, nicht absehbar in seiner Konsequenz, nie gänzlich kontrollierbar in seiner Eigenbewegung, nicht einzustellen oder auszurichten auf einen gewünschten Ertrag, oft auf keine bestimmte Bedeutung hin zu lesen, eine Schreibbewegung, die auch den Schreibenden selbst in Erstaunen, Verstörung, Enttäuschung versetzen kann. Und dichterisches Schreiben muss sich notwendigerweise in einem gewissen Grad von der Bedeutungsebene der Wörter emanzipieren, um einem Sinn (wozu auch Unsinn, Eigensinn gehören) zum Durchbruch zu verhelfen, der sich immer erst nachträglich entfalten kann, der aber auch, beim Lesen, jedesmal neu entfaltet werden muss."
Figürliches Reden, das Ingold für der Poetologie abträglich hält, ist in diesem Zitat selbst präsent: Steht das Schreiben, das sich emanzipieren muss, nicht figürlich (metonymisch) für den Schreibenden? Kann einem Sinn in des Wortes eigentlicher Bedeutung zum Durchbruch verholfen werden? Ist es wirklich die Schreibbewegung selbst, die einen Schreibenden in Erstaunen, Verstörung, Enttäuschung usw. versetzen kann? Und wie entfaltet sich Sinn? Wie eine Blüte, wie ein zerknülltes Blatt Papier, wie die Wirkung einer Madeleine am Ende?
Seltsamer Selbst-Widerspruch, gewollt oder ungewollt: Ingolds Text zufolge müsste man ihm selbst sein Figürliches vorwerfen. Aber würde man seinem Kommentar so gerecht? Wohl kaum.
*
Wichtiger als jener Selbstwiderspruch ist mir an dieser Passage jedoch etwas Anderes: Warum soll sich, wie Ingold behauptet, der Sinn von Gedichten immer erst nachträglich entfalten? Warum soll es geradezu eine hinreichende Bedingung für dichterisches Schreiben sein, dass sein Sinn (weitgehend) unkontrollierbar ist, etwas, das den Dichter - fast ohne sein Zutun - am Ende vor vollendete sprachliche Tatsachen stellt? Sollte das Verhältnis von durch die Sprache Vorgegebenem und dem, was ein Autor zu sagen oder auszudrücken intendiert, nicht vielmehr als gleichberechtigtes Wechselspiel gefasst werden? Ist für das Hervorbringen von Poesie nicht bezeichnend, dass dem Dichter einerseits eine Vision des zu Dichtenden vorschwebt und dass ihm andererseits die Sprache, dieses allerdings abgründig geheimnisvolle Instrument, etwas zu- und aufträgt? Und wäre ein Ziel der Poesie nicht jenes Utopia, in dem sich beide Momente als die zwei Seiten eines einzigen Gedichts erweisen?
Franz Josef Czernin
Daraus abzuleiten, dass es Gedanken zur Poetik oder zur Poesie an Verbindlichkeit oder Objektivität mangelt, wäre dennoch falsch; diese Ableitung beruhte auf einem zu engen Begriff von Objektivität - oder auf einem zu weiten von Subjektivität.
Poetik und Poesie zu kommentieren und kritisch einzuschätzen und zwar in der Annahme, Angemessenes, Verbindliches oder Treffendes sagen zu können, ist also durchaus gerechtfertigt - und es ist manchmal auch notwendig. Und wohl nicht zufällig sind die entsprechenden Praktiken konstitutiv für das Feld Literatur.
*
Felix Philipp Ingolds Beobachtungen und Anmerkungen zur Poetik (mehr hier) sind ebenso offenherzig wie seine Beispiele und Kommentare zur Poesie - was in der von allzu viel Rücksicht geprägten literarischen Welt nicht selbstverständlich ist. Seine detaillierte Kritik an Gedichten und seine beispieluntermauerte Diagnose eines in der Gegenwartslyrik häufigen lyrischen Plaudertons sind so aufschlussreich wie fruchtbar. Allerdings stimme ich keineswegs mit allen seinen negativen Werturteilen überein.
Auch Ingolds Kritik am Niveau poetologischer Äußerungen halte ich in vielen Fällen für berechtigt, seine Zitate und Beispiele unterstützen wenigstens einige seiner negativen Befunde hinreichend.
Nun wirft Ingold jedoch poetologischen Äußerungen von Schriftstellern vor, dass sie in ein metaphorisches Räsonnieren zurückfallen, "das die Poetik tendenziell wieder in Poesie aufgehn lässt und den Erkenntnisgewinn auf einen mehr oder minder erhellenden Aha!-Effekt reduziert." Wenn also die grundlegende Annahme von Ingolds Poetik-Kritik ist, dass metaphorisierende Poetik Erkenntnisverlust impliziert, dann bin ich mit ihr keineswegs einverstanden.
Schließt metaphorisches Reden über Poetik und Poesie Erkenntnis aus? Könnte man nicht - gerade durch die Poesie selbst belehrt - ebensogut gegenteiliger Ansicht sein? Dass die Poesie wenn auch nicht nur metaphorisch, so doch über weite Strecken figürlich redet, ist selbstverständlich und ein Gemeinplatz. Warum sollte eine Poetik, vielleicht weil sie sich ihrem Gegenstand aus guten Gründen anzugleichen sucht, nicht ebenso verfahren? Man lese beispielsweise poetologische Äußerungen von Celan oder Blanchot, von Novalis oder Hölderlin. Überall figürliche und insbesonders auch metaphorische Rede, überall poesie-sympathetisches Analogisieren - wenn auch in ständigem Widerspiel von Begrifflichem und Theoretischem.
Natürlich kann man mit einigem Recht verlangen, dass in Texten mit begrifflich-theoretischem Anspruch Metaphorisches, wenn nicht auszuschließen, so doch nur mit Vorsicht, mit Zurückhaltung und bei klarem Bewusstsein des Unterschieds von wörtlicher und metaphorischer Rede zu gebrauchen sei. Und vielleicht gibt es auch den ein oder anderen poetologischen Text eines Dichters, der sich stark am Maßstab des Begrifflichen und Theoretischen orientiert und deshalb daran zu messen ist. Nur sprechen die von Ingold gewählten Zitate dagegen, dass es sich um Texte dieser Art handelt. Kritik an poetologischen Äußerungen müsste also, glaube ich, anders und vor allem differenzierter, nämlich orientiert an der Schreibweise des einzelnen Texts, erfolgen.
*
Ingold gibt aber in seinem Text auch etwas von seiner eigener Poetik preis:
"Dichterisches Schreiben ist riskantes Schreiben, nicht absehbar in seiner Konsequenz, nie gänzlich kontrollierbar in seiner Eigenbewegung, nicht einzustellen oder auszurichten auf einen gewünschten Ertrag, oft auf keine bestimmte Bedeutung hin zu lesen, eine Schreibbewegung, die auch den Schreibenden selbst in Erstaunen, Verstörung, Enttäuschung versetzen kann. Und dichterisches Schreiben muss sich notwendigerweise in einem gewissen Grad von der Bedeutungsebene der Wörter emanzipieren, um einem Sinn (wozu auch Unsinn, Eigensinn gehören) zum Durchbruch zu verhelfen, der sich immer erst nachträglich entfalten kann, der aber auch, beim Lesen, jedesmal neu entfaltet werden muss."
Figürliches Reden, das Ingold für der Poetologie abträglich hält, ist in diesem Zitat selbst präsent: Steht das Schreiben, das sich emanzipieren muss, nicht figürlich (metonymisch) für den Schreibenden? Kann einem Sinn in des Wortes eigentlicher Bedeutung zum Durchbruch verholfen werden? Ist es wirklich die Schreibbewegung selbst, die einen Schreibenden in Erstaunen, Verstörung, Enttäuschung usw. versetzen kann? Und wie entfaltet sich Sinn? Wie eine Blüte, wie ein zerknülltes Blatt Papier, wie die Wirkung einer Madeleine am Ende?
Seltsamer Selbst-Widerspruch, gewollt oder ungewollt: Ingolds Text zufolge müsste man ihm selbst sein Figürliches vorwerfen. Aber würde man seinem Kommentar so gerecht? Wohl kaum.
*
Wichtiger als jener Selbstwiderspruch ist mir an dieser Passage jedoch etwas Anderes: Warum soll sich, wie Ingold behauptet, der Sinn von Gedichten immer erst nachträglich entfalten? Warum soll es geradezu eine hinreichende Bedingung für dichterisches Schreiben sein, dass sein Sinn (weitgehend) unkontrollierbar ist, etwas, das den Dichter - fast ohne sein Zutun - am Ende vor vollendete sprachliche Tatsachen stellt? Sollte das Verhältnis von durch die Sprache Vorgegebenem und dem, was ein Autor zu sagen oder auszudrücken intendiert, nicht vielmehr als gleichberechtigtes Wechselspiel gefasst werden? Ist für das Hervorbringen von Poesie nicht bezeichnend, dass dem Dichter einerseits eine Vision des zu Dichtenden vorschwebt und dass ihm andererseits die Sprache, dieses allerdings abgründig geheimnisvolle Instrument, etwas zu- und aufträgt? Und wäre ein Ziel der Poesie nicht jenes Utopia, in dem sich beide Momente als die zwei Seiten eines einzigen Gedichts erweisen?
Franz Josef Czernin
Kommentieren