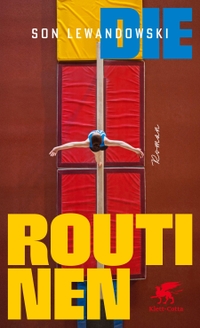Essay
Etwas von dem Unvorstellbaren
Von Daniele Dell'Agli
14.06.2012. Das eine herausragende Werk, das es nach Ansicht der Berichterstatter auf der documenta13 nicht gibt, gibt es doch: Mika Taanilas Videoinstallation über die Arbeiten am Kernkraftwerk Olkiluoto 3 in Finnland. Das also war sie, unsere moderne, elektrifizierte Zivilisation.Es gibt viel Ernstes und noch mehr Kurioses auf der documenta 13 zu sehen, Bizzarres, Exotisches oder auch kunsthistorisch bereits Beglaubigtes, das die verschiedenen Zeiten seiner Entstehung für den Augenblick des Betrachtens simultan schaltet und in dieser einmaligen Konstellation wohl manch neue Erkenntnissynapse sprießen lassen möchte - und es dann nicht tut. Etwa das Arrangement von Morandi-Stilleben mit den Flusssteinen Penones und den baktrischen Specksteinprinzessinnen in der Rotunde des Fridericianum: Man fragt sich allenfalls, warum einer der fünf Morandi durch einen schwülstig barocken Rahmen verhunzt werden musste, man rätselt, welcher der beiden Flusssteine "echt" und welcher von Penone nachgemacht wurde oder wie die Frauenminiaturen (darunter zwei aus Penones Privatsammlung, immerhin eine Verbindung) die Talibanisierung Zentralasiens überlebt haben mögen.
Nun gut. Ein Stockwerk höher kann man sich von den beklemmenden Aquarellen der Charlotte Salomon einen Raum weiter bei der verspielt nihilistischen Heiterkeit eines Fabio Mauri erholen - zwei aus ganz unterschiedlichen Gründen zu Unrecht Vergessene aus jeweils der ersten und der zweiten Phase der heroischen Moderne. In der documenta-Halle wiederum ist man froh, die unzähligen Therapieversuche Gustav Metzgers unter den Sackleinen-Abdeckungen nicht unbedingt lüften zu müssen; man bestaunt die vielseitige Ingenieurskunst Thomas Bayrles, um anschließend von der überladenen Videoinstallation Nalini Malanis (6-Kanal-Schattenspiel mit 5 rückseitig beschrifteten rotierenden Glaszylindern, 4 Scheinwerfern und gefühlten 23 Lautsprechern - "ach ist das verrückt!", jauchzte eine Besucherin im Diskant) in die Flucht geschlagen zu werden. Sorry, aber jede Fernsehreportage über Frauenunterdrückung in Indien leistet mehr für die Sache.
Überhaupt diese gutgemeinten Aufklärungs-Spots meist aus südhemisphärischen Weltgegenden, diese ehrenwerten NGO-Manifeste, die das notorisch schlechte Gewissen kulturbeflissener Eurozentriker aufzufrischen suchen: wenn sie etwas dokumentieren, dann die Tragik "global vernetzter" Experimentierfreude, die, weil sie nichts vergessen, den stetig schwellenden Informationsballast nicht abwerfen kann, kaum mehr als empathiebeschwingte Aha-Effekte provoziert. Noch mehr Tand und Firlefanz gibt es drinnen wie draußen von der mal naturmystisch mal protokosmologisch, auf jeden Fall weiblich grün getünchten Fraktion der Honigpumpen-Energetiker, die allesamt dazu aufrufen, endlich die Grenzen zwischen Kunst und Kitsch, Kunstgewerbe, Funktionskunst und privatsprachlichem Unfug zu verwischen. Wie auch immer: dass man mit politisch korrekter Gesinnung - ob feministischer, ökoethischer oder tiersmondistischer Provenienz - Kreativität besser zensieren als befördern kann, haben wir schon vorher gewusst. Im Zweifel kann man sich - garantiert ideologiefrei - an Korbinian Aigners endlosem Apfelkatalog, einem der geduldigsten Langzeitprojekte individueller Werkgeschichte, satt sehen.
Größeres Interesse können da schon die vielfältigen Ansätze beanspruchen, das scheinbar Phantastische wissenschaftlicher Forschung mit dem scheinbar Wissenschaftlichen künstlerischer Kreativität in Beziehung zu setzen. Dass etwa die fahrlässig unterschätzte Epigenetik durch die Installationen Alexander Tarakhovskys eine anschauliche Plattform erhält, gehört zu den unbestreitbaren Verdiensten dieser documenta. Auf die Frage allerdings, warum die bloße Befriedigung intellektueller Neugier oder die bloße Schärfung von Krisenbewusstsein schon als Kunsterfahrung deklariert werden muss, bleiben sie und der ihr hinterher dackelnde Zeitgeist die Antwort schuldig.
Dass der soziale Kontext der Präsentation darüber entscheidet, was Kunst ist, diese seit Duchamps Pissoir gebetsmühlenartig wiederholte Schutzbehauptung gerissener Geschäftemacher, hat die potentiellen Adressaten von Kunst noch nie überzeugt. Ebenso wenig wie die glaubhafte Beteuerung der Experten, man müsse sich nur lang genug mit einem Schrotthaufen befassen, dann würde das Zeug schon Kunstcharakter annehmen - dafür ist die Lebenszeit derer, die für solche Gutachten nicht bezahlt werden, zu kurz bemessen. Wäre Kunst gar, wie neuerdings wieder gänzlich unkokett behauptet, einfach alles oder könnte alles oder alles sein, dann wäre die Differenz von Kunst und Gesellschaft, von Normalität und Abweichung, von finalisierten Funktionszusammenhängen und zweckfreien Oasen alternativer (obsessiver, monomanischer) Gestaltungsformen vollends einkassiert (und Veranstaltungen wie die documenta überflüssig). Am Ende des "erweiterten Kunstbegriffs" stünde dann die totalitäre Inklusionsutopie einer Welt ohne Außen, eines Selbst ohne Anderes und die verwaisten Transzendenzbedürfnisse wären wieder der autoritären Verwaltung durch Sekten und Konfessionen überlassen. Kunst hingegen, die "etwas anstößt" oder "jemandes Leben verändert" oder wie molekular auch immer den Lauf der Welt irritiert, tut dies nur als die denkbar unwahrscheinliche Ausnahme, deren Emergenz nicht einmal von einer Großausstellung forciert werden kann.
*
Genau solch eine Emergenz nun hält die documenta 13 inmitten ihres durchwachsenen Sammelsuriums wider Erwarten bereit: das eine herausragende Werk, das es angeblich - da waren sich die Berichterstatter im Feuilleton einig - nicht gibt; ein Werk, das in seiner Art so meisterhaft geglückt, so Maßstab setzend für sein Genre ist und mit einer solchen Selbstverständlichkeit diesen Ort und diesen Zeitpunkt seiner Erstveröffentlichung /Uraufführung als den besten möglichen unter Beweis stellt, dass man ohne weiteres sagen kann: allein dieses Werkes wegen lohnt selbst der längste Anfahrtsweg nach Kassel.
Die Rede ist von der großen Videoinstallation des Finnen Mika Taanila im Westpavillon (Untergeschoß) der Orangerie: "Suomen sehköisin kunta - The most electrified town in Finland", 2004-2012. Es handelt sich dabei um eine 3-Kanal-Projektion auf drei Leinwänden nebeneinander, jede im Format 3 x 5 Meter (kleiner Ausschnitt). Parallel gezeigt werden für die Dauer von 15 Minuten unterschiedliche Sequenzen desselben, teils aus digitalem, teils aus analogem (16-mm) Material montierten Films, zum dem die finnische Elektronik-Formation Pan Sonic den Soundtrack lieferte. Gegenstand des Films sind die Arbeiten am Kernkraftwerk Olkiluoto 3 nahe des Städtchens Eurajoki in Südwestfinnland, dessen Inbetriebnahme aus technischen Gründen von 2009 auf 2014 verschoben wurde. Geplant wurde dieses Kernkraftwerk als das leistungsstärkste der Welt und als das erste neue seit Tschernobyl in Finnland (und nicht, wie auf dem Informationsschild und im Begleitbuch behauptet, in ganz Europa: allein die Franzosen haben seitdem 17 neue KKWs gebaut, die Deutschen 4).
Mika Taanila, 1965 geboren, hat sich bereits einen Namen als "experimenteller Dokumentarfilmer" gemacht, was soviel heißen soll, dass er von dokumentarischem Material ausgeht, das er auf eigenwillige Weise bearbeitet und vor allem durch eine raffinierte Bearbeitung des Sounds verfremdet. Seine Faszination gilt vor allem Technikutopien, die er mit einem zwischen Zukunftseuphorie und Melancholie ambivalent changierenden Gestus porträtiert - berühmt wurde sein Film über das "Futuro"-Haus des Architekten Matti Suuronen. Inspiriert fühlt er sich besonders von dem Werk seines Landsmanns Erkki Kurenniemi, Philosoph, Atomphysiker und Pionier der elektronischen Musik, dem auch die documenta eine erste Gesamtschau (ein Stockwerk höher in der Orangerie) widmet. Eine Auswahl seiner Filme ist unter dem Titel Aika & Aine (Time & Matter) auch in Deutschland auf DVD erhältlich.
Schon die gewählte Präsentationsform seines neuen Werks besticht durch ihre genaue Tarierung: mit insgesamt drei Projektionen auf 15 Metern Länge geht sie bis an die äußerste Grenze des Zuschauern Zumutbaren - ohne sie zu überschreiten. Das Triptychon erscheint - von allen sakralen Reminiszenzen befreit - als ideale Versuchsanordnung für das frei assoziative Zusammenspiel nicht dreier unterschiedlicher Filme, sondern, was die Rezeption erheblich erleichtert, verschieden montierter Sequenzen ein- und desselben Films - gewissermaßen einer simultan ablaufenden Parallelmontage. Das geschieht ohne jede Dogmatik oder durchgehendes Muster: mal kommentieren die Seitenflügel das Geschehen im Zentrum, dann verschiebt sich der Fokus auf eine der beiden Seitenprojektionen; dann wieder erscheinen dieselben Sequenzen zeitversetzt wiederholt oder es gibt drei gleichberechtigte Varianten derselben Abläufe aus verschiedenen Perspektiven.
Manchmal schieben sich Bildteile ineinander oder es kontrastiert die horizontale Kamerabewegung rechts mit einer Vertikalfahrt (Aufzug) in der Mitte; die abweisende Pracht der weiten Landschaft hier mit der banalen Enge des Stadtlebens dort, und so weiter, wobei allein die Kombination von digitalem - kalt, transparenten - und analogem Bildmaterial - leicht unscharf, immersionsfreundlich (und die Konterkarierung dieser Werte durch Zeitraffer und Panoramaaufnahmen) eine Abhandlung für sich wert wäre. Der Wechsel der Schauplätze und ihrer Akteure neben- und ineinander erfolgt mit großer Bedachtsamkeit, nie auf billige Kontrasteffekte aus, die freie, nirgends didaktisch sich aufdrängende Assoziation der Bildspuren sorgt zusammen mit der souveränen Ökonomie der Mittel für eine in dieser Kunstform und bei der tendenziell überfordernden Präsentation atypische Nachvollziehbarkeit.
Dazu tragen auch maßgeblich Soundtrack und Soundgestaltung bei, deren einzige Tonspur gleichsam monophon die visuelle Polyphonie synchronisiert und die Wahrnehmung eines über alle Projektionsflächen fließenden Kontinuums verstärken. Die elektronischen (analog generierten, deshalb trotz metallischer Härte organisch anmutenden) Klänge der Kultgruppe Pan Sonic - ihre bislang konzentrierteste Arbeit - begleiten bohrend, schraubend, klopfend, ganz tief im Subwoofer atmend oder auch elegisch distanzierend - das simultane Geschehen und infizieren es mit einer kontrapunktischen, fatalistischen Gelassenheit selbst dort, wo sie das unheimliche Weltraumrauschen düsterer Science-Fiction-Filme evozieren. Spätestens dann ahnen wir: auf diesem Planeten sind wir die Aliens.
Die ambitionierte Soundgestaltung, zu der auch die verfremdeten Arbeitsgeräusche in und um das KKW gehören, die wie in unendliche Ferne oder Vergangenheit gerückt ertönen, hat einen (gewollten?) Effekt, den man zwar aus essayistischen oder experimentellen Filmen kennt, dessen psychische Dynamik aber einem noch nie so unmittelbar greifbar wurde: Es gelingt ihr, die Aufmerksamkeit des Publikums parasympathisch zu tunen, wodurch die auditiven Impulse das visuelle System daran hindern, das Gesehene sogleich zu identifizieren und als immer schon Gewusstes (dies sind Brennstäbe, das ein Reaktor und so weiter) abzuhaken. Diese akustische Suspension des visuellen Identifikationszwangs öffnet einen Resonanzraum kindlicher Unvoreingenommenheit für die faszinierend-verstörende Erfahrung dessen, worum es diesem Film geht: das Menschenferne - der Technik, der Natur und nicht zuletzt der bewusstseinsfernen Natur im wahrnehmenden Subjekt, das sich dem mimetischen Sog überlässt.
Ästhetisch gesprochen: hier versucht eine Kunst auf der Höhe ihrer technischen Möglichkeiten etwas von dem Unvorstellbaren zu vergegenwärtigen, das laut Günther Anders wie ein nihilistischer Schatten moderne Wissenschaft und Technologie begleitet. Als "prometheisches Gefälle" bezeichnete er schon vor mehr als einem halben Jahrhundert mit Blick auf die Atomkraft das anthropologische Verhängnis, dass der Mensch nicht mehr in der Lage ist, sich das vorzustellen, was er herstellt und schon gar nicht, welche Folgen oder Wirkungen sein Tun hat. Insofern Taanila eine Darstellungsform für dieses Un-Geheure, Un-Heimliche des Menschengemachten findet, das unser Auffassungsvermögen transzendiert, schlägt er ein neues Kapitel in der Ästhetik des Erhabenen auf. Diese hatte immer schon das Menschenferne im Blick - als Gleichgültigkeit von Naturschauspielen und als sichere Distanz des Betrachters, der das Schauspiel der Überwältigung genießt.
Mit dem Schauer vor dem Menschenfernen bringt uns Taanila diesem Paradoxon unserer Zivilisation näher, dass wir großtechnologisch die Ausgeliefertheit des vormodernen Menschen an die Naturgewalten wiederhergestellt und somit den anthropologischen Sinn des Fortschrittsprozesses zunichte gemacht haben. Er zeigt die Verlorenheit der Menschen - der gläubigen Techniker, der perplexen Bauer, selbst der ignoranten Städter - angesichts des selbstgeschaffenen Molochs. Auf der anderen Seite verbirgt er nicht seine Faszination für die hermetische Schönheit der technoiden Kunstwelt. Unvergesslich etwa die an Kranseilen orangerot vor blassblauem Himmel schwebenden Zementmischmaschinen. In solchen Momenten begreift man, was Kunst heute sein kann: die präzise Artikulation einer synergetischen Sensibilität, die um die Affinität der angeschlossenen Apparatur (des Equipment) zu ihrem Gegenstand (in diesem Fall der Nukleartechnologie) weiß - eine konzisere Meditation über Heideggers "Gestell" ist nicht denkbar.
Taanilas Arbeit leistet die von der documenta-Leitung programmatisch verkündete (posthumanistische, anthropofugale) Dezentrierung des herrschenden Menschenbildes - seines zumindest in den Machteliten ungebrochenen Selbstverständnisses als Macher, Verfüger und Entscheider über die Geschicke des Planeten - unmerklich, unprätentiös: ohne Behauptung oder Belehrung, ohne Fingerzeig, Forderung oder Anklage. Er zeigt sie einfach, im wortlosen, kommentarlosen, rhythmischen Miteinander, Nebeneinander, Ineinander der Bildsequenzen. Die Intensität seiner Einblicke in die Abgründe unseres ambivalenten Naturverhältnisses lässt sich allenfalls mit Werner Herzogs "Lektionen in Finsternis" - sein waghalsiger Flug durch die brennenden Ölfeder Iraks (1992) - oder mit Peter Mettlers "Petropolis" (2009), der (teilweise auch mit Luftaufnahmen) die gigantische Landschaftszerstörung bei der Förderung von Ölsand im kanadischen Saskatchewan festgehalten hat.
Mika Taanila geht aber einen Schritt weiter, nicht nur durch die dreigeteilte Projektion und die coenästhetische Soundgestaltung, sondern in dem Verzicht auf alle apokalyptische Aufgeregtheit oder der Beschwörung von Katastrophenszenarien: der Film fängt beim gewöhnlichen Endverbraucher elektrischer Energie an - und hört auch bei diesem auf. Doch trotz seiner kurzen Dauer wirkt er durch seine Dichte fast schon monumental, in gewisser Weise erschöpfend, und trotz seines phänomenologisch konstatierenden Gestus entlässt er den Zuschauer in der Stimmung, einen Nachruf erlebt zu haben: das also war sie, unsere moderne, elektrifizierte Zivilisation. Nur in wenigen Einstellungen - keineswegs den letzten - verrät sich der Melancholiker Taanila, wenn er seine Visionen dem Windesrauschen, der Musik der Vergänglichkeit par excellence, anvertraut oder den verregneten Schwarzweißschnipseln ruinierten Zelluloidmaterials...
Daniele Dell'Agli
Nun gut. Ein Stockwerk höher kann man sich von den beklemmenden Aquarellen der Charlotte Salomon einen Raum weiter bei der verspielt nihilistischen Heiterkeit eines Fabio Mauri erholen - zwei aus ganz unterschiedlichen Gründen zu Unrecht Vergessene aus jeweils der ersten und der zweiten Phase der heroischen Moderne. In der documenta-Halle wiederum ist man froh, die unzähligen Therapieversuche Gustav Metzgers unter den Sackleinen-Abdeckungen nicht unbedingt lüften zu müssen; man bestaunt die vielseitige Ingenieurskunst Thomas Bayrles, um anschließend von der überladenen Videoinstallation Nalini Malanis (6-Kanal-Schattenspiel mit 5 rückseitig beschrifteten rotierenden Glaszylindern, 4 Scheinwerfern und gefühlten 23 Lautsprechern - "ach ist das verrückt!", jauchzte eine Besucherin im Diskant) in die Flucht geschlagen zu werden. Sorry, aber jede Fernsehreportage über Frauenunterdrückung in Indien leistet mehr für die Sache.
Überhaupt diese gutgemeinten Aufklärungs-Spots meist aus südhemisphärischen Weltgegenden, diese ehrenwerten NGO-Manifeste, die das notorisch schlechte Gewissen kulturbeflissener Eurozentriker aufzufrischen suchen: wenn sie etwas dokumentieren, dann die Tragik "global vernetzter" Experimentierfreude, die, weil sie nichts vergessen, den stetig schwellenden Informationsballast nicht abwerfen kann, kaum mehr als empathiebeschwingte Aha-Effekte provoziert. Noch mehr Tand und Firlefanz gibt es drinnen wie draußen von der mal naturmystisch mal protokosmologisch, auf jeden Fall weiblich grün getünchten Fraktion der Honigpumpen-Energetiker, die allesamt dazu aufrufen, endlich die Grenzen zwischen Kunst und Kitsch, Kunstgewerbe, Funktionskunst und privatsprachlichem Unfug zu verwischen. Wie auch immer: dass man mit politisch korrekter Gesinnung - ob feministischer, ökoethischer oder tiersmondistischer Provenienz - Kreativität besser zensieren als befördern kann, haben wir schon vorher gewusst. Im Zweifel kann man sich - garantiert ideologiefrei - an Korbinian Aigners endlosem Apfelkatalog, einem der geduldigsten Langzeitprojekte individueller Werkgeschichte, satt sehen.
Größeres Interesse können da schon die vielfältigen Ansätze beanspruchen, das scheinbar Phantastische wissenschaftlicher Forschung mit dem scheinbar Wissenschaftlichen künstlerischer Kreativität in Beziehung zu setzen. Dass etwa die fahrlässig unterschätzte Epigenetik durch die Installationen Alexander Tarakhovskys eine anschauliche Plattform erhält, gehört zu den unbestreitbaren Verdiensten dieser documenta. Auf die Frage allerdings, warum die bloße Befriedigung intellektueller Neugier oder die bloße Schärfung von Krisenbewusstsein schon als Kunsterfahrung deklariert werden muss, bleiben sie und der ihr hinterher dackelnde Zeitgeist die Antwort schuldig.
Dass der soziale Kontext der Präsentation darüber entscheidet, was Kunst ist, diese seit Duchamps Pissoir gebetsmühlenartig wiederholte Schutzbehauptung gerissener Geschäftemacher, hat die potentiellen Adressaten von Kunst noch nie überzeugt. Ebenso wenig wie die glaubhafte Beteuerung der Experten, man müsse sich nur lang genug mit einem Schrotthaufen befassen, dann würde das Zeug schon Kunstcharakter annehmen - dafür ist die Lebenszeit derer, die für solche Gutachten nicht bezahlt werden, zu kurz bemessen. Wäre Kunst gar, wie neuerdings wieder gänzlich unkokett behauptet, einfach alles oder könnte alles oder alles sein, dann wäre die Differenz von Kunst und Gesellschaft, von Normalität und Abweichung, von finalisierten Funktionszusammenhängen und zweckfreien Oasen alternativer (obsessiver, monomanischer) Gestaltungsformen vollends einkassiert (und Veranstaltungen wie die documenta überflüssig). Am Ende des "erweiterten Kunstbegriffs" stünde dann die totalitäre Inklusionsutopie einer Welt ohne Außen, eines Selbst ohne Anderes und die verwaisten Transzendenzbedürfnisse wären wieder der autoritären Verwaltung durch Sekten und Konfessionen überlassen. Kunst hingegen, die "etwas anstößt" oder "jemandes Leben verändert" oder wie molekular auch immer den Lauf der Welt irritiert, tut dies nur als die denkbar unwahrscheinliche Ausnahme, deren Emergenz nicht einmal von einer Großausstellung forciert werden kann.
*
Genau solch eine Emergenz nun hält die documenta 13 inmitten ihres durchwachsenen Sammelsuriums wider Erwarten bereit: das eine herausragende Werk, das es angeblich - da waren sich die Berichterstatter im Feuilleton einig - nicht gibt; ein Werk, das in seiner Art so meisterhaft geglückt, so Maßstab setzend für sein Genre ist und mit einer solchen Selbstverständlichkeit diesen Ort und diesen Zeitpunkt seiner Erstveröffentlichung /Uraufführung als den besten möglichen unter Beweis stellt, dass man ohne weiteres sagen kann: allein dieses Werkes wegen lohnt selbst der längste Anfahrtsweg nach Kassel.
Die Rede ist von der großen Videoinstallation des Finnen Mika Taanila im Westpavillon (Untergeschoß) der Orangerie: "Suomen sehköisin kunta - The most electrified town in Finland", 2004-2012. Es handelt sich dabei um eine 3-Kanal-Projektion auf drei Leinwänden nebeneinander, jede im Format 3 x 5 Meter (kleiner Ausschnitt). Parallel gezeigt werden für die Dauer von 15 Minuten unterschiedliche Sequenzen desselben, teils aus digitalem, teils aus analogem (16-mm) Material montierten Films, zum dem die finnische Elektronik-Formation Pan Sonic den Soundtrack lieferte. Gegenstand des Films sind die Arbeiten am Kernkraftwerk Olkiluoto 3 nahe des Städtchens Eurajoki in Südwestfinnland, dessen Inbetriebnahme aus technischen Gründen von 2009 auf 2014 verschoben wurde. Geplant wurde dieses Kernkraftwerk als das leistungsstärkste der Welt und als das erste neue seit Tschernobyl in Finnland (und nicht, wie auf dem Informationsschild und im Begleitbuch behauptet, in ganz Europa: allein die Franzosen haben seitdem 17 neue KKWs gebaut, die Deutschen 4).
Mika Taanila, 1965 geboren, hat sich bereits einen Namen als "experimenteller Dokumentarfilmer" gemacht, was soviel heißen soll, dass er von dokumentarischem Material ausgeht, das er auf eigenwillige Weise bearbeitet und vor allem durch eine raffinierte Bearbeitung des Sounds verfremdet. Seine Faszination gilt vor allem Technikutopien, die er mit einem zwischen Zukunftseuphorie und Melancholie ambivalent changierenden Gestus porträtiert - berühmt wurde sein Film über das "Futuro"-Haus des Architekten Matti Suuronen. Inspiriert fühlt er sich besonders von dem Werk seines Landsmanns Erkki Kurenniemi, Philosoph, Atomphysiker und Pionier der elektronischen Musik, dem auch die documenta eine erste Gesamtschau (ein Stockwerk höher in der Orangerie) widmet. Eine Auswahl seiner Filme ist unter dem Titel Aika & Aine (Time & Matter) auch in Deutschland auf DVD erhältlich.
Schon die gewählte Präsentationsform seines neuen Werks besticht durch ihre genaue Tarierung: mit insgesamt drei Projektionen auf 15 Metern Länge geht sie bis an die äußerste Grenze des Zuschauern Zumutbaren - ohne sie zu überschreiten. Das Triptychon erscheint - von allen sakralen Reminiszenzen befreit - als ideale Versuchsanordnung für das frei assoziative Zusammenspiel nicht dreier unterschiedlicher Filme, sondern, was die Rezeption erheblich erleichtert, verschieden montierter Sequenzen ein- und desselben Films - gewissermaßen einer simultan ablaufenden Parallelmontage. Das geschieht ohne jede Dogmatik oder durchgehendes Muster: mal kommentieren die Seitenflügel das Geschehen im Zentrum, dann verschiebt sich der Fokus auf eine der beiden Seitenprojektionen; dann wieder erscheinen dieselben Sequenzen zeitversetzt wiederholt oder es gibt drei gleichberechtigte Varianten derselben Abläufe aus verschiedenen Perspektiven.
Manchmal schieben sich Bildteile ineinander oder es kontrastiert die horizontale Kamerabewegung rechts mit einer Vertikalfahrt (Aufzug) in der Mitte; die abweisende Pracht der weiten Landschaft hier mit der banalen Enge des Stadtlebens dort, und so weiter, wobei allein die Kombination von digitalem - kalt, transparenten - und analogem Bildmaterial - leicht unscharf, immersionsfreundlich (und die Konterkarierung dieser Werte durch Zeitraffer und Panoramaaufnahmen) eine Abhandlung für sich wert wäre. Der Wechsel der Schauplätze und ihrer Akteure neben- und ineinander erfolgt mit großer Bedachtsamkeit, nie auf billige Kontrasteffekte aus, die freie, nirgends didaktisch sich aufdrängende Assoziation der Bildspuren sorgt zusammen mit der souveränen Ökonomie der Mittel für eine in dieser Kunstform und bei der tendenziell überfordernden Präsentation atypische Nachvollziehbarkeit.
Dazu tragen auch maßgeblich Soundtrack und Soundgestaltung bei, deren einzige Tonspur gleichsam monophon die visuelle Polyphonie synchronisiert und die Wahrnehmung eines über alle Projektionsflächen fließenden Kontinuums verstärken. Die elektronischen (analog generierten, deshalb trotz metallischer Härte organisch anmutenden) Klänge der Kultgruppe Pan Sonic - ihre bislang konzentrierteste Arbeit - begleiten bohrend, schraubend, klopfend, ganz tief im Subwoofer atmend oder auch elegisch distanzierend - das simultane Geschehen und infizieren es mit einer kontrapunktischen, fatalistischen Gelassenheit selbst dort, wo sie das unheimliche Weltraumrauschen düsterer Science-Fiction-Filme evozieren. Spätestens dann ahnen wir: auf diesem Planeten sind wir die Aliens.
Die ambitionierte Soundgestaltung, zu der auch die verfremdeten Arbeitsgeräusche in und um das KKW gehören, die wie in unendliche Ferne oder Vergangenheit gerückt ertönen, hat einen (gewollten?) Effekt, den man zwar aus essayistischen oder experimentellen Filmen kennt, dessen psychische Dynamik aber einem noch nie so unmittelbar greifbar wurde: Es gelingt ihr, die Aufmerksamkeit des Publikums parasympathisch zu tunen, wodurch die auditiven Impulse das visuelle System daran hindern, das Gesehene sogleich zu identifizieren und als immer schon Gewusstes (dies sind Brennstäbe, das ein Reaktor und so weiter) abzuhaken. Diese akustische Suspension des visuellen Identifikationszwangs öffnet einen Resonanzraum kindlicher Unvoreingenommenheit für die faszinierend-verstörende Erfahrung dessen, worum es diesem Film geht: das Menschenferne - der Technik, der Natur und nicht zuletzt der bewusstseinsfernen Natur im wahrnehmenden Subjekt, das sich dem mimetischen Sog überlässt.
Ästhetisch gesprochen: hier versucht eine Kunst auf der Höhe ihrer technischen Möglichkeiten etwas von dem Unvorstellbaren zu vergegenwärtigen, das laut Günther Anders wie ein nihilistischer Schatten moderne Wissenschaft und Technologie begleitet. Als "prometheisches Gefälle" bezeichnete er schon vor mehr als einem halben Jahrhundert mit Blick auf die Atomkraft das anthropologische Verhängnis, dass der Mensch nicht mehr in der Lage ist, sich das vorzustellen, was er herstellt und schon gar nicht, welche Folgen oder Wirkungen sein Tun hat. Insofern Taanila eine Darstellungsform für dieses Un-Geheure, Un-Heimliche des Menschengemachten findet, das unser Auffassungsvermögen transzendiert, schlägt er ein neues Kapitel in der Ästhetik des Erhabenen auf. Diese hatte immer schon das Menschenferne im Blick - als Gleichgültigkeit von Naturschauspielen und als sichere Distanz des Betrachters, der das Schauspiel der Überwältigung genießt.
Mit dem Schauer vor dem Menschenfernen bringt uns Taanila diesem Paradoxon unserer Zivilisation näher, dass wir großtechnologisch die Ausgeliefertheit des vormodernen Menschen an die Naturgewalten wiederhergestellt und somit den anthropologischen Sinn des Fortschrittsprozesses zunichte gemacht haben. Er zeigt die Verlorenheit der Menschen - der gläubigen Techniker, der perplexen Bauer, selbst der ignoranten Städter - angesichts des selbstgeschaffenen Molochs. Auf der anderen Seite verbirgt er nicht seine Faszination für die hermetische Schönheit der technoiden Kunstwelt. Unvergesslich etwa die an Kranseilen orangerot vor blassblauem Himmel schwebenden Zementmischmaschinen. In solchen Momenten begreift man, was Kunst heute sein kann: die präzise Artikulation einer synergetischen Sensibilität, die um die Affinität der angeschlossenen Apparatur (des Equipment) zu ihrem Gegenstand (in diesem Fall der Nukleartechnologie) weiß - eine konzisere Meditation über Heideggers "Gestell" ist nicht denkbar.
Taanilas Arbeit leistet die von der documenta-Leitung programmatisch verkündete (posthumanistische, anthropofugale) Dezentrierung des herrschenden Menschenbildes - seines zumindest in den Machteliten ungebrochenen Selbstverständnisses als Macher, Verfüger und Entscheider über die Geschicke des Planeten - unmerklich, unprätentiös: ohne Behauptung oder Belehrung, ohne Fingerzeig, Forderung oder Anklage. Er zeigt sie einfach, im wortlosen, kommentarlosen, rhythmischen Miteinander, Nebeneinander, Ineinander der Bildsequenzen. Die Intensität seiner Einblicke in die Abgründe unseres ambivalenten Naturverhältnisses lässt sich allenfalls mit Werner Herzogs "Lektionen in Finsternis" - sein waghalsiger Flug durch die brennenden Ölfeder Iraks (1992) - oder mit Peter Mettlers "Petropolis" (2009), der (teilweise auch mit Luftaufnahmen) die gigantische Landschaftszerstörung bei der Förderung von Ölsand im kanadischen Saskatchewan festgehalten hat.
Mika Taanila geht aber einen Schritt weiter, nicht nur durch die dreigeteilte Projektion und die coenästhetische Soundgestaltung, sondern in dem Verzicht auf alle apokalyptische Aufgeregtheit oder der Beschwörung von Katastrophenszenarien: der Film fängt beim gewöhnlichen Endverbraucher elektrischer Energie an - und hört auch bei diesem auf. Doch trotz seiner kurzen Dauer wirkt er durch seine Dichte fast schon monumental, in gewisser Weise erschöpfend, und trotz seines phänomenologisch konstatierenden Gestus entlässt er den Zuschauer in der Stimmung, einen Nachruf erlebt zu haben: das also war sie, unsere moderne, elektrifizierte Zivilisation. Nur in wenigen Einstellungen - keineswegs den letzten - verrät sich der Melancholiker Taanila, wenn er seine Visionen dem Windesrauschen, der Musik der Vergänglichkeit par excellence, anvertraut oder den verregneten Schwarzweißschnipseln ruinierten Zelluloidmaterials...
Daniele Dell'Agli
Kommentieren