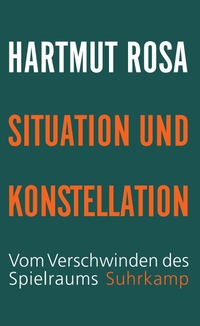Essay
Große Träume, leere Konten
Von Lea Kosch
05.11.2013. Deutsche Theater kritisieren sehr gern den Kapitalismus. Die Arbeitsbedingungen an den Häusern zeigen aber, dass Ausbeutung auch ohne geht. Nun regt sich Unmut unter Künstlern.Es sollte eine Sternstunde werden. 125 Jahre Burgtheater - ein Achteljahrtausend herausragende Schauspielkunst am renommiertesten Sprechtheater im deutschsprachigen Raum. Um dies gebührend zu feiern, veranstaltete man im Oktober einen Kongress unter dem viel versprechenden Motto "Von welchem Theater träumen wir?". Und so fand sich die Prominenz der Theaterwelt in dem pompösen Saal ein, ließ sich auf den roten Samtsesseln nieder und sprach über ihre Träume.
Auch Christian Diaz hat Träume und so betrat er wagemutig in einer Redepause die Bühne und richtete sein Wort an das verdutzte Publikum. Diaz ist Billeteur am Burgtheater. Als solcher steht er im Foyer bereit, begrüßt die eintretenden Gäste und weist ihnen den Weg zu ihrem Platz. An diesem Abend wies man allerdings ihn, und zwar zum Ausgang. Denn das Thema seiner Ansprache stieß der Direktion übel auf und daher wollte man offenkundig auch nicht hören, wovon nun dieser aufmüpfige Mitarbeiter träumte.
Der Meinung waren allerdings nicht alle. "Da kommt wenigstens mal ein bisschen Leben rein", rief ein Zuschauer Karin Bergmann, der Kuratorin des Kongresses, zu, als diese Diaz rüde das Wort entzogen hatte (hier die Szene auf Video).
Sein Anliegen hatte Diaz dennoch formulieren können: Als Billeteur sei er nicht direkt beim Theater angestellt, sondern bei dem dänisch-britischen Securityunternehmen G4S. Dieses sei dafür bekannt, dass es weltweit Abschiebegefängnisse und Asylbewerberlager betreibe. Er identifiziere sich mit dem Burgtheater und wolle somit auch dort unter Vertrag sein und nicht Mitarbeiter eines Unternehmens bleiben, dessen Geschäftspraktiken er keinesfalls unterstützen könne: "Ich träume von einem Theater, das sich gegen die Politik stellt, welche Outsourcing, Privatisierung und damit wachsende Ungerechtigkeit in unserer Gesellschaft fördert."
Der Vorfall erregte die Aufmerksamkeit der österreichischen Medien. Kurier (hier) und Standard (hier) berichteten. Bei Facebook und Twitter wurde diskutiert. In deutschen Medien fand die Sache zunächst nur wenig Beachtung, lediglich Berliner Zeitung (hier) und Freitag (hier) kommentierten die Aktion. Vor kurzem lieferte die FAZ einen Hintergrundbericht zu G4S, aus dem hervorgeht, dass die Security-Firma "noch gerade haarscharf innerhalb der gesetzlichen Möglichkeiten" agiere. So etwa, wenn sie ihren Mitarbeitern Sechzehn-Stunden-Dienste zumutet und sie mit Saison-Verträgen abspeist.
Nachtkritik hatte der Sache von Anfang an besondere Aufmerksamkeit geschenkt und die Pressemitteilung des Burgtheaters, die zwei Tage später herausgegeben wurde, veröffentlicht. Darin erklärte die Geschäftsleitung lapidar, sie habe "Sympathien mit allen, die in den globalisierten Märkten Gerechtigkeit suchen". Eher zynisch versuchten die Direktoren, die Sache als ein gesamtgesellschaftliches Problem zu bagatellisieren: "Es ist uns bewusst, dass mit dem Besuch einer Tankstelle oder eines Oberbekleidungsgeschäftes der aufgeklärte Bürger in ständigen Gewissenskonflikt gerät", heißt es in dem Statement.
In einem Punkt haben die Burgtheater-Oberen allerdings recht: Outsourcing ist nicht das eigentliche Problem. Theater in Deutschland und Österreich haben längst bewiesen, dass sie auch ohne Drittfirmen unhaltbare Arbeitsbedingungen schaffen können.
Von einem Mindestlohn, wie er zur Zeit in der Großen Koalition verhandelt wird, können viele auch fest angestellte Mitarbeiter eines Theaters nur träumen. Von Freien ganz zu schweigen. Wagt man einen Blick auf die Kulturlandschaft, sieht es richtig düster aus. 8,50 Euro sollen ab 2015 flächendeckend für alle Tarifverträge eingeführt werden. Grandios, "doch was ist mit dem Theater, diesem leuchtenden Ideal kapitalistischer Selbstausbeutung?" fragt Michael Masberg, Regisseur, Autor und scharfer Kritiker eines Systems, zu dem er selbst jahrelang gehörte. Als ehemaliger Regieassistent weiß er über die Zustände am Theater Bescheid und seine Erkenntnisse sind niederschmetternd. Gerade Regieassistenten führen die Rangliste der schlecht bezahlten Jobs am Theater deutlich an.
Mit einer Arbeitszeit, die bis zu 70 bis 80 Stunden die Woche erreichen kann, verbringen sie mehr Zeit am Theater als irgendjemand sonst und haben mit am meisten Aufgaben zu erledigen - ruhelose Geister mit Schatten unter den Augen, die man zu jeder Tages- und Nachtzeit trifft, wie sie durch die Flure hetzen, von Termin zu Besprechung, zu Probe, zu den Handwerkern, zur Intendanz. So viel Kaffee kann man überhaupt nicht trinken, dass man da nicht früher oder später kollabiert.
Und doch reißen sich junge ambitionierte Ahnungslose (oder Verblendete?) um den Job, in der Hoffnung, nach der Assistenzzeit selbst ein Regieprojekt zu ergattern. Das Mindestgehalt liegt bei 1.600 Euro brutto im Monat, das ergibt, so errechnet Masberg, in arbeitsintensiven Zeiten einen Stundenlohn von erbärmlichen 2,50 Euro.
"Für einen Beruf, der als Nervenzentrum eine Produktion am Leben hält, ohne den ein reibungsloser Ablauf gar nicht denkbar wäre, der häufig von studierten Menschen ausgeübt wird, ist dies ziemlich ernüchternd", schreibt Masberg auf seinem Blog. Gäbe es auch für Theaterschaffende einen Mindestlohn von 8,50 Euro, würde er in seiner Rechnung immerhin auf circa 2.200 Euro Monatsgehalt kommen. Erst kürzlich sprach sich der Regisseur Leander Haußmann in der Zeit für einen solchen aus, in diesem Fall die Schauspieler betreffend.
Denn die Existenz eines Schauspielers an einem Stadt- oder Staatstheater kann man ebenfalls nicht gerade als sorglos bezeichnen. Auch für sie gilt die Mindestgage von 1.600 Euro brutto. An vielen Stadttheatern erhalten erfahrene Darsteller oft weniger als 2.000 Euro. Nur die wirklich bekannten unter ihnen können Gehälter von über 4.000 Euro verlangen. Laut einer Statistik des Goethe-Instituts verdienen an vielen Theatern Verwaltungsangestellte und Bühnentechniker mehr als die Schauspieler.
An der Lage der Schauspieler sind diese aber auch zum Teil selbst Schuld, gibt Sören Fenner, Gründer und Betreiber von theaterjobs.de, zu bedenken. Sie müssten sich, so sagte er in einem Gespräch mit der Zeit, viel stärker selbst um bessere Verträge kümmern und sich in der Gewerkschaft engagieren. Oder noch besser, selbst eine gründen. Viele "haben Angst, dass sie kein Engagement mehr bekommen, wenn sie den Mund aufmachen", glaubt er. Doch nur so könnte sich an dem fragwürdigen Lohnsystem an Theatern etwas ändern.
In Kulturbetrieben gelten nämlich je nach Profession verschiedene Tarifverträge. Angestellte, die als Künstler eingestuft werden - dazu zählen unter anderem Schauspieler, Regisseure, Sänger, Tänzer, Dramaturgen, Bühnenbildner und Assistenten - arbeiten nach den Bestimmungen des "Normalvertrags Bühne", die beispielsweise keine geregelten Arbeitszeiten vorsehen.
Auch vergeben die Theater für Künstler laut dem Deutschen Bühnenverein in der Regel nur befristete Verträge. Für nichtkünstlerisch Beschäftigte gilt dagegen der Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes, der ihnen feste Arbeitszeiten garantiert. Viele Theater gehen inzwischen dazu über, für viele Produktionen freie Schauspieler zu engagieren. Sie haben keine Tarifverträge, sondern verpflichten sich dem Betrieb nur jeweils für ein Stück, daher gilt für sie nicht einmal die Mindestgage des NV Bühne.
Zum Vergleich: Ein Intendant eines großen Theaterhauses, der selbst auch Regie führt, kann im Jahr bis zu 250.000 Euro verdienen - nur am eigenen Haus. Hinzu kommen häufig Gagen von Gastinszenierungen an anderen Bühnen. Da kommt man nicht umhin sich stark zu wundern, ob es bei der internen Verteilung öffentlicher Gelder mit rechten oder vielmehr gerechten Dingen zugeht. Gerne wird über die genauen Einkommen der Intendanten daher der Mantel des Schweigens gebreitet. Warum nur ist das eine der wenigen Berufsgruppen, die ihre Gehälter nicht offenlegen müssen? Wenn doch mal etwas an die Öffentlichkeit dringt, ist man empört. Wie 2012, als in einem Artikel der Frankfurter Rundschau bekannt wurde, dass der Intendant des Schauspiel Frankfurt, Oliver Reese, eine Gehaltserhöhung von bisher 200.000 auf 240.000 Euro bis 2019 erhalten soll. Trotz sinkender Subventionen? Wo wird stattdessen gespart?
Dass Stadt- und Staatstheater-Intendanten in ihrer Position als Leiter eines mittelgroßen bis großen Betriebs gut verdienen, mag man akzeptieren, zumal im Vergleich zu Gehältern von Unternehmensleiters in der freien Wirtschaft - wie jedoch steht es mit der Vergütung der Theaterregisseure, die meist nur für eine Inszenierung an das Theater geholt werden? An renommierten Bühnen bekommt ein gefragter Regisseur bis zu 40.000 Euro für eine Probenzeit von sechs bis acht Wochen. Auch das, so könnte man meinen, ist gerechtfertigt, schließlich ist er künstlerisch verantwortlich für die Inszenierung.
Doch in Relation zu seinem direkten und wichtigsten Mitarbeiter, dem Regieassistenten, ohne den seine Arbeit unmöglich wäre, ist es immens viel Geld, nämlich ein mehr als zehn mal so hohes Gehalt. Freilich muss man davon ausgehen, dass nur ein Bruchteil der Theaterschaffenden in Deutschland von solchen Gagen profitiert. Viele Regisseure an kleinen Bühnen verdienen bei einer Theater- oder Operninszenierung lediglich um die 5.000 Euro und müssen wie freie Schauspieler zwischen den Engagements von ihrem Ersparten leben.
Dass immer mehr Künstler nicht fest angestellt sind, sondern frei arbeiten, bedeutet für sie eine immense Unsicherheit. Das gilt für alle kreativen Berufe in der Darstellenden Kunst, von Theaterschaffenden bis zu Opernsängern und Musikern. Immer mehr von ihnen fangen an, sich gegen das ausbeuterische System zu wehren, der Unmut scheint riesig. Und so löste die im Februar 2013 von dem Musical-Produzenten Johannes Maria Schatz gegründete Facebook-Seite "Die traurigsten & unverschämtesten Künstlergagen und Auditionserlebnisse" unerwartet starke Reaktionen aus.
Mit der bekannten österreichischen Mezzosopranistin Elisabeth Kulman bekam die Aktion ein prominentes Gesicht. Sie scheute nicht davor zurück, den elitären Kulturbetrieb der Höchstklasse anzuprangern und rief zur "Revolution der Künstler" auf. Opernstars wie Jonas Kaufmann und Edita Gruberova schlossen sich der Kritik an.
Zur Organisation der Forderungen gründete sich im September in Deutschland, Österreich und der Schweiz der Verein "Art but fair". Auf der Homepage erläutern die Gründer die Dringlichkeit ihrer Forderungen: "Für einen Großteil der Betroffenen ist ein finanzielles Auskommen allein aus künstlerischer Tätigkeit trotz jahrelanger Ausbildung und hoher Qualifikation nahezu unmöglich."
Daher haben sie mit den "Goldenen Regeln künstlerischen Schaffens" einen Vertrag formuliert, der die Arbeitsbedingungen für Künstler verbessern soll und "Ansätze für einen Kunst- und Kulturbetrieb von Menschen für Menschen" bietet. "Die auf der Bühne oft vehement eingeforderten Grundwerte der Menschenwürde, Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit, Verantwortung und Demokratie werden in den Betrieben nicht ausreichend gelebt und umgesetzt", heißt es darin.
Das wird offensichtlich, wenn man sich den Umgang gar mit erstklassigen Opernsängern ansieht. So kritisierte Kulman die ersatzlose Streichung der Probengelder für Produktionen der Salzburger Festspiele mit mehrwöchiger Vorbereitungsphase durch den Intendanten Alexander Pereira und die enge Termindisposition. Die Regel sind vier Aufführungen an fünf Tagen, darunter leidet die Leistung der Sänger zwangsläufig. Wenn man aufgrund der hohen Belastung während der Proben bei den Aufführungen ausfällt, macht man also ein Minus, denn die Unterkunft während der Probenzeit muss ebenfalls selbst finanziert werden. Die Tradition, die Proben nicht zu honorieren, komme, so Kulman, "aus den südlichen Ländern, in denen nicht so viel Wert auf die Regie gelegt wird, Proben dauern da maximal zehn Tage." Bei einer Probenzeit von zwei Monaten ist das schlichtweg ungeheuerlich.
Nikolaus Bachler, Intendant der Bayerischen Staatsoper, versteht den Ärger der Sänger vollkommen. "Man bezahlt den Event, aber vergisst die Arbeit. Die Arbeit ist aber das Wesentliche in der Kunst, weil nur so entsteht etwas", erklärt er in einem Beitrag des br. "Art but fair" soll eine Plattform für eine bessere Vernetzung und Solidarisierung der Künstler untereinander bieten und richtet sich gerade an Künstler, die schwerlich von ihrem Beruf leben können. Um verbesserte Konditionen zu erreichen, will das Team um Schatz und Kulman zunächst die Missstände, die der Öffentlichkeit weitestgehend unbekannt sind, offenlegen und das Image des Künstlerberufes auch in der Gesellschaft wieder aufwerten.
Kein leichtes Unterfangen in einem Bereich, der mit rückläufiger Auslastung und der Alterung des Publikums zu kämpfen hat. Der Kulturetat in deutschen Bundesländern liegt meist bei unter einem Prozent des Jahreshaushaltes, in NRW sogar nur bei 0,33 Prozent. Wieso also muss ausgerechnet hier noch mehr gespart werden? "Kürzungen sind Makulatur, täuschen aber politisches Handeln angesichts leerer Kassen vor. Die Folgen sind fatal, wird letztlich doch die Kultur mit allen Multiplikatoren beschädigt", konstatiert Masberg.
Fatal sind die Folgen vor allem für die Beschäftigten. Der Billeteur Christian Diaz wurde nach seiner unerwünschten Rede von G4S entlassen. Die Begründung: "Fehlende Identifikation mit dem Unternehmensleitbild".
Lea Kosch
Eine Presseschau der Debatte findet sich auf Nachtkritik.
Auch Christian Diaz hat Träume und so betrat er wagemutig in einer Redepause die Bühne und richtete sein Wort an das verdutzte Publikum. Diaz ist Billeteur am Burgtheater. Als solcher steht er im Foyer bereit, begrüßt die eintretenden Gäste und weist ihnen den Weg zu ihrem Platz. An diesem Abend wies man allerdings ihn, und zwar zum Ausgang. Denn das Thema seiner Ansprache stieß der Direktion übel auf und daher wollte man offenkundig auch nicht hören, wovon nun dieser aufmüpfige Mitarbeiter träumte.
Der Meinung waren allerdings nicht alle. "Da kommt wenigstens mal ein bisschen Leben rein", rief ein Zuschauer Karin Bergmann, der Kuratorin des Kongresses, zu, als diese Diaz rüde das Wort entzogen hatte (hier die Szene auf Video).
Sein Anliegen hatte Diaz dennoch formulieren können: Als Billeteur sei er nicht direkt beim Theater angestellt, sondern bei dem dänisch-britischen Securityunternehmen G4S. Dieses sei dafür bekannt, dass es weltweit Abschiebegefängnisse und Asylbewerberlager betreibe. Er identifiziere sich mit dem Burgtheater und wolle somit auch dort unter Vertrag sein und nicht Mitarbeiter eines Unternehmens bleiben, dessen Geschäftspraktiken er keinesfalls unterstützen könne: "Ich träume von einem Theater, das sich gegen die Politik stellt, welche Outsourcing, Privatisierung und damit wachsende Ungerechtigkeit in unserer Gesellschaft fördert."
Der Vorfall erregte die Aufmerksamkeit der österreichischen Medien. Kurier (hier) und Standard (hier) berichteten. Bei Facebook und Twitter wurde diskutiert. In deutschen Medien fand die Sache zunächst nur wenig Beachtung, lediglich Berliner Zeitung (hier) und Freitag (hier) kommentierten die Aktion. Vor kurzem lieferte die FAZ einen Hintergrundbericht zu G4S, aus dem hervorgeht, dass die Security-Firma "noch gerade haarscharf innerhalb der gesetzlichen Möglichkeiten" agiere. So etwa, wenn sie ihren Mitarbeitern Sechzehn-Stunden-Dienste zumutet und sie mit Saison-Verträgen abspeist.
Nachtkritik hatte der Sache von Anfang an besondere Aufmerksamkeit geschenkt und die Pressemitteilung des Burgtheaters, die zwei Tage später herausgegeben wurde, veröffentlicht. Darin erklärte die Geschäftsleitung lapidar, sie habe "Sympathien mit allen, die in den globalisierten Märkten Gerechtigkeit suchen". Eher zynisch versuchten die Direktoren, die Sache als ein gesamtgesellschaftliches Problem zu bagatellisieren: "Es ist uns bewusst, dass mit dem Besuch einer Tankstelle oder eines Oberbekleidungsgeschäftes der aufgeklärte Bürger in ständigen Gewissenskonflikt gerät", heißt es in dem Statement.
In einem Punkt haben die Burgtheater-Oberen allerdings recht: Outsourcing ist nicht das eigentliche Problem. Theater in Deutschland und Österreich haben längst bewiesen, dass sie auch ohne Drittfirmen unhaltbare Arbeitsbedingungen schaffen können.
Von einem Mindestlohn, wie er zur Zeit in der Großen Koalition verhandelt wird, können viele auch fest angestellte Mitarbeiter eines Theaters nur träumen. Von Freien ganz zu schweigen. Wagt man einen Blick auf die Kulturlandschaft, sieht es richtig düster aus. 8,50 Euro sollen ab 2015 flächendeckend für alle Tarifverträge eingeführt werden. Grandios, "doch was ist mit dem Theater, diesem leuchtenden Ideal kapitalistischer Selbstausbeutung?" fragt Michael Masberg, Regisseur, Autor und scharfer Kritiker eines Systems, zu dem er selbst jahrelang gehörte. Als ehemaliger Regieassistent weiß er über die Zustände am Theater Bescheid und seine Erkenntnisse sind niederschmetternd. Gerade Regieassistenten führen die Rangliste der schlecht bezahlten Jobs am Theater deutlich an.
Mit einer Arbeitszeit, die bis zu 70 bis 80 Stunden die Woche erreichen kann, verbringen sie mehr Zeit am Theater als irgendjemand sonst und haben mit am meisten Aufgaben zu erledigen - ruhelose Geister mit Schatten unter den Augen, die man zu jeder Tages- und Nachtzeit trifft, wie sie durch die Flure hetzen, von Termin zu Besprechung, zu Probe, zu den Handwerkern, zur Intendanz. So viel Kaffee kann man überhaupt nicht trinken, dass man da nicht früher oder später kollabiert.
Und doch reißen sich junge ambitionierte Ahnungslose (oder Verblendete?) um den Job, in der Hoffnung, nach der Assistenzzeit selbst ein Regieprojekt zu ergattern. Das Mindestgehalt liegt bei 1.600 Euro brutto im Monat, das ergibt, so errechnet Masberg, in arbeitsintensiven Zeiten einen Stundenlohn von erbärmlichen 2,50 Euro.
"Für einen Beruf, der als Nervenzentrum eine Produktion am Leben hält, ohne den ein reibungsloser Ablauf gar nicht denkbar wäre, der häufig von studierten Menschen ausgeübt wird, ist dies ziemlich ernüchternd", schreibt Masberg auf seinem Blog. Gäbe es auch für Theaterschaffende einen Mindestlohn von 8,50 Euro, würde er in seiner Rechnung immerhin auf circa 2.200 Euro Monatsgehalt kommen. Erst kürzlich sprach sich der Regisseur Leander Haußmann in der Zeit für einen solchen aus, in diesem Fall die Schauspieler betreffend.
Denn die Existenz eines Schauspielers an einem Stadt- oder Staatstheater kann man ebenfalls nicht gerade als sorglos bezeichnen. Auch für sie gilt die Mindestgage von 1.600 Euro brutto. An vielen Stadttheatern erhalten erfahrene Darsteller oft weniger als 2.000 Euro. Nur die wirklich bekannten unter ihnen können Gehälter von über 4.000 Euro verlangen. Laut einer Statistik des Goethe-Instituts verdienen an vielen Theatern Verwaltungsangestellte und Bühnentechniker mehr als die Schauspieler.
An der Lage der Schauspieler sind diese aber auch zum Teil selbst Schuld, gibt Sören Fenner, Gründer und Betreiber von theaterjobs.de, zu bedenken. Sie müssten sich, so sagte er in einem Gespräch mit der Zeit, viel stärker selbst um bessere Verträge kümmern und sich in der Gewerkschaft engagieren. Oder noch besser, selbst eine gründen. Viele "haben Angst, dass sie kein Engagement mehr bekommen, wenn sie den Mund aufmachen", glaubt er. Doch nur so könnte sich an dem fragwürdigen Lohnsystem an Theatern etwas ändern.
In Kulturbetrieben gelten nämlich je nach Profession verschiedene Tarifverträge. Angestellte, die als Künstler eingestuft werden - dazu zählen unter anderem Schauspieler, Regisseure, Sänger, Tänzer, Dramaturgen, Bühnenbildner und Assistenten - arbeiten nach den Bestimmungen des "Normalvertrags Bühne", die beispielsweise keine geregelten Arbeitszeiten vorsehen.
Auch vergeben die Theater für Künstler laut dem Deutschen Bühnenverein in der Regel nur befristete Verträge. Für nichtkünstlerisch Beschäftigte gilt dagegen der Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes, der ihnen feste Arbeitszeiten garantiert. Viele Theater gehen inzwischen dazu über, für viele Produktionen freie Schauspieler zu engagieren. Sie haben keine Tarifverträge, sondern verpflichten sich dem Betrieb nur jeweils für ein Stück, daher gilt für sie nicht einmal die Mindestgage des NV Bühne.
Zum Vergleich: Ein Intendant eines großen Theaterhauses, der selbst auch Regie führt, kann im Jahr bis zu 250.000 Euro verdienen - nur am eigenen Haus. Hinzu kommen häufig Gagen von Gastinszenierungen an anderen Bühnen. Da kommt man nicht umhin sich stark zu wundern, ob es bei der internen Verteilung öffentlicher Gelder mit rechten oder vielmehr gerechten Dingen zugeht. Gerne wird über die genauen Einkommen der Intendanten daher der Mantel des Schweigens gebreitet. Warum nur ist das eine der wenigen Berufsgruppen, die ihre Gehälter nicht offenlegen müssen? Wenn doch mal etwas an die Öffentlichkeit dringt, ist man empört. Wie 2012, als in einem Artikel der Frankfurter Rundschau bekannt wurde, dass der Intendant des Schauspiel Frankfurt, Oliver Reese, eine Gehaltserhöhung von bisher 200.000 auf 240.000 Euro bis 2019 erhalten soll. Trotz sinkender Subventionen? Wo wird stattdessen gespart?
Dass Stadt- und Staatstheater-Intendanten in ihrer Position als Leiter eines mittelgroßen bis großen Betriebs gut verdienen, mag man akzeptieren, zumal im Vergleich zu Gehältern von Unternehmensleiters in der freien Wirtschaft - wie jedoch steht es mit der Vergütung der Theaterregisseure, die meist nur für eine Inszenierung an das Theater geholt werden? An renommierten Bühnen bekommt ein gefragter Regisseur bis zu 40.000 Euro für eine Probenzeit von sechs bis acht Wochen. Auch das, so könnte man meinen, ist gerechtfertigt, schließlich ist er künstlerisch verantwortlich für die Inszenierung.
Doch in Relation zu seinem direkten und wichtigsten Mitarbeiter, dem Regieassistenten, ohne den seine Arbeit unmöglich wäre, ist es immens viel Geld, nämlich ein mehr als zehn mal so hohes Gehalt. Freilich muss man davon ausgehen, dass nur ein Bruchteil der Theaterschaffenden in Deutschland von solchen Gagen profitiert. Viele Regisseure an kleinen Bühnen verdienen bei einer Theater- oder Operninszenierung lediglich um die 5.000 Euro und müssen wie freie Schauspieler zwischen den Engagements von ihrem Ersparten leben.
Dass immer mehr Künstler nicht fest angestellt sind, sondern frei arbeiten, bedeutet für sie eine immense Unsicherheit. Das gilt für alle kreativen Berufe in der Darstellenden Kunst, von Theaterschaffenden bis zu Opernsängern und Musikern. Immer mehr von ihnen fangen an, sich gegen das ausbeuterische System zu wehren, der Unmut scheint riesig. Und so löste die im Februar 2013 von dem Musical-Produzenten Johannes Maria Schatz gegründete Facebook-Seite "Die traurigsten & unverschämtesten Künstlergagen und Auditionserlebnisse" unerwartet starke Reaktionen aus.
Mit der bekannten österreichischen Mezzosopranistin Elisabeth Kulman bekam die Aktion ein prominentes Gesicht. Sie scheute nicht davor zurück, den elitären Kulturbetrieb der Höchstklasse anzuprangern und rief zur "Revolution der Künstler" auf. Opernstars wie Jonas Kaufmann und Edita Gruberova schlossen sich der Kritik an.
Zur Organisation der Forderungen gründete sich im September in Deutschland, Österreich und der Schweiz der Verein "Art but fair". Auf der Homepage erläutern die Gründer die Dringlichkeit ihrer Forderungen: "Für einen Großteil der Betroffenen ist ein finanzielles Auskommen allein aus künstlerischer Tätigkeit trotz jahrelanger Ausbildung und hoher Qualifikation nahezu unmöglich."
Daher haben sie mit den "Goldenen Regeln künstlerischen Schaffens" einen Vertrag formuliert, der die Arbeitsbedingungen für Künstler verbessern soll und "Ansätze für einen Kunst- und Kulturbetrieb von Menschen für Menschen" bietet. "Die auf der Bühne oft vehement eingeforderten Grundwerte der Menschenwürde, Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit, Verantwortung und Demokratie werden in den Betrieben nicht ausreichend gelebt und umgesetzt", heißt es darin.
Das wird offensichtlich, wenn man sich den Umgang gar mit erstklassigen Opernsängern ansieht. So kritisierte Kulman die ersatzlose Streichung der Probengelder für Produktionen der Salzburger Festspiele mit mehrwöchiger Vorbereitungsphase durch den Intendanten Alexander Pereira und die enge Termindisposition. Die Regel sind vier Aufführungen an fünf Tagen, darunter leidet die Leistung der Sänger zwangsläufig. Wenn man aufgrund der hohen Belastung während der Proben bei den Aufführungen ausfällt, macht man also ein Minus, denn die Unterkunft während der Probenzeit muss ebenfalls selbst finanziert werden. Die Tradition, die Proben nicht zu honorieren, komme, so Kulman, "aus den südlichen Ländern, in denen nicht so viel Wert auf die Regie gelegt wird, Proben dauern da maximal zehn Tage." Bei einer Probenzeit von zwei Monaten ist das schlichtweg ungeheuerlich.
Nikolaus Bachler, Intendant der Bayerischen Staatsoper, versteht den Ärger der Sänger vollkommen. "Man bezahlt den Event, aber vergisst die Arbeit. Die Arbeit ist aber das Wesentliche in der Kunst, weil nur so entsteht etwas", erklärt er in einem Beitrag des br. "Art but fair" soll eine Plattform für eine bessere Vernetzung und Solidarisierung der Künstler untereinander bieten und richtet sich gerade an Künstler, die schwerlich von ihrem Beruf leben können. Um verbesserte Konditionen zu erreichen, will das Team um Schatz und Kulman zunächst die Missstände, die der Öffentlichkeit weitestgehend unbekannt sind, offenlegen und das Image des Künstlerberufes auch in der Gesellschaft wieder aufwerten.
Kein leichtes Unterfangen in einem Bereich, der mit rückläufiger Auslastung und der Alterung des Publikums zu kämpfen hat. Der Kulturetat in deutschen Bundesländern liegt meist bei unter einem Prozent des Jahreshaushaltes, in NRW sogar nur bei 0,33 Prozent. Wieso also muss ausgerechnet hier noch mehr gespart werden? "Kürzungen sind Makulatur, täuschen aber politisches Handeln angesichts leerer Kassen vor. Die Folgen sind fatal, wird letztlich doch die Kultur mit allen Multiplikatoren beschädigt", konstatiert Masberg.
Fatal sind die Folgen vor allem für die Beschäftigten. Der Billeteur Christian Diaz wurde nach seiner unerwünschten Rede von G4S entlassen. Die Begründung: "Fehlende Identifikation mit dem Unternehmensleitbild".
Lea Kosch
Eine Presseschau der Debatte findet sich auf Nachtkritik.
1 Kommentar