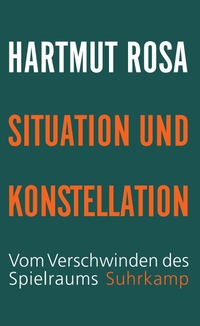Essay
Zementierung der Misere
Von Ilja Braun
06.01.2010. Die Journalistengewerkschaften haben sich überraschend mit Zeitungsverlegern auf eine "Vergütungsregel" für freie Journalisten geeinigt. Lassen sich djv und Ver.di die Absicherung kümmerlicher Honorare mit ihrer Zustimmung zu den Forderungen der Verleger nach Leistungsschutzrechten abkaufen?Die Katze ist aus dem Sack: Die Journalistengewerkschaften dju und djv haben gestern ihren mit dem Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger ausgehandelten Entwurf einer "gemeinsamen Vergütungsregel" (hier als pdf-Dokument) für freie Journalisten an Tageszeitungen vorgelegt. Das Ergebnis ist ein Armutszeugnis. Die Vereinbarung wird nicht nur die Misere eines ganzen Berufsstands auf Dauer zementieren, sondern auch den Qualitätsrückgang im Tageszeitungsjournalismus beschleunigen. Und man fragt sich, ob sich die Gewerkschaften die Absicherung kümmerlicher Zeilensätze mit ihrer Zustimmung zu den Forderungen der Verleger nach Leistungsschutzrechten abkaufen lassen - dazu weiter unten.
Festgelegt werden Erstveröffentlichungshonorare für journalistische Texte in Tageszeitungen, die sich im Bereich zwischen 38 Cent und 1,65 Euro pro Druckzeile bewegen, je nach Textgattung und Auflage der Zeitung. Damit liegen sie teilweise über dem, was Tageszeitungen derzeit zahlen, aber weit unter dem, was Journalisten benötigen würden, um von ihrer Arbeit leben zu können. Ein kleines Rechenbeispiel: Wer etwa 90 Cent pro Zeile bekommt, erhält für einen Text, der eine halbe Zeitungsseite füllt, ungefähr 200 Euro Honorar. Handelt es sich dabei etwa um eine Filmkritik oder erfordert der Text eine aufwändige Recherche, sind damit schnell mal zwei Tage Arbeit verbunden. Dass professionelle Journalisten folglich von diesen Sätzen ihren Lebensunterhalt nicht bestreiten können, liegt auf der Hand. Eine gerechte Honorierung journalistischer Arbeit müsste vielmehr nach Aufwand und "Schöpfungshöhe" erfolgen, wie Juristen es formulieren würden, nicht nach Textlänge. Und wenn sie das Gütesiegel "angemessen" verdienen sollten, müssten sie um ein Vielfaches höher liegen.
Der Anspruch auf "angemessene Vergütung" ergibt sich aus der Urhebervertragsrechtsnovelle von 2002. Vereinigungen von Urhebern und Verwertern sind seither vom Gesetzgeber angehalten, den Begriff "angemessen" mit Inhalt zu füllen, woraus bei Übersetzern, Filmemachern oder Komponisten bislang ebenso wenig wurde wie bei Journalisten. Das liegt auch daran, dass eine Vergütungsregel im Sinne des Urheberrechts etwas anderes ist als ein Tarifvertrag. Mit der Definition einer "angemessenen Vergütung" wird eine Definitionslücke im Gesetz ausgefüllt. Zugleich aber wird die Honorarentwicklung nach oben gedeckelt, denn kein Verlag hat Anlass, mehr zu zahlen, als "angemessen" ist. Und anders als ein Tarifvertrag kann eine Vergütungsregel nicht in regelmäßigen Abständen nachverhandelt werden, da ihre einseitige "Kündigung" keinerlei Konsequenzen nach sich zieht.
Deshalb ist es falsch, wie djv-Chef Michael Konken es tut, eine Vergütungsregel als "wichtigen Schritt auf dem Weg zur Sicherung der materiellen Basis freier Journalisten" zu betrachten. Eine Vergütungsregel ist nie der erste, sondern immer der letzte Schritt, da sie vor allem den Verlagen Rechtssicherheit verschafft: Auch vor Gericht kann fortan kein Urheber mehr eine höhere Vergütung einklagen. Es steht Verlagen wohlgemerkt auch ohne den Abschluss einer solchen Regelung frei, ihren freien Mitarbeitern zukünftig höhere Honorare zu zahlen als bisher. Wenn jedoch die Journalisten den Verlegern schriftlich geben, dass diese Honorierung "angemessen" sei, stellen sie sie damit von sämtlichen weitergehenden Ansprüchen frei, und zwar für die nächsten Jahrzehnte. Sie geben damit das einzige Druckmittel aus der Hand, das sie haben. Sie brauchen sich dann nicht zu wundern, wenn sie auch zukünftig von ihrer Arbeit nicht werden leben können.
Wie würde eigentlich ein Gericht bestimmen, was eine "angemessene Vergütung" ist? Es würde sich am sogenannten Beteiligungsgrundsatz orientieren. Dieser besagt, dass der Urheber an jeder wirtschaftlichen Nutzung seines Werks nach Maßgabe der Intensität dieser Nutzung zu beteiligen ist. Wenn ein Text nicht nur in einer Zeitung abgedruckt, sondern zugleich im Internet und in verschiedenen anderen Blättern verwertet oder über Datenbanken und Archive an Endnutzer verkauft wird, muss das Honorar dafür höher sein als für die sogenannte einfache Nutzung.
Kürzlich hatte der Bundesgerichtshof bei den Literaturübersetzern über eine solche angemessene Vergütung zu befinden. Wenig überraschend ist dabei herausgekommen (mehr hier), dass der Verlag neben einem Grundhonorar eine Beteiligung an sämtlichen Nutzungserlösen zu zahlen hat. Ob Online-Rechte, Taschenbuchausgabe oder Lizenzen für Film und Fernsehen - grundsätzlich darf der Urheber bei alledem nicht leer ausgehen, meinte der Bundesgerichtshof.
Anders sehen es die Gewerkschaften. Die vorliegende Vergütungsregel für freie Journalisten an Tageszeitungen jedenfalls missachtet diesen urheberrechtlichen Beteiligungsgrundsatz. Der Verlag als Auftraggeber zahlt für einen Text ein einmaliges Zeilenhonorar in marktüblicher Höhe. Mit diesem sind sämtliche Nutzungen, die der Verlag selbst vornehmen möchte, pauschal abgegolten. Weder für eine Veröffentlichung im Internet noch für einen Weiterverkauf der Artikel an Privatpersonen aus dem Archiv heraus erhält der Journalist ein zusätzliches Honorar. Auch für eine Veröffentlichung des Textes in anderen Medien als jener Zeitung, für die der Beitrag angekauft wurde, wird keine zusätzliche Vergütung fällig, wenn es sich dabei um eine Zusammenarbeit mit "Redaktionsgemeinschaften" handelt, mit denen "ein regelmäßiger Austausch von redaktionellen Beiträgen" gepflegt wird. (Ausnahme: Die Einzelauflagen beider Medien ergeben in der Addition eine Gesamtauflagenhöhe, bei der nach Honorartabelle ein höheres Zeilenhonorar fällig geworden wäre - dann ist das Recht zur Mehrfachnutzung mit der Zahlung des entsprechenden Aufschlags abgegolten.)
Alle Nutzungsrechte, die der Verlag selbst benötigt, erhält er also gegen eine geringe Einmalzahlung - ein klassisches Total Buyout. Zusätzliche Honorierung findet nur dann statt, wenn der Verlag sich als Agent betätigt, als Rechtehändler. Wenn er einen Artikel an eine Zeitung weiterverkauft, mit der er nicht standardmäßig kooperiert, soll er dem Journalisten zusätzlich 40 Prozent des Honorars zahlen, das für eine Erstnutzung laut Tabelle fällig geworden wäre, vorausgesetzt, eine gewisse Auflagenschwelle wird überschritten. Eine echte Erlösbeteiligung gibt es nur, wenn Artikel an externe Datenbanken (wie Genios) oder Online-Dienste weitervertickt werden. Dann soll der Journalist 55 Prozent bekommen. Doch Bemessungsgrundlage jener 55 Prozent sind nicht etwa die tatsächlichen, beim Verlag eingehenden Einnahmen, sondern es dürfen unbegrenzt unkontrollierbare "Herstellungs-, Marketing- und Vertriebskosten" davon abgezogen werden. Der Verlag kann seine Einnahmen also auf Null herunterrechnen.
Eine angemessene Vergütung für freie Journalisten, die diesen Namen verdient, sähe anders aus. Sie müsste zumindest zwei Bedingungen erfüllen: Jede Nutzung müsste honoriert werden - umfangreiche Rechteübertragungen gegen lediglich kosmetische Aufschläge auf magere Grundhonorare müssten ausgeschlossen sein. Und zusätzlich müsste der Urheber am tatsächlichen wirtschaftlichen Erlös einer jeden Nutzung seiner Arbeit angemessen beteiligt werden.
Die vorliegende Vergütungsregel erfüllt diese Bedingungen beide nicht. Weil solche Forderungen unrealistisch wären? Keineswegs. In der letzten Zeit haben diverse Gerichte genau in diesem Sinne entschieden - nicht zuletzt der Bundesgerichtshof in seinem Urteil zur Vergütung literarischer Übersetzer. Dass die Journalistengewerkschaften sich dennoch über derartige urheberrechtliche Grundsätze hinwegsetzen, als hätten sie nie davon gehört, ja dass sie mit dieser Vergütungsregel zum Ausverkauf der Rechte freier Journalisten sogar entscheidend beitragen, mag bedauerlich sein. Verwunderlich ist es nicht.
Ein Blick auf die letzte Seite der Vereinbarung gibt Aufschluss. Da ist nämlich plötzlich von Vergütungsansprüchen die Rede, die sich "aus einem gesetzlichen Leistungsschutzrecht der Verlage" ergeben. Erstaunlicherweise, denn ein solches Recht gibt es bislang gar nicht. Zum Leidwesen der Verleger, die es gerne hätten, weil es sie in die Lage versetzen würde, von den Internetprovidern als kommerziellen Nutzern der Verlagsangebote im Netz Abgaben zu kassieren (die diese wiederum von den Endnutzern erheben würden). Bislang hat sich aber das Bundesjustizministerium noch nicht dazu bewegen lassen, einen Referentenentwurf für ein solches Gesetz tatsächlich vorzulegen. Gut möglich, dass man im Hause Leutheuser-Schnarrenberger erst einmal eine Einigung über die Vergütung der freien Journalisten sehen wollte.
Ist es ein Zufall, dass Verhandlungen, die sechs Jahre keinerlei Ergebnis gezeitigt haben, ausgerechnet jetzt zu einem so glücklichen Abschluss gelangt sind? Und dass in diesem Abschluss der Anspruch der Presseverleger auf ein Leistungsschutzrecht von den Gewerkschaften explizit anerkannt wird? Zu behaupten, die Journalistengewerkschaften hätten mit den Verlegern einen Kuhhandel gemacht: Leistungsschutzrecht gegen Vergütungsregel, wäre eine Unterstellung. Doch warum sonst sollte in einer Vergütungsregel darauf eingegangen werden, wie zukünftig Abgaben verteilt werden sollen, für deren Erhebung es bislang nicht einmal eine gesetzliche Grundlage gibt?
Der eigentliche Zweck der vorliegenden Vergütungsregel ist offenkundig nicht, freie Journalisten an Tageszeitungen zukünftig angemessen zu bezahlen, sondern die Zustimmung der Gewerkschaften zu einem verlegerischen Leistungsschutzrecht zu erkaufen. Damit erlangt die Vereinbarung eine Dimension, die weit über das hinausgeht, was eine Honorarvereinbarung zwischen zwei Parteien sinnvollerweise leisten soll. Und damit betrifft sie durchaus nicht nur die freien Journalisten.
Ilja Braun
Ilja Braun lebt und arbeitet als freier Journalist in Köln und Amsterdam. Er gehört der Redaktion von irights.info an und ist Mitglied bei den Freischreiber.
Mehr zum Thema auch bei Carta: "Die Vergütungsregelung ist Augenwischerei", von Wolfgang Michal.
Festgelegt werden Erstveröffentlichungshonorare für journalistische Texte in Tageszeitungen, die sich im Bereich zwischen 38 Cent und 1,65 Euro pro Druckzeile bewegen, je nach Textgattung und Auflage der Zeitung. Damit liegen sie teilweise über dem, was Tageszeitungen derzeit zahlen, aber weit unter dem, was Journalisten benötigen würden, um von ihrer Arbeit leben zu können. Ein kleines Rechenbeispiel: Wer etwa 90 Cent pro Zeile bekommt, erhält für einen Text, der eine halbe Zeitungsseite füllt, ungefähr 200 Euro Honorar. Handelt es sich dabei etwa um eine Filmkritik oder erfordert der Text eine aufwändige Recherche, sind damit schnell mal zwei Tage Arbeit verbunden. Dass professionelle Journalisten folglich von diesen Sätzen ihren Lebensunterhalt nicht bestreiten können, liegt auf der Hand. Eine gerechte Honorierung journalistischer Arbeit müsste vielmehr nach Aufwand und "Schöpfungshöhe" erfolgen, wie Juristen es formulieren würden, nicht nach Textlänge. Und wenn sie das Gütesiegel "angemessen" verdienen sollten, müssten sie um ein Vielfaches höher liegen.
Der Anspruch auf "angemessene Vergütung" ergibt sich aus der Urhebervertragsrechtsnovelle von 2002. Vereinigungen von Urhebern und Verwertern sind seither vom Gesetzgeber angehalten, den Begriff "angemessen" mit Inhalt zu füllen, woraus bei Übersetzern, Filmemachern oder Komponisten bislang ebenso wenig wurde wie bei Journalisten. Das liegt auch daran, dass eine Vergütungsregel im Sinne des Urheberrechts etwas anderes ist als ein Tarifvertrag. Mit der Definition einer "angemessenen Vergütung" wird eine Definitionslücke im Gesetz ausgefüllt. Zugleich aber wird die Honorarentwicklung nach oben gedeckelt, denn kein Verlag hat Anlass, mehr zu zahlen, als "angemessen" ist. Und anders als ein Tarifvertrag kann eine Vergütungsregel nicht in regelmäßigen Abständen nachverhandelt werden, da ihre einseitige "Kündigung" keinerlei Konsequenzen nach sich zieht.
Deshalb ist es falsch, wie djv-Chef Michael Konken es tut, eine Vergütungsregel als "wichtigen Schritt auf dem Weg zur Sicherung der materiellen Basis freier Journalisten" zu betrachten. Eine Vergütungsregel ist nie der erste, sondern immer der letzte Schritt, da sie vor allem den Verlagen Rechtssicherheit verschafft: Auch vor Gericht kann fortan kein Urheber mehr eine höhere Vergütung einklagen. Es steht Verlagen wohlgemerkt auch ohne den Abschluss einer solchen Regelung frei, ihren freien Mitarbeitern zukünftig höhere Honorare zu zahlen als bisher. Wenn jedoch die Journalisten den Verlegern schriftlich geben, dass diese Honorierung "angemessen" sei, stellen sie sie damit von sämtlichen weitergehenden Ansprüchen frei, und zwar für die nächsten Jahrzehnte. Sie geben damit das einzige Druckmittel aus der Hand, das sie haben. Sie brauchen sich dann nicht zu wundern, wenn sie auch zukünftig von ihrer Arbeit nicht werden leben können.
Wie würde eigentlich ein Gericht bestimmen, was eine "angemessene Vergütung" ist? Es würde sich am sogenannten Beteiligungsgrundsatz orientieren. Dieser besagt, dass der Urheber an jeder wirtschaftlichen Nutzung seines Werks nach Maßgabe der Intensität dieser Nutzung zu beteiligen ist. Wenn ein Text nicht nur in einer Zeitung abgedruckt, sondern zugleich im Internet und in verschiedenen anderen Blättern verwertet oder über Datenbanken und Archive an Endnutzer verkauft wird, muss das Honorar dafür höher sein als für die sogenannte einfache Nutzung.
Kürzlich hatte der Bundesgerichtshof bei den Literaturübersetzern über eine solche angemessene Vergütung zu befinden. Wenig überraschend ist dabei herausgekommen (mehr hier), dass der Verlag neben einem Grundhonorar eine Beteiligung an sämtlichen Nutzungserlösen zu zahlen hat. Ob Online-Rechte, Taschenbuchausgabe oder Lizenzen für Film und Fernsehen - grundsätzlich darf der Urheber bei alledem nicht leer ausgehen, meinte der Bundesgerichtshof.
Anders sehen es die Gewerkschaften. Die vorliegende Vergütungsregel für freie Journalisten an Tageszeitungen jedenfalls missachtet diesen urheberrechtlichen Beteiligungsgrundsatz. Der Verlag als Auftraggeber zahlt für einen Text ein einmaliges Zeilenhonorar in marktüblicher Höhe. Mit diesem sind sämtliche Nutzungen, die der Verlag selbst vornehmen möchte, pauschal abgegolten. Weder für eine Veröffentlichung im Internet noch für einen Weiterverkauf der Artikel an Privatpersonen aus dem Archiv heraus erhält der Journalist ein zusätzliches Honorar. Auch für eine Veröffentlichung des Textes in anderen Medien als jener Zeitung, für die der Beitrag angekauft wurde, wird keine zusätzliche Vergütung fällig, wenn es sich dabei um eine Zusammenarbeit mit "Redaktionsgemeinschaften" handelt, mit denen "ein regelmäßiger Austausch von redaktionellen Beiträgen" gepflegt wird. (Ausnahme: Die Einzelauflagen beider Medien ergeben in der Addition eine Gesamtauflagenhöhe, bei der nach Honorartabelle ein höheres Zeilenhonorar fällig geworden wäre - dann ist das Recht zur Mehrfachnutzung mit der Zahlung des entsprechenden Aufschlags abgegolten.)
Alle Nutzungsrechte, die der Verlag selbst benötigt, erhält er also gegen eine geringe Einmalzahlung - ein klassisches Total Buyout. Zusätzliche Honorierung findet nur dann statt, wenn der Verlag sich als Agent betätigt, als Rechtehändler. Wenn er einen Artikel an eine Zeitung weiterverkauft, mit der er nicht standardmäßig kooperiert, soll er dem Journalisten zusätzlich 40 Prozent des Honorars zahlen, das für eine Erstnutzung laut Tabelle fällig geworden wäre, vorausgesetzt, eine gewisse Auflagenschwelle wird überschritten. Eine echte Erlösbeteiligung gibt es nur, wenn Artikel an externe Datenbanken (wie Genios) oder Online-Dienste weitervertickt werden. Dann soll der Journalist 55 Prozent bekommen. Doch Bemessungsgrundlage jener 55 Prozent sind nicht etwa die tatsächlichen, beim Verlag eingehenden Einnahmen, sondern es dürfen unbegrenzt unkontrollierbare "Herstellungs-, Marketing- und Vertriebskosten" davon abgezogen werden. Der Verlag kann seine Einnahmen also auf Null herunterrechnen.
Eine angemessene Vergütung für freie Journalisten, die diesen Namen verdient, sähe anders aus. Sie müsste zumindest zwei Bedingungen erfüllen: Jede Nutzung müsste honoriert werden - umfangreiche Rechteübertragungen gegen lediglich kosmetische Aufschläge auf magere Grundhonorare müssten ausgeschlossen sein. Und zusätzlich müsste der Urheber am tatsächlichen wirtschaftlichen Erlös einer jeden Nutzung seiner Arbeit angemessen beteiligt werden.
Die vorliegende Vergütungsregel erfüllt diese Bedingungen beide nicht. Weil solche Forderungen unrealistisch wären? Keineswegs. In der letzten Zeit haben diverse Gerichte genau in diesem Sinne entschieden - nicht zuletzt der Bundesgerichtshof in seinem Urteil zur Vergütung literarischer Übersetzer. Dass die Journalistengewerkschaften sich dennoch über derartige urheberrechtliche Grundsätze hinwegsetzen, als hätten sie nie davon gehört, ja dass sie mit dieser Vergütungsregel zum Ausverkauf der Rechte freier Journalisten sogar entscheidend beitragen, mag bedauerlich sein. Verwunderlich ist es nicht.
Ein Blick auf die letzte Seite der Vereinbarung gibt Aufschluss. Da ist nämlich plötzlich von Vergütungsansprüchen die Rede, die sich "aus einem gesetzlichen Leistungsschutzrecht der Verlage" ergeben. Erstaunlicherweise, denn ein solches Recht gibt es bislang gar nicht. Zum Leidwesen der Verleger, die es gerne hätten, weil es sie in die Lage versetzen würde, von den Internetprovidern als kommerziellen Nutzern der Verlagsangebote im Netz Abgaben zu kassieren (die diese wiederum von den Endnutzern erheben würden). Bislang hat sich aber das Bundesjustizministerium noch nicht dazu bewegen lassen, einen Referentenentwurf für ein solches Gesetz tatsächlich vorzulegen. Gut möglich, dass man im Hause Leutheuser-Schnarrenberger erst einmal eine Einigung über die Vergütung der freien Journalisten sehen wollte.
Ist es ein Zufall, dass Verhandlungen, die sechs Jahre keinerlei Ergebnis gezeitigt haben, ausgerechnet jetzt zu einem so glücklichen Abschluss gelangt sind? Und dass in diesem Abschluss der Anspruch der Presseverleger auf ein Leistungsschutzrecht von den Gewerkschaften explizit anerkannt wird? Zu behaupten, die Journalistengewerkschaften hätten mit den Verlegern einen Kuhhandel gemacht: Leistungsschutzrecht gegen Vergütungsregel, wäre eine Unterstellung. Doch warum sonst sollte in einer Vergütungsregel darauf eingegangen werden, wie zukünftig Abgaben verteilt werden sollen, für deren Erhebung es bislang nicht einmal eine gesetzliche Grundlage gibt?
Der eigentliche Zweck der vorliegenden Vergütungsregel ist offenkundig nicht, freie Journalisten an Tageszeitungen zukünftig angemessen zu bezahlen, sondern die Zustimmung der Gewerkschaften zu einem verlegerischen Leistungsschutzrecht zu erkaufen. Damit erlangt die Vereinbarung eine Dimension, die weit über das hinausgeht, was eine Honorarvereinbarung zwischen zwei Parteien sinnvollerweise leisten soll. Und damit betrifft sie durchaus nicht nur die freien Journalisten.
Ilja Braun
Ilja Braun lebt und arbeitet als freier Journalist in Köln und Amsterdam. Er gehört der Redaktion von irights.info an und ist Mitglied bei den Freischreiber.
Mehr zum Thema auch bei Carta: "Die Vergütungsregelung ist Augenwischerei", von Wolfgang Michal.
Kommentieren