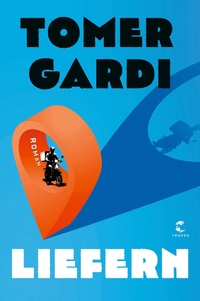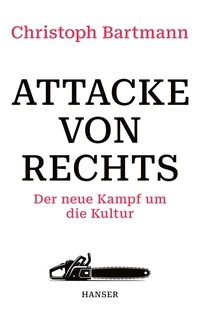Magazinrundschau
Früher hat sie einfach geweint
Ein Blick in internationale Magazine. Jeden Dienstag ab 10 Uhr.
29.06.2010. Der New Yorker porträtiert Saad Mohseni, den ersten Medienmogul Afghanistans. La vie des idees und der Guardian empfehlen Gilbert Achcars Buch "Les Arabes et la Shoah". In Ungarn fressen die Kinder ihre Revolution, fürchtet Elet es Irodalom. Magyar Narancs und Rue89 fürchten um die unabhängige Presse. In Open Democracy macht sich Lisbet Rausing Sorgen über die Zukunft der Bibliothek. In der NYRB warnt Tim Parks nicht englischsprachige Autoren vor einer internationalen liberalen Leserschaft.
New Yorker (USA), 05.07.2010
 Ken Aulettas Porträt Saad Mohsenis, des ersten Medienmoguls Afghanistans, liest sich wie eine Geschichte von Robert Louis Stevenson. Mohseni, Sohn eines Diplomaten, lernte bei einem Großonkel in Taschkent, wie man ein Geschäft aufzieht, und gründete 2002 mit seinen Geschwistern in Afghanistan das Unternehmen Moby Group. Er ist davon überzeugt, dass das Land nur deshalb nicht "explodiert" sei, weil die Medien den Menschen ein Ventil bieten. Inzwischen hat er alle geärgert: die Religiösen, weil er indische Soapoperas zeigt, die Amerikaner, weil er Bilder von Abu Ghraib zeigte, und die Regierung, weil er die Wahlfälschungen publik machte. "Richard Holbrooke, amerikanischer Sondergesandter für Afghanistan und Pakistan, beschreibt die Spannung zwischen Mohsenis Werten und denen der afghanischen Traditionalisten: 'Das Land ist in hohem Maße analphabetisch, religiös und traditionell. Und Saad zieht eine neue junge Gruppe von Menschen in den städtischen Gebieten an. Was er tut, ist brillant, aber es ist auch sehr gefährlich. Es ist ein Drama. Ich kann mir kein anderes Land in der Welt vorstellen, in der das mit so viel Intensität ausgetragen wird." Noch einflussreicher als seine politischen Programme sind aber vielleicht Mohsenis Unterhaltungssendungen, wie sogar Fazel Ahmad Manawi, der Sprecher des religiösen Ulema-Rats zugibt: "Seine zwei jungen Töchter sehen Cartoons und Kindersendungen und er gibt zu, dass das Fernsehen 'die Art verbessert, wie sich die Menschen benehmen. Wenn meine kleine Tochter ein Problem hat, ruft sie 'Hilfe'. Sie hat das aus dem Fernsehen gelernt. Früher hat sie einfach geweint.'"
Ken Aulettas Porträt Saad Mohsenis, des ersten Medienmoguls Afghanistans, liest sich wie eine Geschichte von Robert Louis Stevenson. Mohseni, Sohn eines Diplomaten, lernte bei einem Großonkel in Taschkent, wie man ein Geschäft aufzieht, und gründete 2002 mit seinen Geschwistern in Afghanistan das Unternehmen Moby Group. Er ist davon überzeugt, dass das Land nur deshalb nicht "explodiert" sei, weil die Medien den Menschen ein Ventil bieten. Inzwischen hat er alle geärgert: die Religiösen, weil er indische Soapoperas zeigt, die Amerikaner, weil er Bilder von Abu Ghraib zeigte, und die Regierung, weil er die Wahlfälschungen publik machte. "Richard Holbrooke, amerikanischer Sondergesandter für Afghanistan und Pakistan, beschreibt die Spannung zwischen Mohsenis Werten und denen der afghanischen Traditionalisten: 'Das Land ist in hohem Maße analphabetisch, religiös und traditionell. Und Saad zieht eine neue junge Gruppe von Menschen in den städtischen Gebieten an. Was er tut, ist brillant, aber es ist auch sehr gefährlich. Es ist ein Drama. Ich kann mir kein anderes Land in der Welt vorstellen, in der das mit so viel Intensität ausgetragen wird." Noch einflussreicher als seine politischen Programme sind aber vielleicht Mohsenis Unterhaltungssendungen, wie sogar Fazel Ahmad Manawi, der Sprecher des religiösen Ulema-Rats zugibt: "Seine zwei jungen Töchter sehen Cartoons und Kindersendungen und er gibt zu, dass das Fernsehen 'die Art verbessert, wie sich die Menschen benehmen. Wenn meine kleine Tochter ein Problem hat, ruft sie 'Hilfe'. Sie hat das aus dem Fernsehen gelernt. Früher hat sie einfach geweint.'"Weiteres: James Wood stellt David Mitchells Roman "The Thousand Autumns of Jacob de Zoet" vor. Peter Schjeldahl schreibt über eine Ausstellung des amerikanischen Malers Charles Burchfield im Whitney Museum. Und David Denby sah im Kino James Mangolds Actionkomödie "Knight and Day" mit Tom Cruise - der den Film irgendwie ruiniert - und Cameron Diaz und Debra Graniks Film "Winter?s Bone" (der auch auf der Berlinale lief). Zu lesen ist außerdem in der Reihe "20 under 40" die Erzählung "The Erlking" von Sarah Shun-lien Bynum sowie Lyrik von Frederick Seidel und Rae Armantrout.
La vie des idees (Frankreich), 28.06.2010
 Nora Benkorich stellt das Buch "Les Arabes et la Shoah" des libanesisch-französischen Historikers Gilbert Achcar vor, das sich mit den Gründen für eine Unterstützung oder die Ablehnung des Naziregimes und des Antisemitismus in der arabischen Welt beschäftigt. Es wirft insgesamt einen sehr viel milderen Blick auf das Verhältnis der Araber zu den Nazis als die zeitgleich in Frankreich erschienenen deutschen Veröffentlichungen "Djihad und Judenhass" von Matthias Küntzel und "Halbmond und Hakenkreuz" von Martin Cüppers und Klaus-Michael Mallmann, denen die Rezensentin einen "essentialistischen" Standpunkt vorwirft: Sie würden die Kollaboration des Muftis von Jerusalem mit den Nazis auf die muslimische Welt insgesamt projizieren und andere politische Tendenzen in der arabischen Welt zu dieser Zeit, anders als Achcar, herunterspielen: "Im Ganzen gab es mehr Araber in den alliierten Streitkräften oder den Konzentrationslagern der Nazis als Freiwillige auf Seiten der Achse. Das reicht, um - mit Achcar - zu ermessen, wie groß der Widerwille der arabischen Welt gegen die Nazis war."
Nora Benkorich stellt das Buch "Les Arabes et la Shoah" des libanesisch-französischen Historikers Gilbert Achcar vor, das sich mit den Gründen für eine Unterstützung oder die Ablehnung des Naziregimes und des Antisemitismus in der arabischen Welt beschäftigt. Es wirft insgesamt einen sehr viel milderen Blick auf das Verhältnis der Araber zu den Nazis als die zeitgleich in Frankreich erschienenen deutschen Veröffentlichungen "Djihad und Judenhass" von Matthias Küntzel und "Halbmond und Hakenkreuz" von Martin Cüppers und Klaus-Michael Mallmann, denen die Rezensentin einen "essentialistischen" Standpunkt vorwirft: Sie würden die Kollaboration des Muftis von Jerusalem mit den Nazis auf die muslimische Welt insgesamt projizieren und andere politische Tendenzen in der arabischen Welt zu dieser Zeit, anders als Achcar, herunterspielen: "Im Ganzen gab es mehr Araber in den alliierten Streitkräften oder den Konzentrationslagern der Nazis als Freiwillige auf Seiten der Achse. Das reicht, um - mit Achcar - zu ermessen, wie groß der Widerwille der arabischen Welt gegen die Nazis war."Guardian (UK), 26.06.2010
Auch der Historiker Tariq Ali ist voll des Lobs über Gilbert Achcars Buch "Les Arabes et la Shoah": "Hilberg, Peter Novick, Tony Judt, Gabi Piterburg, Norman Finkelstein, Amira Hass und viele andere Autoren jüdischen Ursprungs haben davor gewarnt, den Holocaust so zu benutzen, wie es gegenwärtig in der Politik - und nicht nur in Israel - geschieht. Es ist kurzsichtig und kontraproduktiv. Es trägt nicht zum Frieden in der Gegend bei. Ebenso wenig wie der Versuch israelischer Beamter, von Apologeten im Westen nachgeahmt, jede Opposition gegen Israels Unterdrückung der Palästinenser für antisemitisch zu erklären. Diese Art krude Propaganda, die Geschichte und Politik entwertet, mag dazu führen, dass einige dieses Label sogar akzeptieren als Preis, der für die Oppositon gegen Israels Politik gezahlt werden muss. Achcars Buch ist ein mutiger Versuch, Parteilichkeit zu vermeiden", denn Achcar erspart auch den Arabern nichts, wie Ali zu Beginn seiner Kritik schreibt.
Der kolumbianische Schriftsteller Juan Gabriel Vasquez, der Kolumbien vor vierzehn Jahren verlassen hat, spricht im Interview über seinen Roman "The Secret History of Costaguana", der die politischen Intrigen während des Baus des Panamakanals beschreibt: "'Zwei meiner literarischen Obsessionen kamen zusammen - ein dunkler Moment in der kolumbianischen Geschichte und mein literarischer Gott, der mein Land beschrieben und es dabei transformiert und verzerrt hat.' Es gibt 'keinen konkreten Beweis dafür, dass Conrad jemals Kolumbien betreten hat', sagt er. Doch für Vasquez, der eine Kurzbiografie über Conrad geschrieben hat, ist 'Nostromo' [ein Roman Joseph Conrads, der in der fiktiven Republik Costaguana spielt] bei weitem 'das beste nicht-spanischsprachige Buch über Lateinamerika. Conrad verstand, dass dieser Ort nicht aus einem psychologisch-realistischen Blickwinkel beschrieben werden konnte, darum hat er überspitzt.'"
Der kolumbianische Schriftsteller Juan Gabriel Vasquez, der Kolumbien vor vierzehn Jahren verlassen hat, spricht im Interview über seinen Roman "The Secret History of Costaguana", der die politischen Intrigen während des Baus des Panamakanals beschreibt: "'Zwei meiner literarischen Obsessionen kamen zusammen - ein dunkler Moment in der kolumbianischen Geschichte und mein literarischer Gott, der mein Land beschrieben und es dabei transformiert und verzerrt hat.' Es gibt 'keinen konkreten Beweis dafür, dass Conrad jemals Kolumbien betreten hat', sagt er. Doch für Vasquez, der eine Kurzbiografie über Conrad geschrieben hat, ist 'Nostromo' [ein Roman Joseph Conrads, der in der fiktiven Republik Costaguana spielt] bei weitem 'das beste nicht-spanischsprachige Buch über Lateinamerika. Conrad verstand, dass dieser Ort nicht aus einem psychologisch-realistischen Blickwinkel beschrieben werden konnte, darum hat er überspitzt.'"
Elet es Irodalom (Ungarn), 25.06.2010
 Die ungarische Regierung will die Verfassung überarbeiten, eine Zweidrittelmehrheit der Regierungsfraktion Fidesz im ungarischen Parlament macht's möglich. Der Jurist und ehemalige Präsident des öffentlich-rechtlichen Rundfunks Laszlo Majtenyi nimmt die jetzige Verfassung im Interview in Schutz: "Diese Verfassung ist zwar leider voller technischer Fehler, die auch auf das nicht ausreichende Fachwissen der einstigen Verfassungsgeber zurückzuführen sind. Dennoch ist es eine unglaublich starke und lebendige Verfassung, die makellose, moderne und europäische Werte vertritt. Nun schicken wir uns an, während wir an der Unfähigkeit unserer Politiker, an unserer eigenen Ohnmacht und an der weit verbreiteten Korruption leiden, gerade jene Errungenschaft zu zerstören [...] Ausgerechnet die einstigen Revolutionäre, die Helden der Wende und der 'rechtsstaatlichen Revolution', zu denen ja auch [der Fidesz-Vorsitzende] Viktor Orban gehört, treiben diese Zerstörung voran; sie demontieren dabei sich selbst und wollen das von ihnen selbst geschaffene System stürzen. ... Das ist postmoderne Politik, der Revolutionär will sein eigenes System zerstören."
Die ungarische Regierung will die Verfassung überarbeiten, eine Zweidrittelmehrheit der Regierungsfraktion Fidesz im ungarischen Parlament macht's möglich. Der Jurist und ehemalige Präsident des öffentlich-rechtlichen Rundfunks Laszlo Majtenyi nimmt die jetzige Verfassung im Interview in Schutz: "Diese Verfassung ist zwar leider voller technischer Fehler, die auch auf das nicht ausreichende Fachwissen der einstigen Verfassungsgeber zurückzuführen sind. Dennoch ist es eine unglaublich starke und lebendige Verfassung, die makellose, moderne und europäische Werte vertritt. Nun schicken wir uns an, während wir an der Unfähigkeit unserer Politiker, an unserer eigenen Ohnmacht und an der weit verbreiteten Korruption leiden, gerade jene Errungenschaft zu zerstören [...] Ausgerechnet die einstigen Revolutionäre, die Helden der Wende und der 'rechtsstaatlichen Revolution', zu denen ja auch [der Fidesz-Vorsitzende] Viktor Orban gehört, treiben diese Zerstörung voran; sie demontieren dabei sich selbst und wollen das von ihnen selbst geschaffene System stürzen. ... Das ist postmoderne Politik, der Revolutionär will sein eigenes System zerstören."New York Review of Books (USA), 15.07.2010
 Tim Parks kann den Überschwang nicht teilen, mit dem sich Aleksandar Hemon in seiner Anthologie "Best European Fiction 2010" und Edith Grossman in ihrer Schrift "Why Translation Matters" für die Übersetzung internationaler Literatur stark machen. Er stichelt gegen diese Form des literarischen Antiimperialismus, weist darauf hin, dass auch in Deutschland vor allem amerikanische Genreromane übersetzt werden und sieht im Ergebnis die Literatur eintöniger werden: "Jeder Schriftsteller wendet sich vertrauensvoll an eine internationale liberale Leserschaft auf Kosten der provinziellen Bigotterie und Heuchelei. Dies trifft umso mehr zu, wenn an die Stelle des Humors direkte Denunziation tritt: Der polnische Autor Michal Witkowski berichtet vom Schicksal eines slowakischen Strichers in Wien, der Kroate Neven Usumovic erzählt von einem illegalen Immigranten in Budapest, der von einheimischen Jugendlichen gefoltert und einem Chinesen gerettet wird. Es ist, als würde die Literatur nicht so sehr andere Kulturen reflektieren und uns zwingen, in das Exotische einzutauchen, als vielmehr Berichte von Unzulänglichkeiten und Ungerechtigkeiten an eine internationale Gemeinschaft zu übermitteln, auf deren Mitgefühl man sich verlassen kann. Diese Autoren scheinen eher ausgezeichnete Auslandskorrespondenten zu sein als Ausländer. Über den Erdball werden die literarische Grundhaltungen immer homogener."
Tim Parks kann den Überschwang nicht teilen, mit dem sich Aleksandar Hemon in seiner Anthologie "Best European Fiction 2010" und Edith Grossman in ihrer Schrift "Why Translation Matters" für die Übersetzung internationaler Literatur stark machen. Er stichelt gegen diese Form des literarischen Antiimperialismus, weist darauf hin, dass auch in Deutschland vor allem amerikanische Genreromane übersetzt werden und sieht im Ergebnis die Literatur eintöniger werden: "Jeder Schriftsteller wendet sich vertrauensvoll an eine internationale liberale Leserschaft auf Kosten der provinziellen Bigotterie und Heuchelei. Dies trifft umso mehr zu, wenn an die Stelle des Humors direkte Denunziation tritt: Der polnische Autor Michal Witkowski berichtet vom Schicksal eines slowakischen Strichers in Wien, der Kroate Neven Usumovic erzählt von einem illegalen Immigranten in Budapest, der von einheimischen Jugendlichen gefoltert und einem Chinesen gerettet wird. Es ist, als würde die Literatur nicht so sehr andere Kulturen reflektieren und uns zwingen, in das Exotische einzutauchen, als vielmehr Berichte von Unzulänglichkeiten und Ungerechtigkeiten an eine internationale Gemeinschaft zu übermitteln, auf deren Mitgefühl man sich verlassen kann. Diese Autoren scheinen eher ausgezeichnete Auslandskorrespondenten zu sein als Ausländer. Über den Erdball werden die literarische Grundhaltungen immer homogener."Mit Grauen hat Ian Buruma die Verwandlung seines alten Freundes Christopher Hitchens von einem trotzkistischen Vietnamkriegsgegner in einen neokonservativen Irakkriegsbefürworter und Gegner von Religionen jeder Art beobachtet. An den Erinnerungen "Hitch 22" stört Buruma aber vor allem Hitchens Hang zu Extremen: "Politiker und Menschen, mit denen Hitchens nicht einverstanden ist, werden nie einfach nur mit Namen genannt, es geht immer um den 'gewohnheitsmäßigen und professionellen Lügner Clinton', 'den frömmelnden Wiedergeburtswiderling Jimmy Carter', Nixons 'unbeschreiblich verabscheuungswürdigen Henry Kissinger, der Untermenschen-Charakter Videla', und so weiter. Dies legt nahe, dass für Hitchens Politik ihrem Wesen nach eine Sache des Charakters ist. Politiker tun schlechte Dinge, weil sie schlechte Menschen sind. Die Vorstellung, dass gute Menschen schreckliche Dinge (selbst aus guten Gründen) tun können, und schlechte Menschen gute Dinge, kommt in diesem speziellen Moraluniversum nicht vor."
Polityka (Polen), 23.06.2010
 Vor zwei Wochen erklärte der Schriftsteller Andrzej Stasiuk in Przekroj, warum ihn der Präsidentschaftswahlkampf in Polen nicht die Bohne interessiert (Salon hat das Interview inzwischen ins Englische übersetzt). Er schüttelte sogar noch den Kopf über seine Mutter, die sich plötzlich für Politik interessiere. Die meisten Polen sehen es wohl wie Madame Stasiuk, berichtet Janina Paradowska (hier auf Deutsch): "Obwohl vorher Stimmen laut geworden waren, dies sei ein uninteressanter und langweiliger Wahlkampf, sind die Polen an die Wahlurnen gegangen, für polnische Verhältnisse beinahe massenweise. Eine Wahlbeteiligung von 55 Prozent in der ersten Runde ist praktisch noch nie vorgekommen. Dies ist eine der größeren Überraschungen bei dieser Wahl, und gleichzeitig ein Beweis für den Instinkt der Bürger dafür, dass diese Wahlen sehr wichtig sind, vielleicht die wichtigsten seit Jahren, dass - auch wenn sich die Kandidaten vor der ersten Runde vielleicht allzu sehr angeähnelt haben - sie dennoch für prinzipiell unterschiedliche politische Lager stehen."
Vor zwei Wochen erklärte der Schriftsteller Andrzej Stasiuk in Przekroj, warum ihn der Präsidentschaftswahlkampf in Polen nicht die Bohne interessiert (Salon hat das Interview inzwischen ins Englische übersetzt). Er schüttelte sogar noch den Kopf über seine Mutter, die sich plötzlich für Politik interessiere. Die meisten Polen sehen es wohl wie Madame Stasiuk, berichtet Janina Paradowska (hier auf Deutsch): "Obwohl vorher Stimmen laut geworden waren, dies sei ein uninteressanter und langweiliger Wahlkampf, sind die Polen an die Wahlurnen gegangen, für polnische Verhältnisse beinahe massenweise. Eine Wahlbeteiligung von 55 Prozent in der ersten Runde ist praktisch noch nie vorgekommen. Dies ist eine der größeren Überraschungen bei dieser Wahl, und gleichzeitig ein Beweis für den Instinkt der Bürger dafür, dass diese Wahlen sehr wichtig sind, vielleicht die wichtigsten seit Jahren, dass - auch wenn sich die Kandidaten vor der ersten Runde vielleicht allzu sehr angeähnelt haben - sie dennoch für prinzipiell unterschiedliche politische Lager stehen."Magyar Narancs (Ungarn), 17.06.2010
 In Island arbeitet man gerade an einem Gesetz, das der Presse eine Art Freihafen sichern soll. In Ungarn passiert genau das Gegenteil, so Miklos Haraszti im Interview über die Änderung des ungarischen Mediengesetzes. Auf die Frage, ob man sich jetzt überhaupt noch gegen staatlichen Einfluss wehren kann, antwortet Haraszti: "Das kommt allein auf die Presse an. ... Als in der Slowakei das neue Wahlrecht auf den Weg gebracht wurde, protestierten die Zeitungen mit leeren Titelseiten dagegen, auch in Italien und sogar in Kirgisistan taten sich die Journalisten zusammen. Die Empörung der attackierten Presse und des Internets, des unterdrückten Rundfunks und Fernsehens, der gedemütigten öffentlich-rechtlichen Medien und des für einen Trottel gehaltenen Publikums ist eine enorme Macht - und eine enorme moralische Kraft, wenn man sich an deren Spitze stellt."
In Island arbeitet man gerade an einem Gesetz, das der Presse eine Art Freihafen sichern soll. In Ungarn passiert genau das Gegenteil, so Miklos Haraszti im Interview über die Änderung des ungarischen Mediengesetzes. Auf die Frage, ob man sich jetzt überhaupt noch gegen staatlichen Einfluss wehren kann, antwortet Haraszti: "Das kommt allein auf die Presse an. ... Als in der Slowakei das neue Wahlrecht auf den Weg gebracht wurde, protestierten die Zeitungen mit leeren Titelseiten dagegen, auch in Italien und sogar in Kirgisistan taten sich die Journalisten zusammen. Die Empörung der attackierten Presse und des Internets, des unterdrückten Rundfunks und Fernsehens, der gedemütigten öffentlich-rechtlichen Medien und des für einen Trottel gehaltenen Publikums ist eine enorme Macht - und eine enorme moralische Kraft, wenn man sich an deren Spitze stellt."Rue89 (Frankreich), 27.06.2010
 "Der Leser entscheidet über die Unabhängigkeit einer Zeitung" und nicht ihre mehr oder weniger potenten Besitzer, meint der Medienhistoriker Patrick Eveno in einem Interview zur bevorstehenden Übernahme von Le Monde durch ein Bieterkonsortium. Darin geht er auch auf Spezifika der französischen Presselandschaft, die auf den Zweiten Weltkrieg zurückgehen, als man die Zeitungen politischen Gruppen übergab und dafür sorgte, dass sie mit staatlichem statt mit privatem Geld überlebten. Als Beispiel für seine These führt Eveno den Figaro an, der zwischen 1924 und 1934 achtzig Prozent seiner Leser verloren hatte. "Das finde ich großartig, weil es zeigt, dass nicht der Aktionär die Unabhängigkeit einer Zeitung sichert, sondern der Leser. Wenn die Öffentlichkeit eine unabhängige Zeitung will, kauft sie sie, wenn sie sie nicht mehr will, kauft sie sie nicht mehr... Ich denke, die Unabhängigkeit ist [für Franzosen] eine bizarre Vorstellung, weil sie dem Kapital misstrauen. In Frankreich glaubt man immer, dass das Kapital stets das Redaktionelle bestimmt. Man sollte zunächst einmal zeigen, dass es das Redaktionelle ist, das die Macht einer Zeitung bestimmt. Seinen Job als Journalist gut zu machen - damit macht man sich nicht nur Freunde... Das verbürgt Unabhängigkeit."
"Der Leser entscheidet über die Unabhängigkeit einer Zeitung" und nicht ihre mehr oder weniger potenten Besitzer, meint der Medienhistoriker Patrick Eveno in einem Interview zur bevorstehenden Übernahme von Le Monde durch ein Bieterkonsortium. Darin geht er auch auf Spezifika der französischen Presselandschaft, die auf den Zweiten Weltkrieg zurückgehen, als man die Zeitungen politischen Gruppen übergab und dafür sorgte, dass sie mit staatlichem statt mit privatem Geld überlebten. Als Beispiel für seine These führt Eveno den Figaro an, der zwischen 1924 und 1934 achtzig Prozent seiner Leser verloren hatte. "Das finde ich großartig, weil es zeigt, dass nicht der Aktionär die Unabhängigkeit einer Zeitung sichert, sondern der Leser. Wenn die Öffentlichkeit eine unabhängige Zeitung will, kauft sie sie, wenn sie sie nicht mehr will, kauft sie sie nicht mehr... Ich denke, die Unabhängigkeit ist [für Franzosen] eine bizarre Vorstellung, weil sie dem Kapital misstrauen. In Frankreich glaubt man immer, dass das Kapital stets das Redaktionelle bestimmt. Man sollte zunächst einmal zeigen, dass es das Redaktionelle ist, das die Macht einer Zeitung bestimmt. Seinen Job als Journalist gut zu machen - damit macht man sich nicht nur Freunde... Das verbürgt Unabhängigkeit." El Pais Semanal (Spanien), 27.06.2010
Javier Cercas denkt über mögliche Unterschiede zwischen separatistischem und gesamtstaatlichem Nationalismus nach: "Katalanischer Nationalismus, baskischer Nationalismus, spanischer Nationalismus: Im Grunde sind sie alle gleichermaßen überzeugt davon, am siebten Tag der Schöpfung habe Gott keineswegs geruht, sondern ihre - katalanische, baskische, spanische - Nation erschaffen. Was allerdings den Unterschied zwischen den verschiedenen Spielarten von Nationalismus in der Praxis angeht: Wenn ein separatistischer Nationalismus aus dem Ruder läuft, lässt er eine Terroristengruppe auf die anderen los; läuft ein gesamtstaatlicher Nationalismus aus dem Ruder, bringt er das halbe Land um, wie einst hier in Spanien geschehen, oder den halben Kontinent, wie einst der deutsche Nationalismus. Bekämpfen lässt sich der Nationalismus in jedem Fall nicht mit einem entgegengesetzten Nationalismus, sondern bloß so, wie jeder irrationale Glauben: Mit der Vernunft. Und die sieht zuallererst einmal den Balken im eigenen nationalistischen Auge."
Das Magazin (Schweiz), 26.06.2010
 Miklos Gimes schickt eine umfassende Reportage aus Ungarn. Auf seiner Reise sieht er fast nur Lähmung und Identitätskrise. Und die Politiker mit denen er spricht, tragen ihren Teil dazu bei: Vizepräsident und Jobbik-Vorsitzender Elöd Novak ("Um den Holocaust wird zu viel Aufhebens gemacht") will sich erst mal der "Zigeunerfrage" annehmen, Orbanberater Zoltan Balogh spricht über Pläne, Wiederholungsstraftäter beim dritten Mal lebenslänglich ins Gefängnis zu stecken - ("Aber zuerst stecken wir mal ein paar Sozis ins Gefängnis") und der desillusionierte Sozialist Ferenc Gyurcsany ("Kein Land in Europa hat solche Scheiße gebaut wie wir. Wir haben die letzten anderthalb Jahre nur gelogen") liest Sozialpsychologie-Bücher, um sich die Niederlage zu erklären und sich auf "acht bis zehn Jahre Opposition" einzustellen. Die derzeitigen Zustände erinnern Gimes an die vierziger Jahre: "Abgründe werden auf einmal sichtbar, die ich vorher nicht wahrgenommen habe, als hätte das Eis des Kalten Krieges sie zugedeckt. Roma werden in ungarischen Dörfern angegriffen. Erschossen, meist im Schlaf. Und am Fernsehen sieht man Männer, die in schwarzen Uniformen durch die Strassen marschieren, wie einst die ungarischen Nazis, als sie die Roma deportierten. Man sieht, wie ein bekannter jüdischer Journalist an einer Kundgebung vor dem Parlament angepöbelt wird. 'Hängt ihn auf!', rufen die Leute, 'in den Güterwagen mit ihm!', schreit eine ältere Frau in die Fernsehkameras."
Miklos Gimes schickt eine umfassende Reportage aus Ungarn. Auf seiner Reise sieht er fast nur Lähmung und Identitätskrise. Und die Politiker mit denen er spricht, tragen ihren Teil dazu bei: Vizepräsident und Jobbik-Vorsitzender Elöd Novak ("Um den Holocaust wird zu viel Aufhebens gemacht") will sich erst mal der "Zigeunerfrage" annehmen, Orbanberater Zoltan Balogh spricht über Pläne, Wiederholungsstraftäter beim dritten Mal lebenslänglich ins Gefängnis zu stecken - ("Aber zuerst stecken wir mal ein paar Sozis ins Gefängnis") und der desillusionierte Sozialist Ferenc Gyurcsany ("Kein Land in Europa hat solche Scheiße gebaut wie wir. Wir haben die letzten anderthalb Jahre nur gelogen") liest Sozialpsychologie-Bücher, um sich die Niederlage zu erklären und sich auf "acht bis zehn Jahre Opposition" einzustellen. Die derzeitigen Zustände erinnern Gimes an die vierziger Jahre: "Abgründe werden auf einmal sichtbar, die ich vorher nicht wahrgenommen habe, als hätte das Eis des Kalten Krieges sie zugedeckt. Roma werden in ungarischen Dörfern angegriffen. Erschossen, meist im Schlaf. Und am Fernsehen sieht man Männer, die in schwarzen Uniformen durch die Strassen marschieren, wie einst die ungarischen Nazis, als sie die Roma deportierten. Man sieht, wie ein bekannter jüdischer Journalist an einer Kundgebung vor dem Parlament angepöbelt wird. 'Hängt ihn auf!', rufen die Leute, 'in den Güterwagen mit ihm!', schreit eine ältere Frau in die Fernsehkameras."Open Democracy (UK), 26.06.2010
 In einer schwindelerregenden Kaskade von Fragen erklärt die Wissenschaftshistorikerin Lisbet Rausing ihre Sorgen über die Zukunft der Bibliothek in einem Zeitalter, in dem 80 Prozent der amerikanischen College-Studenten Google konsultieren, bevor sie sich ihrem Universitätskatalog zuwenden: "Wie die Open-Web-Bewegung behauptet, haben sich eine alte Tradition und eine neue Technologie zusammengetan, um ein beispielloses öffentliches Gut zu schaffen. 'Neue Technologie' bedeutet, dass sie die Kosten für elektronische Kopien gegen Null senkt, und dass sie eine glorios chaotische Mittlerrolle einnimmt. Denken Sie nur an Kindle / Amazon, Google Books, die Espresso Maschine oder die Ebooks von Mills & Boon. Aber die Rolle, die die 'alte Tradition' in diesem Arrangement spielt, wird viel weniger diskutiert. Wissenschaftler publizieren ohne Honorar, um des Wissens willen. Ihre Belohnung ist die Aufmerksamkeit ihrer Kollegen und soziale Nützlichkeit. In der Praxis ist die Aufmerksamkeit der Kollegen am wichtigsten. Die meisten Wissenschaftler interessieren sich kaum für ein breiteres Publikum. Das spielt eine Rolle. Denn Wissenschaftler verwalten Archive und Bibliotheken und sie tun das in ihrem Sinne. Diese Institutionen sind hervorragend im Sammeln, aber die Wahrheit ist, dass ihre Wächter den Zugang vor allem ihren, nun ja, Kollegen garantieren."
In einer schwindelerregenden Kaskade von Fragen erklärt die Wissenschaftshistorikerin Lisbet Rausing ihre Sorgen über die Zukunft der Bibliothek in einem Zeitalter, in dem 80 Prozent der amerikanischen College-Studenten Google konsultieren, bevor sie sich ihrem Universitätskatalog zuwenden: "Wie die Open-Web-Bewegung behauptet, haben sich eine alte Tradition und eine neue Technologie zusammengetan, um ein beispielloses öffentliches Gut zu schaffen. 'Neue Technologie' bedeutet, dass sie die Kosten für elektronische Kopien gegen Null senkt, und dass sie eine glorios chaotische Mittlerrolle einnimmt. Denken Sie nur an Kindle / Amazon, Google Books, die Espresso Maschine oder die Ebooks von Mills & Boon. Aber die Rolle, die die 'alte Tradition' in diesem Arrangement spielt, wird viel weniger diskutiert. Wissenschaftler publizieren ohne Honorar, um des Wissens willen. Ihre Belohnung ist die Aufmerksamkeit ihrer Kollegen und soziale Nützlichkeit. In der Praxis ist die Aufmerksamkeit der Kollegen am wichtigsten. Die meisten Wissenschaftler interessieren sich kaum für ein breiteres Publikum. Das spielt eine Rolle. Denn Wissenschaftler verwalten Archive und Bibliotheken und sie tun das in ihrem Sinne. Diese Institutionen sind hervorragend im Sammeln, aber die Wahrheit ist, dass ihre Wächter den Zugang vor allem ihren, nun ja, Kollegen garantieren."Außerdem: Cas Mudde erklärt den Allochthonen das Geert-Wilders-Phänomen. "Der einzige Punkt, an dem Geert Wilders sich wirklich von den anderen Parteien abhebt, ist seine Islamophobie. Wie auch immer, es ist nicht so sehr die Meinung an sich, die viele Niederländer teilen (vor allem bei den Rechten), sondern ihre Intensität. Wilders, der seit Jahren 24 Stunden am Tag bewacht wird, hat einen Tunnelblick entwickelt, in dem alles mit dem Islam verknüpft ist und Dschihadisten alles tun können, was sie wollen."
Merkur (Deutschland), 29.06.2010
 Der Soziologe Walter Hollstein setzt an, den Mann zu rehabilitieren, der bei Albert Camus oder Georg Simmel noch Qualitäten wie Mut, Fürsorge und Willenskraft aufbrachte, heute dagegen nur noch für Macht, Gewalt und Missbrauch steht. Dabei lastet Hollstein die Abwertung der Männlichkeit nur zum Teil dem Feminismus an. "Die Machtdebatte in der Gesellschaft bestimmt die öffentliche Diskussion dermaßen, dass darüber andere Tatbestände in Vergessenheit geraten. Dass Männer in vielen Rechtsbereichen wie dem Scheidungs-, Sorge- und Unterhaltsrecht diskriminiert werden, wird ebenso wenig in den breiten öffentlichen Diskurs aufgenommen wie geschlechtsspezifische Einseitigkeiten beim Militärdienst, bei der Altersversorgung oder dem Arbeitsschutz, um nur wieder wenige Bereiche beispielhaft zu benennen. So sehr Männer noch immer an der oberen Spitze der sozialen Pyramide überrepräsentiert sind, so sehr sind sie es auch am unteren Ende. Das Gros der Arbeitslosen, Hilfsarbeiter, Obdachlosen oder chronisch Kranken ist männlich, ohne dass jemand dies zum Anlass nähme, darin eine gesellschaftliche Ungerechtigkeit zu sehen."
Der Soziologe Walter Hollstein setzt an, den Mann zu rehabilitieren, der bei Albert Camus oder Georg Simmel noch Qualitäten wie Mut, Fürsorge und Willenskraft aufbrachte, heute dagegen nur noch für Macht, Gewalt und Missbrauch steht. Dabei lastet Hollstein die Abwertung der Männlichkeit nur zum Teil dem Feminismus an. "Die Machtdebatte in der Gesellschaft bestimmt die öffentliche Diskussion dermaßen, dass darüber andere Tatbestände in Vergessenheit geraten. Dass Männer in vielen Rechtsbereichen wie dem Scheidungs-, Sorge- und Unterhaltsrecht diskriminiert werden, wird ebenso wenig in den breiten öffentlichen Diskurs aufgenommen wie geschlechtsspezifische Einseitigkeiten beim Militärdienst, bei der Altersversorgung oder dem Arbeitsschutz, um nur wieder wenige Bereiche beispielhaft zu benennen. So sehr Männer noch immer an der oberen Spitze der sozialen Pyramide überrepräsentiert sind, so sehr sind sie es auch am unteren Ende. Das Gros der Arbeitslosen, Hilfsarbeiter, Obdachlosen oder chronisch Kranken ist männlich, ohne dass jemand dies zum Anlass nähme, darin eine gesellschaftliche Ungerechtigkeit zu sehen."Außerdem: Anlässlich des Missbrauchs in "Erziehungsanstalten" erinnert der Sozialpsychologe Ulrich Oevermann in einem sehr lehrreichen Text, welche Bedeutung der Familie bei der Entwicklung einer erwachsenen Sexualität zukommt (jedes Zitat würde allerdings die Komplexität dieses Textes reduzieren, allein die "Pubertät" heißt bei Oevermann "Phase der Adoleszenzkrisenbewältigung"!). Karl Heinz Bohrer fragt nach der Macht der Philosophie. Und Stefan Willer huldigt dem Stimmenbeschwörer Georg Klein.
Prospect (UK), 22.06.2010
Evgeni Morozov (Blog) bespricht die Buchfassung von Nicholas Carrs berüchtigtem "Macht Google uns blöd?"-Artikel, Titel: "The Shallows" (dt. "Die Flachgebiete"). Zwar findet er viele Befürchtungen Carrs, dass die technischen Neuerungen des Internetzeitalters uns neurologisch deformieren, eher kurzschlüssig und deterministisch. Probleme aber sieht auch Morozov in aktuellen Tendenzen des Mitmachnetzes, er zählt etwa auf: "die Erosion von Privatheit; der Triumph des kollektiven Geists über das Invidiuum; die um sich greifende Personalisierung und Anpassung des Netzes an den jeweiligen Nutzer, die Förderung des Narzissmus und die sich verschlimmernde Abhängigkeit von der Technologie". Und auch einen weiteren Punkt hält er für oft übersehen: "Es ist nicht klar, wie die Leute in einem solchen, auf sie zugeschnittenen kollektivistischen Umfeld noch unabhängigen Geschmack entwickeln sollen. Film- und Restaurantkritik werden bereits von automatisierten Einzeilen-Besprechungen aus dem Internet beiseite gedrängt. Die anspruchsvolle Literaturkritik scheint sich gerade zu verabschieden - was bleiben, sind die anonymen Kritiker bei Amazon. Überhaupt hat man die Auswirkungen des Internets auf Kritiker und Intellektuelle bisher wenig erforscht - dabei haben solche Fragen weitreichende Folgen für das soziale und das politische Leben."
Kommentieren