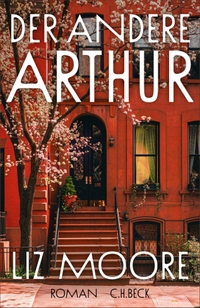Virtualienmarkt
Das Paradox des Online-Journalismus
Von Robin Meyer-Lucht
10.09.2008. Nachrichtensites feiern sich für hohe Leserzahlen - doch tatsächlich haben sie nicht ein Nutzungsproblem, sondern auch eines mit der geringen Loyalität ihrer Leser. Welt Online löst dies auf wenig erquickliche Weise.In verworrenen Momenten ist es ebenso angemessen wie erleichternd, einen erklärenden graden Strich durch das Chaos zu ziehen - etwa in Form eines einprägsamen Gegensatzpaares. Dergleichen tat kürzlich Russ Stanton, Chefredakteur der Los Angeles Times, als er das "Paradox" des Online-Journalismus erfand. Doch leider blendet diese mittlerweile sehr populäre Denkfigur zentrale Aspekte der Journalismus-Entwicklung im Netz aus.
Anfang Juli schrieb Stanton in einer E-Mail an seine Redakteure: "You all know the paradox we find ourselves in: Thanks to the Internet, we have more readers for our great journalism than at any time in our history. But also thanks to the Internet, our advertisers have more choices, and we have less money."
Glaubt man Stanton, dann hat die obskure Schwindsucht des Journalismus im Internet viel mit Anzeigenkunden und nichts mit dem Journalismus selbst zu tun: Der Wettbewerb um Anzeigengelder lasse die Einnahmen schrumpfen, während man so viele Leser habe wie noch nie. Während die Sache mit den Anzeigenkunden leider zutrifft, ist die Darstellung der Leserzahl ein glatter Selbstbetrug in eigener Sache.
Die Website der Los Angeles Times erreicht zwar mittlerweile 19 Millionen Nutzer pro Monat ("unique user"). Diese Zahl kann jedoch nicht, wie Stanton es tut, mit den 2,1 Millionen Lesern der Zeitung verglichen werden. Denn die Zeitungsleserschaft wird in "Leser pro Tag" gemessen. Methodisch sind beide Werte völlig inkompatibel.
Betrachtet man die Online-Abrufdaten genauer, zeigt sich wie grob vereinfachend Stantons Betrachtungsweise ist. Die 19 Millionen Unique User rufen auf Latimes.com rund 125 Millionen Seiten pro Monat ab. Dies entspricht pro Nutzer 6,6 abgerufenen Seiten pro Monat. Setzt man pro Seitenabruf realistischerweise einen Schnitt von 15 Sekunden an, erhält man eine durchschnittliche Aufenthaltsdauer pro Nutzer und Monat von knapp zwei Minuten. Taxiert man auf der Print-Seite eine durchschnittliche Nutzungsdauer von 20 Minuten pro Leser, so entfallen auf die Print-Ausgabe noch immer 30 Mal mehr Nutzungsminuten als auf die Online-Variante.
Die Los Angeles Times mag also viele Leser im Netz haben. Die allermeisten von ihnen jedoch haben keine intensive Bindung an die Seite und nutzen sie eher kursorisch. Das gleiche Problem gibt es auch in Deutschland. Die Researchagentur Nielsen Netratings misst hierzulande regelmäßig durchschnittliche Aufenthaltsdauern pro Nutzer für die Sites der überregionalen Qualitätspresse von unter zehn Minuten pro Monat. Spiegel Online erreicht rund 35 Minuten pro Monat - auch dies stellt keine Antithese zu dem Phänomen dar.
Stanton verschleiert mit seinem Paradox ein zentrales Problem des klassischen Online-Journalismus: die geringe Nutzungsintensität und -loyalität durch seine Leser. Nicht nur die Anzeigenkunden freuen sich über die neue Auswahl im Netz, auch die Leser machen ausgiebig Gebrauch von ihr. Sie finden folglich viel kürzer und mit spezifischeren Fragestellungen zu ihrer Zeitungswebsite.
Anders herum: Pro Nutzungsminute ist der Umsatz auf Zeitungswebsites höchstwahrscheinlich in vielen Fällen bereits beachtlich und wird an die Print-Umsätze pro Nutzungsminute heranreichen. So betrachtet haben Zeitungswebsites ein eher kleines Problem im Anzeigenmarkt und ein sehr viel größeres mit ihren Nutzern.
Doch die Erkenntnis vom Nutzungsproblem setzt sich nur langsam durch. Insbesondere die in den USA gängigen Angaben zur Besucherzahl pro Monat sind irreführend. So dufte der Journalismusbeobachter Tom Rosenstiel kürzlich auch im Interview mit der Süddeutschen Zeitung behaupten, dass das Publikum von Zeitungswebsites so groß wie noch nie sei, es keine Abkehr vom klassischen Journalismus im Netz gäbe und das Internet irgendwie mit seinem Publikum ökonomisch nicht mitwachse. Leider kann man all dem nicht zustimmen.
Ein Problem der Netzentwicklung ist: Es gibt zu wenige Mechanismen der gesellschaftlichen Selbstvergewisserung seiner Nutzung. Es fehlt das Online-Pendant zu einem realen Kiosk, bei dem man sieht, wie viele Exemplare welcher Publikation über den Ladentisch gehen.
Unterdessen hat der Axel-Springer-Verlag seine ganz eigene Antwort auf die enttäuschende Nutzerloyalität im Online-Journalismus gefunden. Bei Welt Online wird munter an der Suchmaschinenschraube gedreht, damit Nutzer auf die Seite gespült werden (mehr hier). Gerade zu Beginn des Jahres wirkte Google News häufig wie eine Werbetafel für Welt Online (Screenshot). Axel Springer reagierte damit schneller, effektiver und aggressiver als alle anderen Medienhäuser auf die maue Nutzerbindung. Zugleich verschob sich der eigentlich journalistische Wettbewerb auf die unschöne Schiene grenzwertiger Suchmaschinen-Bespiegelung.
Hatte man gehofft, die gröbsten Auswüchse in dieser technikgetriebenen Reichweitenjagd seien schon wieder Geschichte, wird man nun eines Besseren belehrt: Der Blogger Frank Helmschrott dokumentiert, dass Welt Online inzwischen ganze Seiten als Anzeige auf dubiosen Websites ausliefert, um so seine Reichweite weiter zu befeuern (mehr hier). Der Axel Springer Verlag bestätigt die Schaltung gegenüber dem Perlentaucher und verweist auf vergleichbare Praktiken anderer Medienhäuser. Da möchte man die Frage, wie hoch eigentlich die Reichweite von "Qualitätsnachrichtensites" ist, wenn man diese und andere Maßnahmen abzieht, kaum noch stellen. Das Loyalitäts- und Wachstumsproblem der Qualitätspresse im Netz ist größer als dies im öffentlichen Bewusstsein der Fall ist. Während die Nutzung des Internets weiter steil wächst und zunehmend neue Massen- Nischenanbieter prosperieren, vermögen viele Zeitungswebsites nicht in vergleichbaren Maße mitzuwachsen. Sie stehen wie altbackene Warenhäuser oder etwas fettig riechende Kantinen in einem sich rasant entwickelnden Umfeld. Sie haben damit ein Qualitätsproblem nicht nur in den Augen ihrer professionellen Kritiker, sondern vor allem auch in den Augen ihrer Nutzer.
Das Hauptproblem ist dabei hierzulande, dass die Verlage noch immer nicht wahrhaben wollen, dass sie keine Zukunft jenseits des Internets haben. In den USA erleben die Zeitungen derzeit das schlechteste Jahr ihrer Geschichte. Zum Zeitungssterben gibt es inzwischen sogar ein Blog. Entscheidend ist hier ein prägnanter Satz, den Rosenstiel der Süddeutschen Zeitung auch noch sagte: Das Internet sei letztlich das "eindeutig überlegene Medium" für die Verbreitung von Journalismus. Diesen - derzeit sicher noch typisch amerikanischen - Standpunkt sollte man sich merken. Und Russ Stantons Paradox schleunigst wieder vergessen.
Anfang Juli schrieb Stanton in einer E-Mail an seine Redakteure: "You all know the paradox we find ourselves in: Thanks to the Internet, we have more readers for our great journalism than at any time in our history. But also thanks to the Internet, our advertisers have more choices, and we have less money."
Glaubt man Stanton, dann hat die obskure Schwindsucht des Journalismus im Internet viel mit Anzeigenkunden und nichts mit dem Journalismus selbst zu tun: Der Wettbewerb um Anzeigengelder lasse die Einnahmen schrumpfen, während man so viele Leser habe wie noch nie. Während die Sache mit den Anzeigenkunden leider zutrifft, ist die Darstellung der Leserzahl ein glatter Selbstbetrug in eigener Sache.
Die Website der Los Angeles Times erreicht zwar mittlerweile 19 Millionen Nutzer pro Monat ("unique user"). Diese Zahl kann jedoch nicht, wie Stanton es tut, mit den 2,1 Millionen Lesern der Zeitung verglichen werden. Denn die Zeitungsleserschaft wird in "Leser pro Tag" gemessen. Methodisch sind beide Werte völlig inkompatibel.
Betrachtet man die Online-Abrufdaten genauer, zeigt sich wie grob vereinfachend Stantons Betrachtungsweise ist. Die 19 Millionen Unique User rufen auf Latimes.com rund 125 Millionen Seiten pro Monat ab. Dies entspricht pro Nutzer 6,6 abgerufenen Seiten pro Monat. Setzt man pro Seitenabruf realistischerweise einen Schnitt von 15 Sekunden an, erhält man eine durchschnittliche Aufenthaltsdauer pro Nutzer und Monat von knapp zwei Minuten. Taxiert man auf der Print-Seite eine durchschnittliche Nutzungsdauer von 20 Minuten pro Leser, so entfallen auf die Print-Ausgabe noch immer 30 Mal mehr Nutzungsminuten als auf die Online-Variante.
Die Los Angeles Times mag also viele Leser im Netz haben. Die allermeisten von ihnen jedoch haben keine intensive Bindung an die Seite und nutzen sie eher kursorisch. Das gleiche Problem gibt es auch in Deutschland. Die Researchagentur Nielsen Netratings misst hierzulande regelmäßig durchschnittliche Aufenthaltsdauern pro Nutzer für die Sites der überregionalen Qualitätspresse von unter zehn Minuten pro Monat. Spiegel Online erreicht rund 35 Minuten pro Monat - auch dies stellt keine Antithese zu dem Phänomen dar.
Stanton verschleiert mit seinem Paradox ein zentrales Problem des klassischen Online-Journalismus: die geringe Nutzungsintensität und -loyalität durch seine Leser. Nicht nur die Anzeigenkunden freuen sich über die neue Auswahl im Netz, auch die Leser machen ausgiebig Gebrauch von ihr. Sie finden folglich viel kürzer und mit spezifischeren Fragestellungen zu ihrer Zeitungswebsite.
Anders herum: Pro Nutzungsminute ist der Umsatz auf Zeitungswebsites höchstwahrscheinlich in vielen Fällen bereits beachtlich und wird an die Print-Umsätze pro Nutzungsminute heranreichen. So betrachtet haben Zeitungswebsites ein eher kleines Problem im Anzeigenmarkt und ein sehr viel größeres mit ihren Nutzern.
Doch die Erkenntnis vom Nutzungsproblem setzt sich nur langsam durch. Insbesondere die in den USA gängigen Angaben zur Besucherzahl pro Monat sind irreführend. So dufte der Journalismusbeobachter Tom Rosenstiel kürzlich auch im Interview mit der Süddeutschen Zeitung behaupten, dass das Publikum von Zeitungswebsites so groß wie noch nie sei, es keine Abkehr vom klassischen Journalismus im Netz gäbe und das Internet irgendwie mit seinem Publikum ökonomisch nicht mitwachse. Leider kann man all dem nicht zustimmen.
Ein Problem der Netzentwicklung ist: Es gibt zu wenige Mechanismen der gesellschaftlichen Selbstvergewisserung seiner Nutzung. Es fehlt das Online-Pendant zu einem realen Kiosk, bei dem man sieht, wie viele Exemplare welcher Publikation über den Ladentisch gehen.
Unterdessen hat der Axel-Springer-Verlag seine ganz eigene Antwort auf die enttäuschende Nutzerloyalität im Online-Journalismus gefunden. Bei Welt Online wird munter an der Suchmaschinenschraube gedreht, damit Nutzer auf die Seite gespült werden (mehr hier). Gerade zu Beginn des Jahres wirkte Google News häufig wie eine Werbetafel für Welt Online (Screenshot). Axel Springer reagierte damit schneller, effektiver und aggressiver als alle anderen Medienhäuser auf die maue Nutzerbindung. Zugleich verschob sich der eigentlich journalistische Wettbewerb auf die unschöne Schiene grenzwertiger Suchmaschinen-Bespiegelung.
Hatte man gehofft, die gröbsten Auswüchse in dieser technikgetriebenen Reichweitenjagd seien schon wieder Geschichte, wird man nun eines Besseren belehrt: Der Blogger Frank Helmschrott dokumentiert, dass Welt Online inzwischen ganze Seiten als Anzeige auf dubiosen Websites ausliefert, um so seine Reichweite weiter zu befeuern (mehr hier). Der Axel Springer Verlag bestätigt die Schaltung gegenüber dem Perlentaucher und verweist auf vergleichbare Praktiken anderer Medienhäuser. Da möchte man die Frage, wie hoch eigentlich die Reichweite von "Qualitätsnachrichtensites" ist, wenn man diese und andere Maßnahmen abzieht, kaum noch stellen. Das Loyalitäts- und Wachstumsproblem der Qualitätspresse im Netz ist größer als dies im öffentlichen Bewusstsein der Fall ist. Während die Nutzung des Internets weiter steil wächst und zunehmend neue Massen- Nischenanbieter prosperieren, vermögen viele Zeitungswebsites nicht in vergleichbaren Maße mitzuwachsen. Sie stehen wie altbackene Warenhäuser oder etwas fettig riechende Kantinen in einem sich rasant entwickelnden Umfeld. Sie haben damit ein Qualitätsproblem nicht nur in den Augen ihrer professionellen Kritiker, sondern vor allem auch in den Augen ihrer Nutzer.
Das Hauptproblem ist dabei hierzulande, dass die Verlage noch immer nicht wahrhaben wollen, dass sie keine Zukunft jenseits des Internets haben. In den USA erleben die Zeitungen derzeit das schlechteste Jahr ihrer Geschichte. Zum Zeitungssterben gibt es inzwischen sogar ein Blog. Entscheidend ist hier ein prägnanter Satz, den Rosenstiel der Süddeutschen Zeitung auch noch sagte: Das Internet sei letztlich das "eindeutig überlegene Medium" für die Verbreitung von Journalismus. Diesen - derzeit sicher noch typisch amerikanischen - Standpunkt sollte man sich merken. Und Russ Stantons Paradox schleunigst wieder vergessen.
Kommentieren