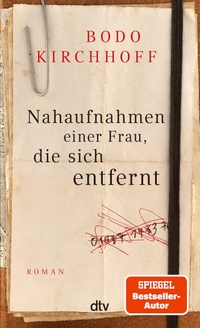Essay
Ich ging also zu Fellini
Pier Paolo Pasolini über Accattone Von Pier Paolo Pasolini
08.09.2009. "Wenn ich die Szene noch einmal drehen müsste - genau diese Frage stellt mir Fellini - ja, dann würde ich sie wieder mit genau diesem Rhythmus drehen: schnell, gehetzt, schludrig, hingeworfen." Ein unveröffentlichter Text von Pier Paolo Pasolini aus dem Jahr 1960.Wir präsentieren hier aus dem kommenden "Schreibheft" einen bewegenden, im Deutschen bisher unbekannten Text Pier Paolo Pasolinis über die Dreharbeiten zu seinem ersten Film "Accattone", über das Verhältnis zu seinem ersten Produzenten Federico Fellini und seinem Freund Bernardo Bertolucci, und über eine Verabredung mit Elsa Morante, die er dann fallen ließ. Auch über die Ästhetik seines ersten Films und arge Missverständnisse mit Fellini schreibt er: "Was gefällt Fellini eigentlich nicht? Die Armut, die Schlamperei, die Grobheit, das plump, fast anonym Schulmäßige meiner Art zu drehen." Wir danken dem Schreibheft, dessen Pasolini-Ausgabe am 18. September erscheint, für die Abdruckgenehmigung. (D.Red.)
Wie üblich bin ich spät aufgestanden, gegen elf. Ich weiß, dass heute ein, wie sagt man? entscheidender Tag ist. Die Angst bereitet mir körperliches Unwohlsein. Mein Herz klopft, mir dreht sich der Magen um. Im Gesicht spüre ich Schmerzen dort, wo das Alter sich einnistet: in der Stirn, den Wangenknochen unter den Augen, am Kopf hinter den Ohren.
Ich mache mich an die Arbeit. Wie ein Anfänger. Die Tatsache, dass ich ein Theaterstück wiederaufnehme, das ich 1944 geschrieben habe und das immer unvollständig geblieben ist, hat in diesem Moment eine besondere Bedeutung - ich weiß nicht, ob ich mich mit der Aufgabe trösten oder daran verzweifeln werde. Als ich es gestern erneut las, bin ich in einen Zustand nervöser Anspannung geraten, wie man ihn wohl nur kurz vor dem Nervenzusammenbruch erlebt. Die Ideen, die mir kamen, um das Stück zu korrigieren und fertigzustellen (sechzehn Jahre, nachdem es geschrieben wurde!) ließen mir keinen Augenblick Ruhe, sie liefen durch mein Inneres wie reißende Ströme, wie elektrische Entladungen. Aber sie hatten etwas Strahlendes, Berauschendes: die alte joy, die wiedererwachte. Gleichzeitig erschöpften sie mich auch, machten mich krank, als würde ich fiebern. Beim Abendessen im Pastarellaro mit Moravia, der Morante, Adriana Asti (die eine wichtige Rolle in dem Stück spielen soll), mit Parise, meiner Mutter und anderen Freunden, konnte ich nicht sprechen und fast nicht zuhören. Ich war ganz nach innen, diesen strahlenden Ideen zugekehrt, die mich von Kopf bis Fuß durchfuhren.
Ich schreibe, während meine Mama sich in der Wohnung zu schaffen macht. Sie kommt näher, sieht mich an. Ich spüre, dass sie mir etwas sagen muss. Schließlich sagt sie es, den Staublappen in der Hand: "Heute wäre Guidos Geburtstag ? Er wäre fünfunddreißig Jahre alt, stell dir das vor ?". Ich weiß nicht, was ich sagen soll, ich schweige und arbeite weiter. Dann tue ich etwas, was ich seit vielen Jahren fast mechanisch mache, ich nehme ihre Hand, ihre Mädchenhand, und küsse sie. Das Stück, das ich schreibe, ist voll von jenen Tagen, als Guido starb, von der Neurose, die ich dem Schmerz abgewonnen hatte, und mir scheint, als wären seither nicht sechzehn Jahre, sondern sechzehn Tage vergangen.
Da klingelt es an der Tür. Ein unbekannter junger Mann stellt sich vor, hochgewachsen, von schwer zu definierendem Aussehen. Er spricht unbeholfen, mit einem Gemisch unterschiedlicher Akzente. Tatsächlich erfahre ich kurz darauf - als ich mich ärgerlich von der Schreibmaschine losreiße - dass er Sizilianer ist, doch er kommt aus dem Norden, aus Casarsa ? Es ist Schicksal, dass dieses Casarsa sich so gewaltsam wieder aufdrängt, nachdem ich es zunächst durch eine in jeder Hinsicht erschöpfende Erfahrung für erledigt gehalten und dann vergessen und begraben hatte ? Der junge Mann möchte Schauspieler werden, er hat im Friaul vorgesprochen bei Bekannten, die ich dort oben habe. In Rom angekommen, wollte er sich in der Accademia d?Arte Dramatica einschreiben, doch die Frist war schon abgelaufen. Er bittet mich um einen Rat, eine Unterstützung ? Auch das wird versprochen. Er geht, diskret, ich bin wieder allein. Ich spüre diesen depressiven, lechzenden Geschmack der Langeweile, den ich seit Jahren nicht mehr spüre. Ja, seit Jahren habe ich sogar keine Langeweile mehr verspürt, das Gefühl, nicht zu wissen, was man tun soll oder zu nichts Lust zu haben. Eine schreckliche Angst trennt mich von allem wie eine Kupplung. Mein Herz schüttelt mich, es zuckt in meinen Rippen wie ein aus dem Takt geratenes Pendel. Ich weiß, dies ist kein guter Tag für mich, das gestrige Horoskop im Paese Sera hat es mir unmissverständlich angekündigt: "Entscheidungen, die Ihren Wünschen ziemlich entgegenstehen ?". Es ist mein einziger Aberglaube, natürlich von tausend unwiderlegbaren Beweisen bestätigt, und von fast allen meinen Freunden geteilt. Ich weiß also, dass es schlecht laufen wird, und diese Prophezeiung, dieses vorweggenommene Wissen, macht die Wirklichkeit, die sich aus anderen, weit genauer benennbaren Gründen um mich herum abzeichnet, noch beängstigender.
Um die Wahrheit zu sagen, hatte ich schon lange daran gedacht, einen Film zu machen. Eine Idee mit weit zurückliegenden Ursprüngen. Als Junge in Bologna liebte ich das Kino mindestens ebenso sehr wie Pietro Bianchi. Und im Abstand von vielen Jahren kann ich sagen, dass die Filme von Chaplin, von Dreyer und Eisenstein meinen Geschmack und meinen Stil im Grunde stärker beeinflusst haben als die gleichzeitigen literarischen Lehrjahre - abgesehen natürlich von den epischen Lektüren eines Jugendlichen, Shakespeare und Dostojewskij. In letzter Zeit hat es dann unmittelbare Gründe gegeben: eine Art launischer Unduldsamkeit gegenüber Regisseuren und Produzenten (La notte brava, Morte di un amico), den Wunsch, Geschehnisse, Personen, Szenen genau so umgesetzt zu sehen, wie ich sie beim Schreiben vor mir sehe. Dieser Trotz hat sich dann in eine echte Inspiration verwandelt, die mir in den letzten Monaten keine Ruhe mehr lässt.
Den Film "Accattone" sollte ich mit den Produzenten Cervi und Iacovoni machen. Anfang September sollte ich anfangen. Doch zu dem Zeitpunkt erschienen mir die beiden Produzenten plötzlich unsicher, zerstreut und abwesend, was allerdings nicht überraschend kam. Oder war ich derjenige, der ein schlechtes Gewissen hatte? Nicht ganz ungerechtfertigt, in Anbetracht meines, sagen wir, Zustands der Ungnade in der institutionellen und klerikalen Welt. Also wandte ich mich an Fellini. Der hatte im Sommer gerade mit Rizzoli die "Federiz" gegründet und mir mehrmals angeboten, meinen Film zusammen mit Fracassi zu produzieren. Er hatte sogar schon mit zwei jungen Männern von der "Ajace" Verhandlungen um eine Koproduktion geführt, freilich ohne Ergebnis. Bei meinem Vertrag mit Cervi und Iacovoni ging es jedoch um einen anderen Stoff, "La commare secca", den ich fallengelassen hatte. Ich hatte dafür keinen Vorschuss bekommen, darum war ich unabhängig. Der Sommer verstrich, meine Inspiration war, wie soll ich es ausdrücken, nicht verhandelbar. Ich ging also zu Fellini, der mich mit einer herzlichen Umarmung empfing. In jenen ersten Septembertagen richtete er gerade den neuen Sitz seiner Gesellschaft in der Via della Croce ein. Er tat das so begeistert und stolz wie ein kleiner Junge, natürlich auch mit ein wenig Koketterie. Wir umarmten uns und begannen mit der Arbeit.
Was dann folgte, waren die schönsten Tage meines Lebens, glaube ich. Fast alle meine Figuren waren versammelt, und ich ließ sie fotografieren, Dutzende Fotos. Von einem treuen Fotografen, den die Unschuld meiner Begeisterung mitriss, und von Bernardo, Bertoluccis Sohn, der ebenso mitgerissen war. Die Gesichter, die Körper, die Straßen, die Plätze, die Anhäufungen von Baracken, die Bruchstücke großer Palazzi, die schwarzen Wände der geborstenen Wolkenkratzer, den Schlamm, die Hecken, die mit Ziegelsteinen und Müll übersäten Wiesen der Vorstädte - all das zeigte sich in einem neuen, frischen, berauschenden Licht, es war ein unverfälschter und paradiesischer Anblick.

Accattone, Giorgio il Secco, der Scucchia, Alfredino, Peppe il Folle, der Sheriff, der Bassetto, der Gnaccia, dann das Pigneto-Viertel, die Via Formia, die Borgata Gordiani, die Straßen in Testaccio, die Frauen Maddalena, Ascensa, Stella, außerdem der Balilla und Cartagine - alle wurden mit prächtigen, ausgewählten Fotografien festgehalten. Immer frontal, als Vorderansicht, aber alles andere als stereotyp, aufgereiht in der Erwartung, sich bewegen, leben zu dürfen.
Dann habe ich auf Anraten Fellinis Probeaufnahmen gemacht, das heißt, ich habe zwei fast vollständige Szenen des Films gedreht.
Es waren herrliche Tage, der Sommer glühte noch in seiner ganzen Reinheit, nur im Inneren war ihm etwas von seiner Wut genommen. Die Via Fanfulla da Lodi mitten im Pigneto mit ihren kleinen Hütten, den bröckelnden Mäuerchen, besaß in ihrer unendlichen Armseligkeit eine körnige Erhabenheit. Ein armes, demütiges, unbekanntes Sträßchen, verloren unter der Sonne liegend, in einem Rom, das nicht Rom war.
Wir haben die Straße gefüllt: ein gutes Dutzend Schauspieler, der Kameramann, die Bühnenarbeiter, die Tontechniker. Doch da es keine "Gruppenbildung" gab - so etwas habe ich nie dulden wollen - herrschte bei dem Unternehmen eine friedliche Atmosphäre: Wir wirkten wie Arbeiter inmitten der anderen Arbeiter aus den kleinen Werkstätten im Pigneto.
Niemals hätte ich gedacht, dass die Regiearbeit so außergewöhnlich ist. Ich entschied mich für die schnellste und einfachste Form, um das darzustellen, was ich im Drehbuch geschrieben hatte. Kleine visuelle Blöcke, ordentlich, fast grob nebeneinander gesetzt. Ich hatte Dreyer im Kopf, aber in Wirklichkeit folgte ich einer Norm größter expressiver Schlichtheit. Es würde zu weit führen, ins Detail zu gehen: der Kampf mit dem Licht und seinem ständigen, hartnäckigen Wechsel, der Kampf mit der alten Filmkamera, der Kampf mit meinen Schauspielern aus Torpignattara, alle, wie ich, zum ersten Mal an einem Set. Doch es waren Kämpfe, die immer mit kleinen, tröstlichen Siegen endeten.
Während der drei Drehtage habe ich keine Nacht geschlafen. Wie in einem licht-erfüllten Alptraum dachte ich unablässig an den Film: Was mich im Abstand von wenigen Minuten jäh auffahren ließ, gleich kurzen angenehmen inneren Blutungen, die damit begannen, dass die Einstellungen einer Szene auftauchten, die ich am nächsten Tag drehen würde, oder ihre Fortsetzung oder die Einstellungen anderer Szenen, die mir nach und nach im Traum einfielen. Eine ganze Nacht habe ich, geblendet von der Sonne der Tiber-Badeanstalt Ciriola, unterhalb vom Castel Sant?Angelo verbracht, und da waren die Gesichter von Alfredino und Luciano, sie lachten, kniffen die Augen und die Fältchen um die Augen zusammen, wenn sie ihr schelmisches Lachen anstimmten, das mit seiner stoischen, antiken Fröhlichkeit alle Gesetze des Lebens aufhebt. Gesichter von Peonen, von Schiffsjungen auf der "Potemkin", von Mönchen.
Über die Mühen mit der Presse, mit dem Schneidetisch, dem Schnitt und den Tonspuren müsste man Memoiren schreiben, sie würden vor allem Nichteingeweihten nützen, wie ich einer war. Endlich waren die beiden Szenen fertig, und dieses Warten begann, ohne Anlass zum Zweifeln, aber dafür im Wissen, das es sich auf Nichts gründet, auf ein Schicksal ohne Zukunft, in dem sich nichts bewegt.
Ich langweile mich, spüre eine lechzende Langeweile vor diesen Seiten ohne Bedeutung. Und siehe da, wie erwartet, wie eine Bestätigung, klingelt das Telefon. Es ist Franco, der den Accattone spielen soll, die Hauptfigur. Schon seit einer Woche ruft er mich jeden Tag um diese Zeit an, vergeblich, und das weiß er. Hinter ihm sein Bruder Sergio, mein alter unersetzbarer Helfer, mein lebendes Lexikon des römischen Dialekts, und alle anderen - ihre Angst macht meine noch schlimmer. Ich weiß nicht, wie ich sie beruhigen soll, wie ich ihre wahrscheinliche Enttäuschung lindern soll. Gestern hat Fellini die Filmrolle mitgenommen und ist fortgegangen, um sich das Material allein anzusehen. Wir hätten es uns zusammen ansehen sollen, auch mit den Schauspielern, damit sie ein bisschen Mut schöpfen ? Erst danach hat Fellini mich angerufen, um mir davon zu erzählen. Im Grunde ist es verständlich und richtig, was er getan hat. Aber dann wieder Schweigen. Den ganzen Morgen lang habe ich auf einen Anruf gewartet, nichts. Also habe ich gegen Mittag angerufen und erfahren, dass Fellini und Fracassi zu einer Hochzeit gegangen sind.
Nun gut: Ich setze mich wieder an die Arbeit, an meine alte Storia interiore, die nicht mehr in Gang kommt.
Jetzt ruft mich Bernardo Bertolucci an, auch er ist in Nöten, sein Vater sei angekommen, sagt er. Also esse ich eilig und gehe in den fünften Stock hinauf. Bertolucci und ich wohnen im selben Haus hinter der Villa Sciarra.
Bertolucci ist allein mit dem ältesten Sohn. Seine Verwandten sind noch nicht zurück. Wir setzen uns in sein behagliches parmesanisches Wohnzimmer und beginnen mit einem unserer langen Gespräche, wie man sie unter Freunden führt. Obwohl ich so deprimiert und von den schlaflosen Nächten zermürbt bin. Auf seinem Nachttisch liegt Paragone mit zweien seiner Gedichte. Ich lese sie sofort: wie alle, die er zuletzt schrieb, sind sie großartig, herzzerreißend.
Dann reden wir von hunderterlei Dingen, von unseren Freunden, Literaten und Schriftstellern. Wir lästern ein wenig, aber das sind vollkommen unschuldige Bemerkungen, denn beide sind wir nicht fähig zu ernsthaften Bosheiten, wenn sie sich nicht auf ein zuvor gefasstes, durch und durch begründetes Werturteil stützen. Wir sprechen über mein Unglück, das ihn bedrückt und ängstigt, ich sehe es an der Bestürzung in seinen braunen Augen. Natürlich sprechen wir auch über meinen Film und über Fellini, der da ist wie eine ferne Pythia, die Urteil spricht. Bertolucci kommt aus seinem Parma, wo der Herbst schon begonnen hat (ich sehe es vor mir: mit den abgeernteten Weinbergen, der zum Po hin verschwimmenden Ebene, den vagen, kargen Hügeln und der fröhlichen Stimmung des Semesterbeginns, wenn elegante, in englische Stoffe gekleidete Studenten die Via Emilia bevölkern), und er empfindet die noch sommerliche Wärme in Rom als Frevel. Die Sonne glüht, erschöpft aber heiß, und ein schweißtreibender Schirokko weht.
Ich liebe diese Sonne. Außer dem Viertel, wo wir wohnen, kenne ich noch hundert andere, hoch und mit Türmen bewehrt wie die Stadt Dis, die in dieser blendenden Sonne liegen, darunter die schmutzigen Wiesen und mit Hütten übersäten Ebenen, die schwarzen Böschungen.
Ich halte es im Haus nicht mehr aus, umarme Attilio und gehe, um mir die nächste Wartezeit zu vertreiben, indem ich mich in meiner alten Einsamkeit verliere.
Wohin fahre ich? Um diese Zeit gibt es wenig Verkehr, träge lenke ich das Auto durch die warmen, gelben Straßen. Ja, ich werde einen Blick auf Acqua Santa werfen, seit über einem Jahr war ich nicht mehr dort, dabei ist es einer der angenehmsten, friedlichsten Orte Roms. Ich komme auf die Appia Nuova, lasse das Auto stehen und steige über ein umgestürztes Gitter. Um mich herum große Mietshäuser, in engen Haufen, wie von einer Flutwelle angespült und zurückgeblieben. In der Mitte - zwischen Böschungen und Erdwällen nistend - Streifen aus Baracken, aus Hütten, davor die Wiese. Es sieht aus wie ein Stück der Landschaften bei Ford. Gewellt, flach, wild. Am Ende des Weges ragt ein ungeschlachtes rundes Tuffsteinmonument auf, von wer weiß welchen Hochwassern zerfressen. Nähert man sich langsam, über Hecken, dicht und sattgrün wie der Meeresgrund, über Wiesen mit bescheidenen Distelgewächsen, öffnen sich die Grotten, alle mit Mäusedorn gepolstert, im Inneren kleine Schlünde, schwarz wie Brunnen, und darüber üppig mit Unkraut bewachsene, natürliche Brückchen - verwinkelte, ariosteske Grotten.
Am Ende der weiten Fläche aus Erdbuckeln, Hügeln und Senken, hinter einem sanften Tal, das entlang eines Bächleins endet, sieht man vor dem schon fahlen Himmel die Appia Antica mit dem runden, bräunlichen Grab von Caecilia Metella. Die Sonne überflutet noch alles wie tropfender Honig oder Nebelschwaden. Da hinten, auf dem Gipfel des höchsten Hügels, sitzt ein Grüppchen Priester, ganz in ihr Schwarz gehüllt, genießen sie die Sonne wie Eidechsen, und dort, am Rand einer kleinen Schlucht, ein Junge auf dem Fahrrad, reglos, mit seinem glattem Gesicht und den Zügen eines wilden Tierchens, einer weißen Katze. Sein Fahrrad ist eines dieser Fahrzeuge von Dorftrotteln: am Lenker hängen wie Kometenschweife bunte Streifen aus schwerem Stoff, dazu zwei, drei andere rote, grüne, gelbe Gegenstände. Auf das Schutzblech des Vorderreifens ist ein kleines rotes, aerodynamisches Flugzeug geklebt, die Pumpe ist rot, und es gibt sogar den kleinen Dreifuß, mit dem man Motorräder abstellt, hellblau angemalt. Der Junge steht einfach dort, scharf umrissen vor dem römischen Horizont, wie ein Azteke ?
Es wird Abend, ich kehre in die Stadt zurück, die alte, verzweifelte Stadt am Abend, mit ihren Lichtern, die an den Tod erinnern, ihren endlosen Autoschlangen, eines dicht hinter dem anderen, wütend, ohne Raum, ohne Atem, und den Tausenden fremder Menschen ringsumher, die nicht menschlicher sind als Ameisen oder Tote.
Unbeschreiblich der Kampf um einen Parkplatz in der Nähe der Via della Croce. Nach endlosem Umherstreifen durch Einbahnstraßen und Verkehrskreisel lande ich in der Via dell?Oca. Ich steige aus dem Auto, es ist noch früh, und gehe zu Fuß Richtung Via del Corso, die verglichen mit der Via della Scrofa und der Via del Babuino die erträglichste ist. An der Ecke der Via dell?Oca sehe ich Moravia, es mag daran liegen, dass ich schlechte Laune habe, doch auch er scheint mir recht traurig. Er geht nach Haus, sichtlich unzufrieden mit einem Gutteil seines Nachmittags und der Aussicht auf einen Abend, der ihn vielleicht ebenso wenig befriedigen wird. Wir begrüßen uns heiter, aber dann fällt uns das Reden ein wenig schwer, fast schaffe ich es nicht, ihm zu erklären, warum ich zu Fellini gehe und was ich mir erwarte: Ich stottere mit einer Stimme, die klingt wie mit Hämmern in der Kehle zerschlagen, wie die eines Kastraten. Obwohl er bekanntlich etwas schwerhörig ist, versteht Moravia wie üblich sofort alles. Intelligenz ist Güte und Güte ist Intelligenz, wenn ich, was ihn betrifft, Keats paraphrasieren darf. Nachdem er sich mit mir zum Abendessen verabredet hat, schleppt er sich nach Hause.
Die "Federiz" ist leer und heißt den Besucher willkommen mit ihren schönen weißen, grün umrandeten Vorhängen aus gutem Tuch, ihren Möbeln wie aus einem eleganten, luftigen Speisesaal. Ich trete ein, und da sind schon, ganz ohne Geheimnis, Riccardo Fellini, und, in seinem Büro, Fracassi. Als ich eintrete, kommt zufällig auch Fellini durch eine Innentür herein. Die mit schwarzer Schminke umrandeten Augen des großen Illusionisten können nicht verbergen, dass ich unerwartet, ein wenig verfrüht komme, doch er empfängt mich mit einer Umarmung. Er ist sauber, glatt, gesund wie ein wildes Tier im Käfig. Er führt mich in sein Arbeitszimmer. Und als er sich setzt, sagt er mir sofort, dass er ehrlich mit mir sein will (oh je), und dass das Material, das er gesehen hat, ihn nicht überzeugt ?
Ich wusste es, seit mindestens zehn Tagen war klar, dass es ihm nicht gefallen würde, vielleicht schon seit dem ersten Abend, als mich vorstellte und ihm vorschlug, den Film zu produzieren - ob er das nun weiß oder nicht. Also wundere ich mich nicht. Und diskutiere nur um der Klarheit und Wahrheit willen.
Was gefällt Fellini eigentlich nicht? Die Armut, die Schlamperei, die Grobheit, das plump, fast anonym Schulmäßige meiner Art zu drehen. Gut, ich bin einverstanden. Es war mein erster Versuch, zum ersten Mal in meinem Leben stand ich hinter einer Filmkamera, und diese Kamera fiel fast auseinander, sie war alt, enthielt nur wenige Meter Filmmaterial, und ich musste eine ganze Szene an einem Tag drehen. Auch die Schauspieler standen zum ersten Mal vor einem Objektiv. Was konnte ich tun, ein Wunder vollbringen? Ja, natürlich, Fellini hat ein Wunder erwartet. Ein Wunder, das ausblieb, weil ich noch keine Erfahrung mit den Auswirkungen hatte und mich darum am Ende mit Nahaufnahmen wiederfand, die amerikanische Großaufnahmen waren, mit Riesenköpfen a la Dreyer, die eigentlich gewöhnliche Nahaufnahmen waren, mit schnellen Kamerafahrten, die eigentlich langsam waren, einem trüben Licht, das eigentlich klar war, und umgekehrt. Kurzum, in dieser Szene hat jener Feinschliff gefehlt, der letztendlich den Stil ausmacht - also das Wunder.
Trotzdem, wenn ich die Szene noch einmal drehen müsste - genau diese Frage stellt mir Fellini - ja, dann würde ich sie wieder mit genau diesem Rhythmus drehen: schnell, gehetzt, schludrig, hingeworfen, funktional, ohne Nuancen und Atmosphären, ganz nah an den Figuren. Und so möchte ich den ganzen Film drehen.
Vielleicht bin ich zu selbstsicher, vielleicht auch ein bisschen zu verärgert, also bringt Fellini, ganz eleganter Großbischof, das Gespräch auf eine andere Ebene, die finanzielle: Wenn der Film wirklich wenig kosten wird, ist es den Versuch wert. Die Kosten müssen kalkuliert werden, das machen wir morgen mit Fracassi. Gut, ich komme morgen wieder. Doch ich weiß, dass es sich um einen Euphemismus handelt, um eine Litotes - um die Taktik eines Beichtvaters. Ich werde kommen, aber es wird sich nichts ändern. Wahrscheinlich wird die "Federiz" ohnehin nur Fellinis eigene Filme produzieren, höchstens, wenn die Umstände es zulassen, den Film irgendeines extravaganten Fellini-Adepten, aber ich weiß nicht, wie sehr das Fellini selbst nützen wird ?
Wieder auf der Straße. Ich fahre nach Monteverde hinauf, über San Pietro und die Via delle Fornaci, durch den Verkehr, der die Gleichgültigkeit von Momenten großen Leids hat, wenn du spürst, wie dir das Leben, dein eigenes Leben, entgleitet, während das Leben der Welt so weitergeht wie bisher und glücklich scheint.
Meine Wohnung mit der Einsamkeit meiner Mutter. Wir sind zwei Überlebende ohne Hoffnung auf einen möglichen Frieden, voller Angst vor allem, was uns jederzeit zustoßen kann: von Guidos Tod über die Tragödie der letzten Jahre meines Vaters bis zu meiner Tragödie, die eine Zeitlang eingeschläfert und neutralisiert wurde, aber jederzeit wieder ausbrechen kann, erbarmungslos, voraussehbar, ohne Hoffnung.
Kaum bin ich zu Hause, rufe ich Elsa Morante an wegen der Verabredung zum Abendessen. Ich verspreche, daß ich zu ihr, Moravia, Wilcock und Bolognini ins Restaurant kommen werde. Doch gleich nach dem Telefonat ändere ich meine Meinung. Ich sage Mama, dass ich zu Hause essen werde. Es ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich eine Verabredung nicht einhalte. Das tue ich fast lustvoll, als könnte aus dem Schmerz nur noch mehr Schmerz entstehen und als wäre das schon fast ein Trost.
(...)
(1960)
Aus dem Italienischen übersetzt von Annette Kopetzki. Herausgeberin des Pasolini-Dossiers ist Theresia Prammer.
Wie üblich bin ich spät aufgestanden, gegen elf. Ich weiß, dass heute ein, wie sagt man? entscheidender Tag ist. Die Angst bereitet mir körperliches Unwohlsein. Mein Herz klopft, mir dreht sich der Magen um. Im Gesicht spüre ich Schmerzen dort, wo das Alter sich einnistet: in der Stirn, den Wangenknochen unter den Augen, am Kopf hinter den Ohren.
Ich mache mich an die Arbeit. Wie ein Anfänger. Die Tatsache, dass ich ein Theaterstück wiederaufnehme, das ich 1944 geschrieben habe und das immer unvollständig geblieben ist, hat in diesem Moment eine besondere Bedeutung - ich weiß nicht, ob ich mich mit der Aufgabe trösten oder daran verzweifeln werde. Als ich es gestern erneut las, bin ich in einen Zustand nervöser Anspannung geraten, wie man ihn wohl nur kurz vor dem Nervenzusammenbruch erlebt. Die Ideen, die mir kamen, um das Stück zu korrigieren und fertigzustellen (sechzehn Jahre, nachdem es geschrieben wurde!) ließen mir keinen Augenblick Ruhe, sie liefen durch mein Inneres wie reißende Ströme, wie elektrische Entladungen. Aber sie hatten etwas Strahlendes, Berauschendes: die alte joy, die wiedererwachte. Gleichzeitig erschöpften sie mich auch, machten mich krank, als würde ich fiebern. Beim Abendessen im Pastarellaro mit Moravia, der Morante, Adriana Asti (die eine wichtige Rolle in dem Stück spielen soll), mit Parise, meiner Mutter und anderen Freunden, konnte ich nicht sprechen und fast nicht zuhören. Ich war ganz nach innen, diesen strahlenden Ideen zugekehrt, die mich von Kopf bis Fuß durchfuhren.
Ich schreibe, während meine Mama sich in der Wohnung zu schaffen macht. Sie kommt näher, sieht mich an. Ich spüre, dass sie mir etwas sagen muss. Schließlich sagt sie es, den Staublappen in der Hand: "Heute wäre Guidos Geburtstag ? Er wäre fünfunddreißig Jahre alt, stell dir das vor ?". Ich weiß nicht, was ich sagen soll, ich schweige und arbeite weiter. Dann tue ich etwas, was ich seit vielen Jahren fast mechanisch mache, ich nehme ihre Hand, ihre Mädchenhand, und küsse sie. Das Stück, das ich schreibe, ist voll von jenen Tagen, als Guido starb, von der Neurose, die ich dem Schmerz abgewonnen hatte, und mir scheint, als wären seither nicht sechzehn Jahre, sondern sechzehn Tage vergangen.
Da klingelt es an der Tür. Ein unbekannter junger Mann stellt sich vor, hochgewachsen, von schwer zu definierendem Aussehen. Er spricht unbeholfen, mit einem Gemisch unterschiedlicher Akzente. Tatsächlich erfahre ich kurz darauf - als ich mich ärgerlich von der Schreibmaschine losreiße - dass er Sizilianer ist, doch er kommt aus dem Norden, aus Casarsa ? Es ist Schicksal, dass dieses Casarsa sich so gewaltsam wieder aufdrängt, nachdem ich es zunächst durch eine in jeder Hinsicht erschöpfende Erfahrung für erledigt gehalten und dann vergessen und begraben hatte ? Der junge Mann möchte Schauspieler werden, er hat im Friaul vorgesprochen bei Bekannten, die ich dort oben habe. In Rom angekommen, wollte er sich in der Accademia d?Arte Dramatica einschreiben, doch die Frist war schon abgelaufen. Er bittet mich um einen Rat, eine Unterstützung ? Auch das wird versprochen. Er geht, diskret, ich bin wieder allein. Ich spüre diesen depressiven, lechzenden Geschmack der Langeweile, den ich seit Jahren nicht mehr spüre. Ja, seit Jahren habe ich sogar keine Langeweile mehr verspürt, das Gefühl, nicht zu wissen, was man tun soll oder zu nichts Lust zu haben. Eine schreckliche Angst trennt mich von allem wie eine Kupplung. Mein Herz schüttelt mich, es zuckt in meinen Rippen wie ein aus dem Takt geratenes Pendel. Ich weiß, dies ist kein guter Tag für mich, das gestrige Horoskop im Paese Sera hat es mir unmissverständlich angekündigt: "Entscheidungen, die Ihren Wünschen ziemlich entgegenstehen ?". Es ist mein einziger Aberglaube, natürlich von tausend unwiderlegbaren Beweisen bestätigt, und von fast allen meinen Freunden geteilt. Ich weiß also, dass es schlecht laufen wird, und diese Prophezeiung, dieses vorweggenommene Wissen, macht die Wirklichkeit, die sich aus anderen, weit genauer benennbaren Gründen um mich herum abzeichnet, noch beängstigender.
Um die Wahrheit zu sagen, hatte ich schon lange daran gedacht, einen Film zu machen. Eine Idee mit weit zurückliegenden Ursprüngen. Als Junge in Bologna liebte ich das Kino mindestens ebenso sehr wie Pietro Bianchi. Und im Abstand von vielen Jahren kann ich sagen, dass die Filme von Chaplin, von Dreyer und Eisenstein meinen Geschmack und meinen Stil im Grunde stärker beeinflusst haben als die gleichzeitigen literarischen Lehrjahre - abgesehen natürlich von den epischen Lektüren eines Jugendlichen, Shakespeare und Dostojewskij. In letzter Zeit hat es dann unmittelbare Gründe gegeben: eine Art launischer Unduldsamkeit gegenüber Regisseuren und Produzenten (La notte brava, Morte di un amico), den Wunsch, Geschehnisse, Personen, Szenen genau so umgesetzt zu sehen, wie ich sie beim Schreiben vor mir sehe. Dieser Trotz hat sich dann in eine echte Inspiration verwandelt, die mir in den letzten Monaten keine Ruhe mehr lässt.
Den Film "Accattone" sollte ich mit den Produzenten Cervi und Iacovoni machen. Anfang September sollte ich anfangen. Doch zu dem Zeitpunkt erschienen mir die beiden Produzenten plötzlich unsicher, zerstreut und abwesend, was allerdings nicht überraschend kam. Oder war ich derjenige, der ein schlechtes Gewissen hatte? Nicht ganz ungerechtfertigt, in Anbetracht meines, sagen wir, Zustands der Ungnade in der institutionellen und klerikalen Welt. Also wandte ich mich an Fellini. Der hatte im Sommer gerade mit Rizzoli die "Federiz" gegründet und mir mehrmals angeboten, meinen Film zusammen mit Fracassi zu produzieren. Er hatte sogar schon mit zwei jungen Männern von der "Ajace" Verhandlungen um eine Koproduktion geführt, freilich ohne Ergebnis. Bei meinem Vertrag mit Cervi und Iacovoni ging es jedoch um einen anderen Stoff, "La commare secca", den ich fallengelassen hatte. Ich hatte dafür keinen Vorschuss bekommen, darum war ich unabhängig. Der Sommer verstrich, meine Inspiration war, wie soll ich es ausdrücken, nicht verhandelbar. Ich ging also zu Fellini, der mich mit einer herzlichen Umarmung empfing. In jenen ersten Septembertagen richtete er gerade den neuen Sitz seiner Gesellschaft in der Via della Croce ein. Er tat das so begeistert und stolz wie ein kleiner Junge, natürlich auch mit ein wenig Koketterie. Wir umarmten uns und begannen mit der Arbeit.
Was dann folgte, waren die schönsten Tage meines Lebens, glaube ich. Fast alle meine Figuren waren versammelt, und ich ließ sie fotografieren, Dutzende Fotos. Von einem treuen Fotografen, den die Unschuld meiner Begeisterung mitriss, und von Bernardo, Bertoluccis Sohn, der ebenso mitgerissen war. Die Gesichter, die Körper, die Straßen, die Plätze, die Anhäufungen von Baracken, die Bruchstücke großer Palazzi, die schwarzen Wände der geborstenen Wolkenkratzer, den Schlamm, die Hecken, die mit Ziegelsteinen und Müll übersäten Wiesen der Vorstädte - all das zeigte sich in einem neuen, frischen, berauschenden Licht, es war ein unverfälschter und paradiesischer Anblick.

Accattone, Giorgio il Secco, der Scucchia, Alfredino, Peppe il Folle, der Sheriff, der Bassetto, der Gnaccia, dann das Pigneto-Viertel, die Via Formia, die Borgata Gordiani, die Straßen in Testaccio, die Frauen Maddalena, Ascensa, Stella, außerdem der Balilla und Cartagine - alle wurden mit prächtigen, ausgewählten Fotografien festgehalten. Immer frontal, als Vorderansicht, aber alles andere als stereotyp, aufgereiht in der Erwartung, sich bewegen, leben zu dürfen.
Dann habe ich auf Anraten Fellinis Probeaufnahmen gemacht, das heißt, ich habe zwei fast vollständige Szenen des Films gedreht.
Es waren herrliche Tage, der Sommer glühte noch in seiner ganzen Reinheit, nur im Inneren war ihm etwas von seiner Wut genommen. Die Via Fanfulla da Lodi mitten im Pigneto mit ihren kleinen Hütten, den bröckelnden Mäuerchen, besaß in ihrer unendlichen Armseligkeit eine körnige Erhabenheit. Ein armes, demütiges, unbekanntes Sträßchen, verloren unter der Sonne liegend, in einem Rom, das nicht Rom war.
Wir haben die Straße gefüllt: ein gutes Dutzend Schauspieler, der Kameramann, die Bühnenarbeiter, die Tontechniker. Doch da es keine "Gruppenbildung" gab - so etwas habe ich nie dulden wollen - herrschte bei dem Unternehmen eine friedliche Atmosphäre: Wir wirkten wie Arbeiter inmitten der anderen Arbeiter aus den kleinen Werkstätten im Pigneto.
Niemals hätte ich gedacht, dass die Regiearbeit so außergewöhnlich ist. Ich entschied mich für die schnellste und einfachste Form, um das darzustellen, was ich im Drehbuch geschrieben hatte. Kleine visuelle Blöcke, ordentlich, fast grob nebeneinander gesetzt. Ich hatte Dreyer im Kopf, aber in Wirklichkeit folgte ich einer Norm größter expressiver Schlichtheit. Es würde zu weit führen, ins Detail zu gehen: der Kampf mit dem Licht und seinem ständigen, hartnäckigen Wechsel, der Kampf mit der alten Filmkamera, der Kampf mit meinen Schauspielern aus Torpignattara, alle, wie ich, zum ersten Mal an einem Set. Doch es waren Kämpfe, die immer mit kleinen, tröstlichen Siegen endeten.
Während der drei Drehtage habe ich keine Nacht geschlafen. Wie in einem licht-erfüllten Alptraum dachte ich unablässig an den Film: Was mich im Abstand von wenigen Minuten jäh auffahren ließ, gleich kurzen angenehmen inneren Blutungen, die damit begannen, dass die Einstellungen einer Szene auftauchten, die ich am nächsten Tag drehen würde, oder ihre Fortsetzung oder die Einstellungen anderer Szenen, die mir nach und nach im Traum einfielen. Eine ganze Nacht habe ich, geblendet von der Sonne der Tiber-Badeanstalt Ciriola, unterhalb vom Castel Sant?Angelo verbracht, und da waren die Gesichter von Alfredino und Luciano, sie lachten, kniffen die Augen und die Fältchen um die Augen zusammen, wenn sie ihr schelmisches Lachen anstimmten, das mit seiner stoischen, antiken Fröhlichkeit alle Gesetze des Lebens aufhebt. Gesichter von Peonen, von Schiffsjungen auf der "Potemkin", von Mönchen.
Über die Mühen mit der Presse, mit dem Schneidetisch, dem Schnitt und den Tonspuren müsste man Memoiren schreiben, sie würden vor allem Nichteingeweihten nützen, wie ich einer war. Endlich waren die beiden Szenen fertig, und dieses Warten begann, ohne Anlass zum Zweifeln, aber dafür im Wissen, das es sich auf Nichts gründet, auf ein Schicksal ohne Zukunft, in dem sich nichts bewegt.
Ich langweile mich, spüre eine lechzende Langeweile vor diesen Seiten ohne Bedeutung. Und siehe da, wie erwartet, wie eine Bestätigung, klingelt das Telefon. Es ist Franco, der den Accattone spielen soll, die Hauptfigur. Schon seit einer Woche ruft er mich jeden Tag um diese Zeit an, vergeblich, und das weiß er. Hinter ihm sein Bruder Sergio, mein alter unersetzbarer Helfer, mein lebendes Lexikon des römischen Dialekts, und alle anderen - ihre Angst macht meine noch schlimmer. Ich weiß nicht, wie ich sie beruhigen soll, wie ich ihre wahrscheinliche Enttäuschung lindern soll. Gestern hat Fellini die Filmrolle mitgenommen und ist fortgegangen, um sich das Material allein anzusehen. Wir hätten es uns zusammen ansehen sollen, auch mit den Schauspielern, damit sie ein bisschen Mut schöpfen ? Erst danach hat Fellini mich angerufen, um mir davon zu erzählen. Im Grunde ist es verständlich und richtig, was er getan hat. Aber dann wieder Schweigen. Den ganzen Morgen lang habe ich auf einen Anruf gewartet, nichts. Also habe ich gegen Mittag angerufen und erfahren, dass Fellini und Fracassi zu einer Hochzeit gegangen sind.
Nun gut: Ich setze mich wieder an die Arbeit, an meine alte Storia interiore, die nicht mehr in Gang kommt.
Jetzt ruft mich Bernardo Bertolucci an, auch er ist in Nöten, sein Vater sei angekommen, sagt er. Also esse ich eilig und gehe in den fünften Stock hinauf. Bertolucci und ich wohnen im selben Haus hinter der Villa Sciarra.
Bertolucci ist allein mit dem ältesten Sohn. Seine Verwandten sind noch nicht zurück. Wir setzen uns in sein behagliches parmesanisches Wohnzimmer und beginnen mit einem unserer langen Gespräche, wie man sie unter Freunden führt. Obwohl ich so deprimiert und von den schlaflosen Nächten zermürbt bin. Auf seinem Nachttisch liegt Paragone mit zweien seiner Gedichte. Ich lese sie sofort: wie alle, die er zuletzt schrieb, sind sie großartig, herzzerreißend.
Dann reden wir von hunderterlei Dingen, von unseren Freunden, Literaten und Schriftstellern. Wir lästern ein wenig, aber das sind vollkommen unschuldige Bemerkungen, denn beide sind wir nicht fähig zu ernsthaften Bosheiten, wenn sie sich nicht auf ein zuvor gefasstes, durch und durch begründetes Werturteil stützen. Wir sprechen über mein Unglück, das ihn bedrückt und ängstigt, ich sehe es an der Bestürzung in seinen braunen Augen. Natürlich sprechen wir auch über meinen Film und über Fellini, der da ist wie eine ferne Pythia, die Urteil spricht. Bertolucci kommt aus seinem Parma, wo der Herbst schon begonnen hat (ich sehe es vor mir: mit den abgeernteten Weinbergen, der zum Po hin verschwimmenden Ebene, den vagen, kargen Hügeln und der fröhlichen Stimmung des Semesterbeginns, wenn elegante, in englische Stoffe gekleidete Studenten die Via Emilia bevölkern), und er empfindet die noch sommerliche Wärme in Rom als Frevel. Die Sonne glüht, erschöpft aber heiß, und ein schweißtreibender Schirokko weht.
Ich liebe diese Sonne. Außer dem Viertel, wo wir wohnen, kenne ich noch hundert andere, hoch und mit Türmen bewehrt wie die Stadt Dis, die in dieser blendenden Sonne liegen, darunter die schmutzigen Wiesen und mit Hütten übersäten Ebenen, die schwarzen Böschungen.
Ich halte es im Haus nicht mehr aus, umarme Attilio und gehe, um mir die nächste Wartezeit zu vertreiben, indem ich mich in meiner alten Einsamkeit verliere.
Wohin fahre ich? Um diese Zeit gibt es wenig Verkehr, träge lenke ich das Auto durch die warmen, gelben Straßen. Ja, ich werde einen Blick auf Acqua Santa werfen, seit über einem Jahr war ich nicht mehr dort, dabei ist es einer der angenehmsten, friedlichsten Orte Roms. Ich komme auf die Appia Nuova, lasse das Auto stehen und steige über ein umgestürztes Gitter. Um mich herum große Mietshäuser, in engen Haufen, wie von einer Flutwelle angespült und zurückgeblieben. In der Mitte - zwischen Böschungen und Erdwällen nistend - Streifen aus Baracken, aus Hütten, davor die Wiese. Es sieht aus wie ein Stück der Landschaften bei Ford. Gewellt, flach, wild. Am Ende des Weges ragt ein ungeschlachtes rundes Tuffsteinmonument auf, von wer weiß welchen Hochwassern zerfressen. Nähert man sich langsam, über Hecken, dicht und sattgrün wie der Meeresgrund, über Wiesen mit bescheidenen Distelgewächsen, öffnen sich die Grotten, alle mit Mäusedorn gepolstert, im Inneren kleine Schlünde, schwarz wie Brunnen, und darüber üppig mit Unkraut bewachsene, natürliche Brückchen - verwinkelte, ariosteske Grotten.
Am Ende der weiten Fläche aus Erdbuckeln, Hügeln und Senken, hinter einem sanften Tal, das entlang eines Bächleins endet, sieht man vor dem schon fahlen Himmel die Appia Antica mit dem runden, bräunlichen Grab von Caecilia Metella. Die Sonne überflutet noch alles wie tropfender Honig oder Nebelschwaden. Da hinten, auf dem Gipfel des höchsten Hügels, sitzt ein Grüppchen Priester, ganz in ihr Schwarz gehüllt, genießen sie die Sonne wie Eidechsen, und dort, am Rand einer kleinen Schlucht, ein Junge auf dem Fahrrad, reglos, mit seinem glattem Gesicht und den Zügen eines wilden Tierchens, einer weißen Katze. Sein Fahrrad ist eines dieser Fahrzeuge von Dorftrotteln: am Lenker hängen wie Kometenschweife bunte Streifen aus schwerem Stoff, dazu zwei, drei andere rote, grüne, gelbe Gegenstände. Auf das Schutzblech des Vorderreifens ist ein kleines rotes, aerodynamisches Flugzeug geklebt, die Pumpe ist rot, und es gibt sogar den kleinen Dreifuß, mit dem man Motorräder abstellt, hellblau angemalt. Der Junge steht einfach dort, scharf umrissen vor dem römischen Horizont, wie ein Azteke ?
Es wird Abend, ich kehre in die Stadt zurück, die alte, verzweifelte Stadt am Abend, mit ihren Lichtern, die an den Tod erinnern, ihren endlosen Autoschlangen, eines dicht hinter dem anderen, wütend, ohne Raum, ohne Atem, und den Tausenden fremder Menschen ringsumher, die nicht menschlicher sind als Ameisen oder Tote.
Unbeschreiblich der Kampf um einen Parkplatz in der Nähe der Via della Croce. Nach endlosem Umherstreifen durch Einbahnstraßen und Verkehrskreisel lande ich in der Via dell?Oca. Ich steige aus dem Auto, es ist noch früh, und gehe zu Fuß Richtung Via del Corso, die verglichen mit der Via della Scrofa und der Via del Babuino die erträglichste ist. An der Ecke der Via dell?Oca sehe ich Moravia, es mag daran liegen, dass ich schlechte Laune habe, doch auch er scheint mir recht traurig. Er geht nach Haus, sichtlich unzufrieden mit einem Gutteil seines Nachmittags und der Aussicht auf einen Abend, der ihn vielleicht ebenso wenig befriedigen wird. Wir begrüßen uns heiter, aber dann fällt uns das Reden ein wenig schwer, fast schaffe ich es nicht, ihm zu erklären, warum ich zu Fellini gehe und was ich mir erwarte: Ich stottere mit einer Stimme, die klingt wie mit Hämmern in der Kehle zerschlagen, wie die eines Kastraten. Obwohl er bekanntlich etwas schwerhörig ist, versteht Moravia wie üblich sofort alles. Intelligenz ist Güte und Güte ist Intelligenz, wenn ich, was ihn betrifft, Keats paraphrasieren darf. Nachdem er sich mit mir zum Abendessen verabredet hat, schleppt er sich nach Hause.
Die "Federiz" ist leer und heißt den Besucher willkommen mit ihren schönen weißen, grün umrandeten Vorhängen aus gutem Tuch, ihren Möbeln wie aus einem eleganten, luftigen Speisesaal. Ich trete ein, und da sind schon, ganz ohne Geheimnis, Riccardo Fellini, und, in seinem Büro, Fracassi. Als ich eintrete, kommt zufällig auch Fellini durch eine Innentür herein. Die mit schwarzer Schminke umrandeten Augen des großen Illusionisten können nicht verbergen, dass ich unerwartet, ein wenig verfrüht komme, doch er empfängt mich mit einer Umarmung. Er ist sauber, glatt, gesund wie ein wildes Tier im Käfig. Er führt mich in sein Arbeitszimmer. Und als er sich setzt, sagt er mir sofort, dass er ehrlich mit mir sein will (oh je), und dass das Material, das er gesehen hat, ihn nicht überzeugt ?
Ich wusste es, seit mindestens zehn Tagen war klar, dass es ihm nicht gefallen würde, vielleicht schon seit dem ersten Abend, als mich vorstellte und ihm vorschlug, den Film zu produzieren - ob er das nun weiß oder nicht. Also wundere ich mich nicht. Und diskutiere nur um der Klarheit und Wahrheit willen.
Was gefällt Fellini eigentlich nicht? Die Armut, die Schlamperei, die Grobheit, das plump, fast anonym Schulmäßige meiner Art zu drehen. Gut, ich bin einverstanden. Es war mein erster Versuch, zum ersten Mal in meinem Leben stand ich hinter einer Filmkamera, und diese Kamera fiel fast auseinander, sie war alt, enthielt nur wenige Meter Filmmaterial, und ich musste eine ganze Szene an einem Tag drehen. Auch die Schauspieler standen zum ersten Mal vor einem Objektiv. Was konnte ich tun, ein Wunder vollbringen? Ja, natürlich, Fellini hat ein Wunder erwartet. Ein Wunder, das ausblieb, weil ich noch keine Erfahrung mit den Auswirkungen hatte und mich darum am Ende mit Nahaufnahmen wiederfand, die amerikanische Großaufnahmen waren, mit Riesenköpfen a la Dreyer, die eigentlich gewöhnliche Nahaufnahmen waren, mit schnellen Kamerafahrten, die eigentlich langsam waren, einem trüben Licht, das eigentlich klar war, und umgekehrt. Kurzum, in dieser Szene hat jener Feinschliff gefehlt, der letztendlich den Stil ausmacht - also das Wunder.
Trotzdem, wenn ich die Szene noch einmal drehen müsste - genau diese Frage stellt mir Fellini - ja, dann würde ich sie wieder mit genau diesem Rhythmus drehen: schnell, gehetzt, schludrig, hingeworfen, funktional, ohne Nuancen und Atmosphären, ganz nah an den Figuren. Und so möchte ich den ganzen Film drehen.
Vielleicht bin ich zu selbstsicher, vielleicht auch ein bisschen zu verärgert, also bringt Fellini, ganz eleganter Großbischof, das Gespräch auf eine andere Ebene, die finanzielle: Wenn der Film wirklich wenig kosten wird, ist es den Versuch wert. Die Kosten müssen kalkuliert werden, das machen wir morgen mit Fracassi. Gut, ich komme morgen wieder. Doch ich weiß, dass es sich um einen Euphemismus handelt, um eine Litotes - um die Taktik eines Beichtvaters. Ich werde kommen, aber es wird sich nichts ändern. Wahrscheinlich wird die "Federiz" ohnehin nur Fellinis eigene Filme produzieren, höchstens, wenn die Umstände es zulassen, den Film irgendeines extravaganten Fellini-Adepten, aber ich weiß nicht, wie sehr das Fellini selbst nützen wird ?
Wieder auf der Straße. Ich fahre nach Monteverde hinauf, über San Pietro und die Via delle Fornaci, durch den Verkehr, der die Gleichgültigkeit von Momenten großen Leids hat, wenn du spürst, wie dir das Leben, dein eigenes Leben, entgleitet, während das Leben der Welt so weitergeht wie bisher und glücklich scheint.
Meine Wohnung mit der Einsamkeit meiner Mutter. Wir sind zwei Überlebende ohne Hoffnung auf einen möglichen Frieden, voller Angst vor allem, was uns jederzeit zustoßen kann: von Guidos Tod über die Tragödie der letzten Jahre meines Vaters bis zu meiner Tragödie, die eine Zeitlang eingeschläfert und neutralisiert wurde, aber jederzeit wieder ausbrechen kann, erbarmungslos, voraussehbar, ohne Hoffnung.
Kaum bin ich zu Hause, rufe ich Elsa Morante an wegen der Verabredung zum Abendessen. Ich verspreche, daß ich zu ihr, Moravia, Wilcock und Bolognini ins Restaurant kommen werde. Doch gleich nach dem Telefonat ändere ich meine Meinung. Ich sage Mama, dass ich zu Hause essen werde. Es ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich eine Verabredung nicht einhalte. Das tue ich fast lustvoll, als könnte aus dem Schmerz nur noch mehr Schmerz entstehen und als wäre das schon fast ein Trost.
(...)
(1960)
Aus dem Italienischen übersetzt von Annette Kopetzki. Herausgeberin des Pasolini-Dossiers ist Theresia Prammer.
Kommentieren