Efeu - Die Kulturrundschau
Freie Zufälligkeit der Fleckenexistenz
Die besten Kritiken vom Tage. Wochentags um 9 Uhr, sonnabends um 10 Uhr.
Kunst
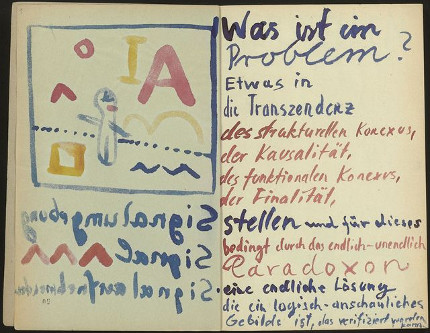
In der DDR durfte der Künstler A.R. Penck nicht ausstellen, in den Westen, wo er gefeiert wurde, durfte er erst 1980 ausreisen. Die ganze schillernde Pracht seines Universums erlebt SZ-Kritikerin Kito Nedo nun im Dresdner Albertinum in der großen Retrospektive "Ich aber komme aus Dresden (check it out man, check it out)": "Als er etwa im Rahmen einer 'operativen Maßnahme' der Staatssicherheit Mitte der Siebziger zwangsweise zum sechsmonatigen Reservedienst in die Nationale Volksarmee eingezogen wird, erarbeitet er einen 'Verbesserungsvorschlag Militärästhetik', der schließlich zur Produktion einer gleichnamigen Künstlermappe mit entsprechend umgestaltetem Spielzeugpanzer und Spielzeugsoldat führt. Der Künstler schlug einen Kuhfell-artigen Tarnanstrich für militärische Objekte, Panzer und Uniformen vor. So sollte ein 'expressiver, stimulierender Effekt (freie Zufälligkeit der Fleckenexistenz)' erreicht werden."
Im taz-Interview mit Beate Scheder erklärt der amerikanische Künstler Arthur Jafa, der gerade für sein Video "Love Is the Message, the Message Is Death" den Prix International d'Art Contemporain erhielt, was er sich unter schwarzer Kunst vorstellt und was in seinen Augen den Unterschied zwischen einer weißen und einer schwarzen Ästhetik ausmacht, etwa bei der Oper: "Schwarz zu sein, ist eng damit verknüpft, was es nach sich zieht, wenn einem gesagt wird, man sei kein Subjekt, sondern ein Objekt ohne Handlungsfähigkeit. Daraus folgt ein profund anderes Verständnis von Welt, dem die Oper gar nicht entsprechen kann. Schwarze Musik kann das auf eine akkuratere, kraftvollere Art und Weise. Leontyne Price zuzuhören kann schön sein, aber es ist etwas ganz anderes, Aretha Franklin zuzuhören, weil man bei ihr nicht nur ihren individuellen Gesang wahrnimmt. Man hört eine künstlerische Ausdrucksweise, die sich über die Generationen hinweg entwickelte und in welcher die Idee mitschwingt, in aller Komplexität zu artikulieren und darzustellen, was es bedeutet, ein menschliches Wesen zu sein, dem gesagt wurde, es sei ein Tier."

Besprochen werden außerdem die anstehende Helga-Paris-Ausstellung in der Berliner Akademie der Künste (Berliner Zeitung), eine Schau der schottischen Künstlerin Karla Black in der Frankfurter Schirn Kunsthalle (FR) und die Martin-Kippenberger-Schau in der Bonner Bundeskunsthalle (FAZ).
Bühne

FR-Kritikerin Judith von Sternburg jubelt über Lotte de Beers Inszenierung von Verdis "Don Carlos" an der Staatsoper Stuttgart, die in der selten gespielten Langfassung eben auch das zeige, was sonst nur Behauptung bleibe: "Mit dem unverknappten Fontainebleau-Akt, der seine dramaturgische Raffinesse und Triftigkeit ausbreiten kann - das leidende französische Volk, das auf den Friedensschluss angewiesen ist, auch wenn er auf Kosten des Lebensglücks der Prinzessin geht; die Prinzessin und der Infant, die sich wie von ungefähr begegnen, in einer hinreißenden Szene sofort und ganz glaubwürdig ineinander verlieben. Überwältigt sind sie ja nicht zuletzt vom märchenhaften, unerwarteten Glück, dass eine Vernunftehe so schön und froh sein könnte; das Unglück schließlich, das nur Minuten später hereinbricht, indem sich der König von Spanien selbst zur Eheschließung mit der jungen Elisabeth entschlossen hat. Sie können es nicht glauben, sie denken, sie hätten sich verhört." In den Stuttgarter Nachrichten kann sich Susanne Benda gut vorstellen, dass die Kulinariker unter den Opernbesucher mit dieser Dystopie der Macht nicht glücklich wurden: "Kein Charakter, keine Szene bleibt ungebrochen, und der Titelheld hält sich fast durchgehend außerhalb des meist leeren, dunklen Spielraums auf. Die Rettung, die Verdi noch möglich macht, ist bei de Beer keine Option."
Besprochen werden außerdem Marius von Mayenburgs Inszenierung von Penelope Skinners "Linda" am Düsseldorfer Schauspielhaus (SZ), Daniela Löfflers Inszenierung von Brigitte Reimanns großem DDR-Roman "Franziska Linkerhand" (taz) und György Ligetis "Le Grand Macabre" in Dresden (NMZ).
Literatur
Der Literaturblogger Lars Hartmann verteidigt Peter Handke und seine Medienkritik bei Tell: "Kritiker Handkes können anführen, dass er primär die Serben als Opfer sieht und nicht die Vertreibung der Muslime benennt - etwa die aus Dobrun oder die Belagerung von Sarajevo. Dieser Einwand führt aber insofern an der Sache vorbei, weil Handke einerseits auch von Serben als Tätern und von Muslimen als Opfer schreibt (eben jene in der Ortschaft Dobrun sowie beispielsweise das Verschwinden der Minarette aus Višegrad), und er andererseits beim Blick der Öffentlichkeit auf diesen Krieg jene 'Gerechtigkeit für Serbien' sich wünscht, die in den Medien oft nicht zu finden ist. In diesem Sinne sind Handkes Texte als Korrektiv zu lesen." In der FR umkreist Norbert Mappes-Niediek den "poetischen Blick" und das Primat des Subjektiven, mit dem Handke in die Welt schaut: "Widerspricht dem Autor jemand, weil Jugoslawien für ihn vielleicht etwas ganz anderes ist, wird Handke böse, denn er fühlt sich seiner authentischen Erfahrung beraubt und damit persönlich angegriffen. Es ist eben seine Wirklichkeit, und die - auch wenn es eine Konstruktion ist - darf ihm niemand ausreden."
Der Übersetzer Ulrich Blumenbach antwortet in der NZZ auf Felix Philipp Ingolds Kritik an der Gegenwartsliteratur, die nur noch für sich selbst und, anders als die Altvorderen, nicht mehr für die Ewigkeit schreibe: "Ich zumindest lese Gegenwartsliteratur, weil ich wissen möchte, wie heutige Autoren ihre jeweilige Welt perspektivieren, wie sie ihre Veränderungen verstehen und auf narrative Begriffe bringen, sprich in Erzählungen verpacken." Außerdem komme "das Interesse am literarischen Sprachgebrauch hinzu: Wie entwickeln ausländische ebenso wie deutschsprachige Autoren und Autorinnen ihre jeweilige Sprache weiter, wie reagieren sie auf neue technische Sachverhalte, wie reagieren sie auf globale Migrationen, die zu Sprachmischungen führen?"
Weiteres: Vojin Saša Vukadinović erinnert in der Jungle World an das Werk der 1977 in Brasilien verstorbenen Schriftstellerin Clarice Lispector. Neil Genzliner schreibt in der New York Times einen Nachruf auf den Schriftsteller Ernest J. Gaines.
Besprochen werden unter anderem Pia Klemps "Lass uns mit den Toten tanzen" (Freitag), Hendrik Otrembas "Kachelbads Erbe" (SZ), neue Kinder- und Jugendbücher, darunter eine neu illustrierte Ausgabe von Michael Endes "Die unendliche Geschichte" (NZZ), und gleich zwei neue deutsche Übersetzungen von George Eliots "Middlemarch" (FAZ).
Diese und viele weitere Bücher finden Sie selbstverständlich in unserem neuen Online-Buchladen Eichendorff21.
Film

Die Academy in Hollywood zeigt sich derzeit mal wieder von ihrer provinziellen Seite, meldet Cara Buckley in der New York Times: Weil Genevieve Nnajis in Nigeria entstandener Film "Lionheart" weitgehend auf Englisch gedreht wurde, wurde der Film nun von der eigentlich vorgesehenen Kategorie "bester internationaler Film" ausgeschlossen. Dass die früher "bester fremdsprachiger Film" benannte Kategorie vor kurzem umbenannt wurde, sei bloß Kosmetik gewesen, die Regeln - der Film dürfe im wesentlichen nicht auf Englisch gedreht sein - blieben jedoch gleich. Simon Sales Prado findet das in der taz sehr ärgerlich, "weil damit einer der wenigen eingereichten afrikanischen Filme ausgeschlossen wird, einer der wenigen Einreichungen überhaupt, die inmitten einer weißen, männlichen Hollywood-Filmlandschaft von einer Schwarzen Regisseurin gedreht wurden", aber auch weil "die Regeln der Academy die koloniale Geschichte ausblendet. Schließlich war Nigeria britische Kolonie, Englisch ist Amts- und Verkehrssprache." Entsprechend protestieren auf Twitter die Filmemacherin Ava DuVernay und Genevieve Nnaji selbst: "Dieser Film repräsentiert, wie wir in Nigeria sprechen. Dies schließt die englische Sprache ein, eine Brücke zwischen den mehr als 500 Sprachen, die in unserem Land gesprochen werden."
Martin Scorseses Streitschrift gegen das erdrückende Superhelden-Monopol in den Kinos (unser Resümee) finde unter Hollywoods Darsteller-Riege kaum Beifall, erklärt Hanns-Georg Rodek in der Welt, "denn jeder weiß, dass in diesen Franchises auch Chancen für sie liegen: die Chance auf einen fetten Gehaltsscheck, die Chance auf Rettung aus dem Karriereknick (wo wäre Robert Downey Jr., hätte ihn nicht 'Iron Man' aus seinem Kreislauf von Drogen, Entzug und Drogen gerettet?), die Chance auf wirklich gute Rollen in wirklich guten Filmen, die von dem Superheldengeld praktisch subventioniert werden?"
Weiteres: In der SZ plaudert David Steinitz mit Roland Emmerich über dessen kostengünstig produzierten Mini-Blockbuster "Midway". Im Filmdienst-Blog berichtet Matthias Dell davon, wie es dem Nürnberger KommKino (nach einer Initiative des Perlentaucher-Filmkritikers Jochen Werner) gelungen ist, 200 Filmkopien aus dem Keller des geschlossenen Münchner Gabriel-Kinos zu retten.
Besprochen werden Jan-Ole Gersters "Lara" mit Corinna Harfouch (Tagesspiegel, FAZ), der CIA-Thriller "The Reporter" mit Adam Driver (ZeitOnline), die zweite Staffel der Netflix-Serie "The End of the F*ing World" (Dlf Kultur) und die zweite Staffel der Serie "Britannia" (FAZ).
Design
Susanne Koeberle probiert für die NZZ Patrik Künzlers "Limbic Chair" aus, der "gesund und glücklich zugleich machen soll" und gerade beim Schweizer Designpreis in der Kategorie "Furniture-Design" ausgezeichnet wurde. Das Möbel sieht, ehrlich gesagt, nicht gar so einladend aus. Aber "Ausgangspunkt für Künzlers Idee, Neurologie und Design zu verbinden, war, ein Designobjekt zu entwickeln, das sich positiv auf unsere Emotionen auswirkt. Design vom Gehirn aus gedacht und nicht von der Funktion her: 'form follows emotion' also statt 'form follows function'. Es folgten mehrere Prototypen und unzählige Testversuche am MIT, bezüglich der ergonomischen Form ebenso wie der Materialisierung des Stuhls. 'Der Gesichtsausdruck von Probanden, die, kaum auf dem Stuhl, ein Lächeln zeigten und beim Ausprobieren des Objekts quasi zu Kindern wurden, waren für mich der Antrieb weiterzumachen.'" Im TED-Talk stellt Künzler das Objekt vor:
Musik
Frederik Hanssen berichtet im Tagesspiegel von Jan Lisieckis Klangexperiment in Berlin und Hamburg: Gemeinsam mit den Musikern des New Yorker Orpheus Chamber Orchestras hat der Pianist sowohl in der Berliner Philharmonie, als auch in der Elbphilharmonie dasselbe Mendelssohn-Programm gespielt. Ergebnis: Die Abende klangen "verblüffend unterschiedlich", doch ein klarer Sieger ist für ihn schlechterdings nicht zu ermitteln. "Geradezu blendend brillant klingt das Klavier in Hamburg. Der Solist steht hier absolut im Mittelpunkt, Jan Lisiecki kann seine Fähigkeiten als Klang-Beleuchter voll ausreizen. ... Er ist hier der Impulsgeber, das Orchester seine freundliche Begleitung. In Berlin dagegen erscheint Mendelssohns 1. Klavierkonzert viel stärker als Gemeinschaftsleistung, weil Lisieckis Virtuosität hier in den Orchesterklang eingebettet ist, Solist und Ensemble zur Einheit verschmelzen. Nach der Elbphilharmonie-Erfahrung überwältigt Hans Scharouns Saal den Hörer geradezu. So elegant und edel entfaltet sich hier der Wohlklang, dass man körperlich zu spüren meint, wie die Schallwellen von der Bühne in den Saal fluten."
Weiteres: Kerstin Holm berichtet in der FAZ vom Festival "Moscow Forum". Besprochen werden das neue Album von Shannon Wright (Jungle World), das Debüt der Düsseldorf Düsterboys (ZeitOnline), das Album "Chicago Baby" der österreicherischen Rapperin Hunney Pimp (Standard), neue Popveröffentlichungen, darunter das neue Album von Voodoo Jürgens (SZ), und das neue Album von Kreidler (Jungle World). Eine Hörprobe:







