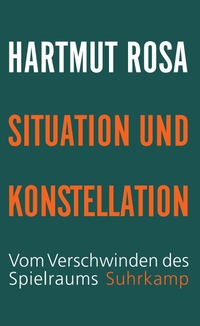Essay
Kleines Kulturkampf-Brevier
Oder: Warum der Islam eine Herausforderung ist. Von Stefan Weidner
16.09.2008. Nicht der Kulturkampf ist schlecht. Schlecht ist es nur, wenn er einen allzu klaren Sieger hat. Ob und in welchem Maß der Westen sein Versprechen halten kann: Davon hängt ab, in wieweit es für die Muslime lohnenswert scheint, sich dem Westen anzunähern. 1
Gibt es überhaupt einen Kampf der Kulturen? Trotz der heftig geführten Islamdebatten, trotz der Kriege in Irak, Afghanistan und um die israelischen Grenzen, scheint es, als wäre der Kampf der Kulturen vor allem ein Streit um den Begriff des Kulturkampfs selber. Besonders im moderaten, islamfreundlichen Lager und unter professionellen Beschwichtigern wird immer wieder betont, dass es diesen Kampf in Wahrheit nicht gäbe. Das klingt so, als sei der Kampf der Kulturen eine bloße Frage der Abstimmung.
Nur dürfte der Kampf der Kulturen nicht deshalb aufhören, weil man inständig behauptet, es gebe ihn nicht. So sehr ich nachvollziehen kann, dass man gegen den Kulturkampf ist, wäre es sehr gewagt, aus der Ablehnung des Kulturkampfs zu schließen, dass es überhaupt keinen gibt. Ich glaube sogar, dass eine solche Annahme selbst im Sinne der Gegner eines Kulturkampfes kontraproduktiv ist. Von der Auseinandersetzung mit realen Problemen - wie gehen die westlichen Gesellschaften mit den Muslimen und dem Islam um - verschiebt sich die Front auf das Gebiet der bloßen Meinung darüber, ob angesichts dieser Probleme das Wort "Kampf" angebracht ist.
Dabei ist die Rede vom Kampf der Kulturen erst einmal nichts als eine Übersetzung des vom amerikanischen Politikwissenschaftler Samuel Huntington popularisierten Begriffs eines "Clash of Civilisations", eines Zusammenstoßes oder einer Kollision der Zivilisationen. Die Übersetzung als "Kampf der Kulturen" vergröbert die ursprüngliche Idee, aber sie ist zupackend und sie hat den Vorteil einer leicht über die Zunge gehenden Alliteration, die etwas verknüpft, was sich normalerweise diametral entgegensteht, Kampf und Kultur. Doch was ist so abschreckend an dieser Verknüpfung? Zuzugestehen, dass es einen Kampf der Kulturen gibt, heißt ja weder, diesen Kampf gut zu finden, noch dass es keine Alternativen zu ihm gäbe. Und warum sollte gleichzeitig zu diesem Kampf nicht auch eine Hochzeit der Kulturen zu vermelden sein?
Man muss die Rede vom Kampf der Kulturen nicht zwangsläufig mit Blutvergießen assoziieren. Die Metapher gibt weitaus mehr her, als man im allgemeinen zuzugestehen bereit ist. Statt eines Gemetzels erblicke ich darin die Konkurrenz der Ideen, den Wettstreit auf symbolischen Ebenen. Man könnte auch an einen Kampf der Worte denken wie in einem Gerichtsprozess, mit permanenten Plädoyers vor den Geschworenen der Weltöffentlichkeit. Oder an einen Wettbewerb der kulturellen Ideen im weitesten Sinne: politisch, sozial, ökonomisch, religiös oder weltanschaulich, sofern wir darunter mehr verstehen als eine streng definierte Konfession oder Ideologie.
Wer sich mit der simplen Feststellung begnügt, den Kampf gebe es nicht, setzt sich überdies dem Verdacht aus, einem Wettbewerb der Ideen um das bessere Leben die Grundlage zu entziehen. Er muss sich vorwerfen lassen, auch das Gespräch nicht zu wollen und die Differenz zu leugnen, die dieses Gespräch erst antreibt. Man könnte ihm unterstellen, die Unterschiede glattbügeln zu wollen oder am Ende seine eigene, jedoch unausgesprochene, der Auseinandersetzung entzogene Sicht als letztgültige hinzustellen. Eine solche Haltung, gepflegt von Kolumnisten, Politikern, Geistlichen und anderen Schönrednern aller Lager ist zumindest bevormundend. Im schlimmsten Fall diskreditiert sie jede alternative Position als potentielle Kriegstreiberei. So heißt es zum Beispiel in dem ansonsten nicht unlesenswerten Buch "Kampfabsage" von Ilija Trojanow und Ranjit Hoskote "Mit dem Schlagwort vom Kampf der Kulturen [?] wurden weltweit neue Feindbilder geschaffen und Konflikte geschürt". Abgesehen davon, dass es die Feindbilder und Konflikte schon vor Huntington gab, könnte man das glatte Gegenteil behaupten: Denn erst das Schlagwort vom Kampf der Kulturen hat im Westen die Aufmerksamkeit auf andere Kulturen gelenkt und damit einen intensiveren Austausch als je zuvor ermöglicht.
Selbst wenn man die kulturellen Unterschiede nicht betonen will: ohne Kampf gibt es keine Verschmelzung. Wenig spricht für die Annahme, dass die Mehrzahl der Menschen von alleine und freiwillig Anregungen bei anderen Kulturen sucht. Einzelne vielleicht; Kollektive sind schwerfällig. Wer für eine Vermischung der Kulturen ist, für wechselseitige Bereicherung plädiert, wird die Auseinandersetzung nicht nur nicht ausschließen und scheuen dürfen, er wird sie als Motor der Verschmelzung anerkennen. Halten wir daher fest, dass der Kampf der Kulturen kein Feind ist, sondern ein Freund, wenngleich einer, der manchmal cholerisch sein kann, und der, wenn er zuviel getrunken hat oder sich in die Ecke gedrängt fühlt, gerne auch einmal zuschlägt. Um so wichtiger ist es, ihn an die Hand zu nehmen und mit ihm zu reden, statt ihn als Buhmann in die Ecke zu stellen.
Der Kulturkampf ist der Kampf um das Bild von der Welt, das uns richtig scheint. Jeder kann sich dabei täuschen. Das tragischste Szenario besteht darin, den Kampf um das Bild zu gewinnen, um dann irgendwann feststellen zu müssen - und diese Erkenntnis setzt sich selten gewaltlos durch -, dass es das falsche war oder im Lauf der Zeiten zu einem falschen geworden ist. Unlängst ist dies die Erfahrung des Kommunismus gewesen. Es könnte morgen die Erfahrung des fundamentalistischen Islam sein, wenn es ihm gelingen sollte, den Kampf um die Herzen der Muslime zu gewinnen. Es könnte übermorgen die Erfahrung eines entfesselten, zu keinen Rücksichten mehr gezwungenen Westens werden.
Nicht der Kulturkampf ist schlecht. Schlecht ist es nur, wenn er einen allzu klaren Sieger hat.
2
Bei den meisten Versuchen, den Islam zu definieren, lassen sich zwei grundsätzliche Tendenzen ausmachen, eine harte und eine weiche Definition. "Hart" und "weich" ist hier wörtlich zu nehmen. Wenn man es in Begriffen der Computersprache beschreibt, wird der Unterschied am deutlichsten: Die einen begreifen den Islam als Software, die anderen als Hardware. In die Software kann man eingreifen, man kann sie ändern, entwickeln, fortschreiben, anpassen, modernisieren. Die Hardware ist festgelegt; Manipulationen sind nur in geringem Maße möglich. Wenn sie den Anforderungen nicht mehr genügt, muss man sie austauschen und die alte auf den Müll schmeißen - den Müllhaufen der religiösen Ideen.
Legt man diese harte Definition zugrunde, erscheint der Islam in den Augen seiner Gegner als einer dieser urzeitlichen Homecomputer, für die man noch Floppy-Discs als Speichermedium benutzte. Es versteht sich, dass darauf die Programme "Aufklärung und Moderne" wenn überhaupt, nur sehr langsam laufen, von häufigen Abstürzen begleitet.
Aber die Hardware-Theorie lässt sich auch zugunsten des Islam verwenden. Unter den muslimischen Anhängern dieser Vorstellung, meist Fundamentalisten, wird der Islam als eine Art Supercomputer verstanden. Eventuelle Macken und Probleme sind auf unsachgemäße (sprich: unislamische) Bedienung zurückzuführen: Der Mensch ist fehlbar, nicht die Maschine.
In den Islamwissenschaften wird die harte Definition häufig essentialistisch genannt. Essentialistisch meint: Der Islam habe einen unveränderlichen Wesenskern, eine Essenz. Diese Position hat eine schwerwiegende Konsequenz. Bestimmte Elemente gehören demnach so wesensgemäß zum Islam, dass dieser ohne sie nicht denkbar ist, also kein "richtiger", "echter" Islam mehr wäre. Der Essentialist sagt zum Beispiel, dass die Scharia, also das islamische Recht, und die Demokratie unvereinbar seien. Und wenn Muslime dann das islamische Recht der Demokratie unterwerfen, sind sie eben keine richtigen, echten Muslime mehr, sondern verwestlicht. Ein Kennzeichen des Essentialismus ist, dass sich westliche Orientalisten und islamische Fundamentalisten in der Sache verblüffend einig sind, während sie sich in der Wertung deutlich unterscheiden. Für beide hat der Islam dieselbe Essenz, nur dass die Fundamentalisten sie für gut halten, die Orientalisten für problematisch.
Für Nicht-Essentialisten, also diejenigen, die den Islam als Software erachten, ist "Islam" nur ein Oberbegriff für sehr vielgestaltige Phänomene. Manche Theoretiker dieser Schule halten eine Beschreibung des Islam (oder des Orients) als solchen für unmöglich und lehnen sie grundsätzlich ab. Anderen genügt es, festzuhalten, dass der Islam interpretier- und wandelbar ist und dass immer weitere Abweichungen vom ursprünglichen Quellcode denkbar sind. Gemäß diesen Vorstellungen sind zum Beispiel Scharia und Demokratie zu vereinbaren, weil die Scharia als etwas Wandelbares verstanden wird.
Diese weiche Sichtweise auf den Islam hat eine substantielle Schwäche. Dem, was sie unter Islam versteht, sind keinerlei Grenzen auferlegt. Um in der Computerterminologie zu bleiben, besagt dies, dass das Software-Modell nicht einmal eine Änderung des Quellcodes ausschließt. Dies jedoch würde bedeuten, dass der Islam Formen annehmen kann, die mit keiner seiner historischen Manifestationen notwendig etwas zu tun haben müssen, und es stellt sich die Frage, ab welchem Punkt der Software-Entwicklung es nicht sinnvoller wäre, auf das Label "Islam" gänzlich zu verzichten - genau so wie wir weitgehend darauf verzichten, uns als Christen oder christliche Welt oder christliches Abendland zu bezeichnen und stattdessen lieber "westliche Zivilisation" oder "westliche Wertegemeinschaft" nennen. Wir sind uns bewusst, dass die "westlichen Werte" nicht einfach mit dem Christentum gleichgesetzt werden können, soviel christliches darin auch sein mag.
Will man der Avantgarde der Software-Denker glauben schenken, so scheint der Islam derzeit in das Stadium zu gelangen, in dem sich das Christentum bereits seit längerem befindet. Ideen, die bis in die Gegenwart hinein dem herkömmlichen Islam-Verständnis (und zumal seiner Dogmatik) fremd sind, werden unter Ausblendung der Widerstände mit dem Islam zusammengedacht.
So ist es möglich, von einem islamischen Feminismus zu reden oder den Islam so zu interpretieren, dass er mit der Trennung von Religion und Politik im Westen vereinbar ist, und so weiter. Alles das ist nicht falsch, es sind wertvolle Versuche, den Islam für unsere Zeit fit zu machen. Aber im Zuge dieser neuen Definitionen des Islam wird es immer schwieriger zu bestimmen, was der Islam eigentlich ist. Daher hat gleichzeitig auch die Gegenbewegung Konjunktur, der Fundamentalismus, der den Islam für alle Zeiten so festschreiben will, wie er vor über tausend Jahren in seiner Blütezeit angeblich einmal war.
Der Kampf der Kulturen ist so gesehen auch ein Kampf um eine neue Definition des Islam. Nicht nur wir, vor allem die Muslime selbst streiten darum, was der Islam eigentlich ist oder sein soll. Daher ist gegenüber all jenen Misstrauen angezeigt (gleich ob es sich um Muslime handelt oder nicht), die behaupten zu wissen, wie es sich mit dem Islam in Wahrheit verhält. Letztlich definieren sie den Islam dann nämlich nur in ihrem eigenen Sinne.
Uns selbst geht es übrigens nicht anders. Wer wüsste schon zu definieren, was der "Westen" seinem Wesen nach ist?
3
In gewissem Sinne hat der Westen den Kulturkampf schon gewonnen: Denn dieser Kampf ist auf das Terrain des Gegners getragen worden und richtet jetzt dort und nicht bei uns seine Verwüstungen an: Nicht nur wir im Westen, vor allem die Muslime selber streiten sich darum, was der Islam ist oder sein soll.
Versuchen wir einmal, den Spieß umzudrehen, und uns zu fragen, was der Westen ist, wer eigentlich "wir" sind. Ich habe nämlich den Verdacht, dass sich hinter dem Kampf um das richtige Bild vom Islam, besonders wenn er von westlichen Meinungsmachern und Medien geführt wird, ein Kampf um das richtige Bild vom Westen verbirgt. Mit anderen Worten: Wenn wir über den Islam streiten, streiten wir immer auch über unser eigenes Selbstverständnis; und in dem Maße, in dem wir uns vom anderen abgrenzen oder ihm gegenüber durchlässig sind, definieren wir uns selber.
Als zentral für unser Selbstverständnis in der Auseinandersetzung mit dem Islam hat sich mittlerweile der Begriff der Aufklärung erwiesen. Ein wenig überraschend, könnte man meinen. Noch vor zehn Jahren hätte kaum ein Hahn danach gekräht. Heutzutage jedoch ist die Behauptung, dass der Islam keine Aufklärung kenne, zum Kulturkampfargument par excellence avanciert, und zwar keineswegs nur unter Intellektuellen, sondern bis in die Leserbriefspalten der Zeitungen hinein. "Darf die Religionsfreiheit für Glaubensbekenntnisse gelten, welche die Errungenschaften der Aufklärung bekämpfen müssen, weil sie mit deren heiligen Schriften nicht vereinbar sind?" So hieß es kürzlich in einem Leserbrief zu einer Moscheebaudebatte in der Neuen Zürcher Zeitung vom 5.7.2008. Auch im Kölner Moscheenstreit ist offensichtlich geworden, dass für viele die Religionsfreiheit beim Islam aufhört oder eingeschränkt zu werden verdient - im Namen der Aufklärung!
Bleiben wir zunächst bei der Frage, ob es stimmt, dass der Islam keine Aufklärung kennt. Die Antwort hängt davon ab, wie man Aufklärung definiert. Wenn man sie auf die Phänomene begrenzt, die ihre Entstehung in Europa begleitet haben, wird man sich selbstverständlich schwer damit tun, Ähnliches in der islamischen Welt zu finden: Eine islamische Aufklärung würde unseren Ansprüchen nur dann genügen, wenn sie mit unserer quasi identisch wäre.
Mit der Engführung des Aufklärungsbegriffs auf ein rein europäisches Phänomen wird der Islam essentialistisch festgeschrieben: Der Islam ist dann eben das, was keine Aufklärung kennt - und mit ihm übrigens genauso jede andere außereuropäische Kultur. Der Zirkelschluss, der in einer solchen Aussage liegt, ist so offensichtlich, dass er leicht übersehen wird. Denn wenn man Aufklärung als das definiert, was in Europa entstanden ist, braucht man außerhalb Europas nicht danach zu suchen. Sucht man eine Aufklärung außerhalb von Europa, muss man zugestehen, dass es eine Art Aufklärung geben könnte, die sich nicht einfach auf die Trennung von Staat und Religion oder die Religionskritik ganz allgemein reduzieren lässt.
Dabei ist die Aufklärung selbst gemäß ihren Ursprüngen im Europa des 18. Jahrhunderts weitaus mehr als eine bloße Religionskritik. Nach dem vielzitierten Wort von Kant ist Aufklärung "der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen." Obwohl auch Kant auf eine Religionskritik abzielt und ein Ausweg aus der Unmündigkeit auf Grundlage der Religion bei ihm nicht vorgesehen ist, erweist sich seine Definition von Aufklärung bei genauem Hinschauen als eine Ethik der Selbstkritik.
Nur wenn man die Aufklärung auf Religionskritik reduziert, taugt sie als Instrument im Kulturkampf gegen den Islam, und dann liegen die folgenden, verheerenden Schlüsse nah: Der Islam kennt keine Aufklärung. Folglich sind die Muslime unmündig. Folglich brauchen sie einen Vormund. Es ist diese Logik, die die Vorherrschaft der europäischen Kolonialmächte ebenso gerechtfertigt hat wie heute die amerikanisch-europäische Vormundschaft in Irak und Afghanistan.
Auf die Gefahren die ein solcher oberflächlicher und verselbständigter Aufklärungsbegriff mit sich bringen kann, haben kurz nach dem Zweiten Weltkrieg Horkheimer und Adorno in ihrer berühmten Schrift "Dialektik der Aufklärung" hingewiesen. Wer den Westen und die eigene Position umstandslos mit der Aufklärung gleichsetzt, verdrängt zudem die bis weit ins zwanzigste Jahrhundert gerade nicht von Aufklärung zeugende Geschichte Europas.
Dabei müssen wir gar nicht in die intellektuellen Tiefen von Adornos "Kritischer Theorie" abtauchen, um die Vorstellung, wir seien die Aufgeklärten, die anderen hingegen unaufgeklärt, als einigermaßen selbstgefällig zu entlarven. Es genügt, einen zweiten Blick in Kants Aufklärungsschrift zu werfen. Dort heißt es, und ich erlaube mir, zur Betonung der Aktualität, zwei leicht erkennbare Halbsätze hinzuzufügen: "Es ist so bequem, unmündig zu sein. Habe ich ein Buch, das für mich Verstand hat, einen Fernseher, der für mich quasselt, einen Seelsorger, der für mich Gewissen hat, einen Analytiker, der über mich nachdenkt, einen Arzt, der für mich die Diät beurteilt, u.s.w.: so brauche ich mich ja nicht selbst zu bemühen. Ich habe nicht nötig zu denken, wenn ich nur bezahlen kann; andere werden das verdrießliche Geschäft schon für mich übernehmen."
So Kant, und was von diesen Unmündigkeiten auch heute noch auf uns zutrifft, wird jeder am besten für sich selbst beantworten können. Wagen wir daher die Behauptung, dass die Verwendung des Begriffs Aufklärung in interkulturellen Zusammenhängen heller Unsinn ist. Im Namen der Aufklärung kann man nämlich alles und jeden kritisieren, den Islam ebenso wie den Papst, die Indianer ebenso wie den Nachbarn - oder, was im Sinne der Aufklärung am besten wäre, sich selbst.
Ob es uns passt oder nicht, das bedeutet: Die Versuche, uns gegen den Islam abzugrenzen, und sei es mit einer so schönen Idee wie der Aufklärung, helfen uns nicht dabei, zu verstehen, wer wir im Westen eigentlich sind. In dieser Unmöglichkeit, uns selbst und den anderen anhand von Schlagwörtern zu definieren, liegt aber zugleich ein großer Trost. Wenn wir nur darauf verzichten, uns immer abgrenzen zu wollen, müssen wir auch nicht mehr verstehen, wer wir sind. Wir sind dann einfach alle.
4
Der laufende Kulturkampf mit dem Islam artikuliert ein Bedürfnis nach Abgrenzung von den anderen. Wir versuchen zu definieren, wer wir sind, indem wir sagen, was wir nicht sind, nämlich Muslime. Erst in jüngerer Zeit ist dieses Bild, das die Beziehungen zwischen Ost und West seit jeher bestimmt hat, ins Wanken geraten: Denn immer mehr Muslime sind heutzutage ein nicht mehr wegzudenkender Bestandteil der westlichen Gesellschaften. Wenn sich im Westen bei der Frage, wer wir sind, etwas bewegt und wenn wir die Muslime nicht mehr einfach von uns ausschließen können, heißt dies jedoch nicht, dass es der Mehrheit der Muslime genauso geht. Im Gegenteil können wir davon ausgehen, dass eine Kultur wie der Islam je eher das Bedürfnis nach Abgrenzung verspürt, desto stärker sie sich bedroht fühlt und desto größer der Druck zur Verschmelzung mit anderen Kulturen wird.
Der Islam hat für diese Abgrenzung zwei wesentliche Mittel: Zum einen das Verbot, von der Religion abzufallen - ein Austritt aus dem Islam ist nicht vorgesehen, es gibt keine Regularien dafür, und wer seinen Abfall vom Islam erklärt, gilt als vogelfrei und todeswürdig. Andererseits hält der Islam das Mittel bereit, Muslime zu exkommunizieren, das heißt, sie für ungläubig und vogelfrei zu erklären. Man darf also aus dem Islam nicht austreten, doch man kann rausgeschmissen werden. Natürlich war es im Christentum die meiste Zeit nicht anders; heute jedoch kennen wir diese Problematik nur vom Islam.
Dieser Umgang mit Abtrünnigen wirft vielfältige Probleme auf, innerislamische, aber eben auch interkulturelle. Vor allem widerspricht er dem Artikel 18 der UN-Menschenrechtscharta, der die Religionsfreiheit festschreibt. Da die Identifikation mit den Menschenrechten zum westlichen Selbstverständnis zählt, ist der Streit um die Religionsfreiheit einer der Knackpunkte im Kulturkampf.
Anders als bei vielen anderen Konflikten zwischen Westen und Islam kann man gegenüber der islamischen Einschränkung der Religionsfreiheit kaum Toleranz walten lassen. Dies gilt besonders angesichts der Tatsache, dass der Austritt aus dem Islam nicht nur symbolisch verpönt ist, sondern tatsächlich schwer geahndet wird, ja schon zum Mord an Abtrünnigen geführt hat. Hinzu kommt, dass die Exkommunikation, arabisch Takfir, heutzutage selten von anerkannten religiösen Autoritäten, sondern von muslimischen Fanatikern nach dem Willkürprinzip ausgesprochen wird: So kann es vorkommen, dass jeder Muslim, der nicht mit den Ideen einer bestimmten Gruppe von Fanatikern einverstanden ist, von diesen für ungläubig erklärt und exkommuniziert wird. Sayyid Qutb, der 1966 hingerichtete Vordenker der Islamisten, erklärte den ganzen modernen ägyptischen Staat in Bausch und Bogen für heidnisch. Die Attentäter, die 1981 den ägyptischen Präsidenten Anwar as-Sadat umbrachten, beriefen sich auf Qutb und fanden Unterstützer in radikalen Bewegungen, die das Wort Takfir im Namen trugen.
Die Einschränkung der Religionsfreiheit betrifft also nicht nur die Muslime, die von sich aus ihren Austritt aus dem Islam erklären möchten, sondern auch jene, denen ein ungläubiger Akt unterstellt wird, wie etwa Sadat, weil er mit Israel Frieden geschlossen hatte. Bisweilen genügt es, den Koran modern zu interpretieren, um von Fundamentalisten für ungläubig erklärt zu werden. Das Apostasie-Verbot öffnet der Unterdrückung Andersmeinender Tür und Tor, und man sollte von den islamischen Gelehrten, Würdenträgern und sonstigen Autoritäten in diesem Punkt eine Korrektur der Tradition und ihrer mißbräuchlichen Auslegung erwarten dürfen. Somit erscheint es an diesem Punkt besonders sinnvoll, Druck auf die Vertreter des Islam auszuüben, medial, politisch, in Texten, Büchern, Talkshows, auf Podien.
Die Frage der Religionsfreiheit ist zugleich ein Paradebeispiel dafür, wo der Kampf der Kulturen als Wettstreit der besseren Ideen produktiv wird, und wo es geradezu angeraten ist, ihn zu führen. In dem Maße, wie der kulturkämpferische Druck auf den Islam zum Beispiel in der Frage nach dem Umgang mit Abtrünnigen erhöht wird, geraten die Vertreter des offiziellen Islams in eine Rechtfertigungsnot, die auf längere Sicht das Bewußtsein für die Problematik der Überlieferung schärfen wird und somit einen innerislamischen Bewußtseinswandel mitbewirken kann.
Wichtig wäre dabei jedoch, nicht gleich mit Maximalforderungen nach absoluter Religionsfreiheit an den Islam heranzutreten. Dies dürfte eher eine Trotzreaktion bewirken. Denn dass sich die offiziellen Vertreter des Islam in absehbarer Zeit explizit gegen das Verbot, aus dem Islam auszutreten, und für die absolute Religionsfreiheit aussprechen, steht selbst bei großem Druck aus dem Westen nicht zu erwarten. Dafür sind die Tradition und die Scharia zu sakrosankt.
Berechtigterweise kann man jedoch eine pragmatische Haltung und liberale Auslegung der althergebrachten Vorschriften einfordern. Vielfach geschieht das übrigens schon. Ein großer Teil der Muslime in der westlichen Welt, aber auch eine Minderheit in der islamischen, haben mit ihrer Religion genauso wenig zu tun wie ein gebürtiger Christ, der sich für die Religion nicht interessiert und aus der Kirche austritt. Nur dass man eben offiziell aus dem Islam nicht austreten kann, so dass der Abfall von der Religion gar nicht statistisch feststellbar ist. Aber solange ein Muslim seine Distanz zur Religion nicht an die große Glocke hängt, wird dies mittlerweile auch in den islamischen Ländern toleriert, selbst in Saudi-Arabien, wo die Religionspolizei noch vor wenigen Jahren die Betenden mit dem Knüppel zusammengetrieben hat.
Es besteht also die Hoffnung, dass vom strengen islamischen Verbot, die Religion aufzugeben, eines Tages nichts als eine leere Worthülse bleibt. Über das tägliche Verhalten und den tatsächlichen Glauben des Einzelnen entscheiden am Ende sowieso nicht Dekrete, Traditionen oder Gesetze, sondern das Streben nach Glück, die Aussicht auf das bessere Leben in der Wirklichkeit. Der Westen verspricht ein solches besseres Leben bereits im Diesseits und in der Gegenwart, und zwar allen Menschen, nicht nur denen im Westen. Dieses Versprechen ist schön, aber sehr riskant. Denn anders als das jenseitige Heilsversprechen der Religionen muß die Verheißung eines besseren diesseitigen Lebens an der Wirklichkeit gemessen werden.
Ob und in welchem Maß der Westen sein Versprechen halten kann: Davon hängt ab, in wieweit es für die Muslime lohnenswert scheint, sich dem Westen anzunähern. Betrachtet man die gegenwärtige Weltlage und das offensichtliche Abgrenzungsbedürfnis vieler Muslime, sieht es so aus, als sei das nicht sehr lohnenswert für sie. Offensichtlich trauen sie dem Westen nicht.
Es wäre an der Zeit, uns zu fragen, warum.
---------------------------------------------------------
Stefan Weidner, geb. 1967, lebt als Autor, Übersetzer und Chefredakteur einer auf arabisch, persisch und englisch erscheinenden Kulturzeitschrift in Köln. Für seine Übersetzungen arabischer Gedichte bekam er 2007 den Johann-Heinrich-Voß Preis der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung, für seinen erzählten Essay "Mohammedanische Versuchungen" den Clemens-Brentano-Preis der Stadt Heidelberg 2006. Im Oktober erscheint von ihm im Verlag der Weltreligionen "Manual für den Kampf der Kulturen. Warum der Islam eine Herausforderung ist".
Gibt es überhaupt einen Kampf der Kulturen? Trotz der heftig geführten Islamdebatten, trotz der Kriege in Irak, Afghanistan und um die israelischen Grenzen, scheint es, als wäre der Kampf der Kulturen vor allem ein Streit um den Begriff des Kulturkampfs selber. Besonders im moderaten, islamfreundlichen Lager und unter professionellen Beschwichtigern wird immer wieder betont, dass es diesen Kampf in Wahrheit nicht gäbe. Das klingt so, als sei der Kampf der Kulturen eine bloße Frage der Abstimmung.
Nur dürfte der Kampf der Kulturen nicht deshalb aufhören, weil man inständig behauptet, es gebe ihn nicht. So sehr ich nachvollziehen kann, dass man gegen den Kulturkampf ist, wäre es sehr gewagt, aus der Ablehnung des Kulturkampfs zu schließen, dass es überhaupt keinen gibt. Ich glaube sogar, dass eine solche Annahme selbst im Sinne der Gegner eines Kulturkampfes kontraproduktiv ist. Von der Auseinandersetzung mit realen Problemen - wie gehen die westlichen Gesellschaften mit den Muslimen und dem Islam um - verschiebt sich die Front auf das Gebiet der bloßen Meinung darüber, ob angesichts dieser Probleme das Wort "Kampf" angebracht ist.
Dabei ist die Rede vom Kampf der Kulturen erst einmal nichts als eine Übersetzung des vom amerikanischen Politikwissenschaftler Samuel Huntington popularisierten Begriffs eines "Clash of Civilisations", eines Zusammenstoßes oder einer Kollision der Zivilisationen. Die Übersetzung als "Kampf der Kulturen" vergröbert die ursprüngliche Idee, aber sie ist zupackend und sie hat den Vorteil einer leicht über die Zunge gehenden Alliteration, die etwas verknüpft, was sich normalerweise diametral entgegensteht, Kampf und Kultur. Doch was ist so abschreckend an dieser Verknüpfung? Zuzugestehen, dass es einen Kampf der Kulturen gibt, heißt ja weder, diesen Kampf gut zu finden, noch dass es keine Alternativen zu ihm gäbe. Und warum sollte gleichzeitig zu diesem Kampf nicht auch eine Hochzeit der Kulturen zu vermelden sein?
Man muss die Rede vom Kampf der Kulturen nicht zwangsläufig mit Blutvergießen assoziieren. Die Metapher gibt weitaus mehr her, als man im allgemeinen zuzugestehen bereit ist. Statt eines Gemetzels erblicke ich darin die Konkurrenz der Ideen, den Wettstreit auf symbolischen Ebenen. Man könnte auch an einen Kampf der Worte denken wie in einem Gerichtsprozess, mit permanenten Plädoyers vor den Geschworenen der Weltöffentlichkeit. Oder an einen Wettbewerb der kulturellen Ideen im weitesten Sinne: politisch, sozial, ökonomisch, religiös oder weltanschaulich, sofern wir darunter mehr verstehen als eine streng definierte Konfession oder Ideologie.
Wer sich mit der simplen Feststellung begnügt, den Kampf gebe es nicht, setzt sich überdies dem Verdacht aus, einem Wettbewerb der Ideen um das bessere Leben die Grundlage zu entziehen. Er muss sich vorwerfen lassen, auch das Gespräch nicht zu wollen und die Differenz zu leugnen, die dieses Gespräch erst antreibt. Man könnte ihm unterstellen, die Unterschiede glattbügeln zu wollen oder am Ende seine eigene, jedoch unausgesprochene, der Auseinandersetzung entzogene Sicht als letztgültige hinzustellen. Eine solche Haltung, gepflegt von Kolumnisten, Politikern, Geistlichen und anderen Schönrednern aller Lager ist zumindest bevormundend. Im schlimmsten Fall diskreditiert sie jede alternative Position als potentielle Kriegstreiberei. So heißt es zum Beispiel in dem ansonsten nicht unlesenswerten Buch "Kampfabsage" von Ilija Trojanow und Ranjit Hoskote "Mit dem Schlagwort vom Kampf der Kulturen [?] wurden weltweit neue Feindbilder geschaffen und Konflikte geschürt". Abgesehen davon, dass es die Feindbilder und Konflikte schon vor Huntington gab, könnte man das glatte Gegenteil behaupten: Denn erst das Schlagwort vom Kampf der Kulturen hat im Westen die Aufmerksamkeit auf andere Kulturen gelenkt und damit einen intensiveren Austausch als je zuvor ermöglicht.
Selbst wenn man die kulturellen Unterschiede nicht betonen will: ohne Kampf gibt es keine Verschmelzung. Wenig spricht für die Annahme, dass die Mehrzahl der Menschen von alleine und freiwillig Anregungen bei anderen Kulturen sucht. Einzelne vielleicht; Kollektive sind schwerfällig. Wer für eine Vermischung der Kulturen ist, für wechselseitige Bereicherung plädiert, wird die Auseinandersetzung nicht nur nicht ausschließen und scheuen dürfen, er wird sie als Motor der Verschmelzung anerkennen. Halten wir daher fest, dass der Kampf der Kulturen kein Feind ist, sondern ein Freund, wenngleich einer, der manchmal cholerisch sein kann, und der, wenn er zuviel getrunken hat oder sich in die Ecke gedrängt fühlt, gerne auch einmal zuschlägt. Um so wichtiger ist es, ihn an die Hand zu nehmen und mit ihm zu reden, statt ihn als Buhmann in die Ecke zu stellen.
Der Kulturkampf ist der Kampf um das Bild von der Welt, das uns richtig scheint. Jeder kann sich dabei täuschen. Das tragischste Szenario besteht darin, den Kampf um das Bild zu gewinnen, um dann irgendwann feststellen zu müssen - und diese Erkenntnis setzt sich selten gewaltlos durch -, dass es das falsche war oder im Lauf der Zeiten zu einem falschen geworden ist. Unlängst ist dies die Erfahrung des Kommunismus gewesen. Es könnte morgen die Erfahrung des fundamentalistischen Islam sein, wenn es ihm gelingen sollte, den Kampf um die Herzen der Muslime zu gewinnen. Es könnte übermorgen die Erfahrung eines entfesselten, zu keinen Rücksichten mehr gezwungenen Westens werden.
Nicht der Kulturkampf ist schlecht. Schlecht ist es nur, wenn er einen allzu klaren Sieger hat.
2
Bei den meisten Versuchen, den Islam zu definieren, lassen sich zwei grundsätzliche Tendenzen ausmachen, eine harte und eine weiche Definition. "Hart" und "weich" ist hier wörtlich zu nehmen. Wenn man es in Begriffen der Computersprache beschreibt, wird der Unterschied am deutlichsten: Die einen begreifen den Islam als Software, die anderen als Hardware. In die Software kann man eingreifen, man kann sie ändern, entwickeln, fortschreiben, anpassen, modernisieren. Die Hardware ist festgelegt; Manipulationen sind nur in geringem Maße möglich. Wenn sie den Anforderungen nicht mehr genügt, muss man sie austauschen und die alte auf den Müll schmeißen - den Müllhaufen der religiösen Ideen.
Legt man diese harte Definition zugrunde, erscheint der Islam in den Augen seiner Gegner als einer dieser urzeitlichen Homecomputer, für die man noch Floppy-Discs als Speichermedium benutzte. Es versteht sich, dass darauf die Programme "Aufklärung und Moderne" wenn überhaupt, nur sehr langsam laufen, von häufigen Abstürzen begleitet.
Aber die Hardware-Theorie lässt sich auch zugunsten des Islam verwenden. Unter den muslimischen Anhängern dieser Vorstellung, meist Fundamentalisten, wird der Islam als eine Art Supercomputer verstanden. Eventuelle Macken und Probleme sind auf unsachgemäße (sprich: unislamische) Bedienung zurückzuführen: Der Mensch ist fehlbar, nicht die Maschine.
In den Islamwissenschaften wird die harte Definition häufig essentialistisch genannt. Essentialistisch meint: Der Islam habe einen unveränderlichen Wesenskern, eine Essenz. Diese Position hat eine schwerwiegende Konsequenz. Bestimmte Elemente gehören demnach so wesensgemäß zum Islam, dass dieser ohne sie nicht denkbar ist, also kein "richtiger", "echter" Islam mehr wäre. Der Essentialist sagt zum Beispiel, dass die Scharia, also das islamische Recht, und die Demokratie unvereinbar seien. Und wenn Muslime dann das islamische Recht der Demokratie unterwerfen, sind sie eben keine richtigen, echten Muslime mehr, sondern verwestlicht. Ein Kennzeichen des Essentialismus ist, dass sich westliche Orientalisten und islamische Fundamentalisten in der Sache verblüffend einig sind, während sie sich in der Wertung deutlich unterscheiden. Für beide hat der Islam dieselbe Essenz, nur dass die Fundamentalisten sie für gut halten, die Orientalisten für problematisch.
Für Nicht-Essentialisten, also diejenigen, die den Islam als Software erachten, ist "Islam" nur ein Oberbegriff für sehr vielgestaltige Phänomene. Manche Theoretiker dieser Schule halten eine Beschreibung des Islam (oder des Orients) als solchen für unmöglich und lehnen sie grundsätzlich ab. Anderen genügt es, festzuhalten, dass der Islam interpretier- und wandelbar ist und dass immer weitere Abweichungen vom ursprünglichen Quellcode denkbar sind. Gemäß diesen Vorstellungen sind zum Beispiel Scharia und Demokratie zu vereinbaren, weil die Scharia als etwas Wandelbares verstanden wird.
Diese weiche Sichtweise auf den Islam hat eine substantielle Schwäche. Dem, was sie unter Islam versteht, sind keinerlei Grenzen auferlegt. Um in der Computerterminologie zu bleiben, besagt dies, dass das Software-Modell nicht einmal eine Änderung des Quellcodes ausschließt. Dies jedoch würde bedeuten, dass der Islam Formen annehmen kann, die mit keiner seiner historischen Manifestationen notwendig etwas zu tun haben müssen, und es stellt sich die Frage, ab welchem Punkt der Software-Entwicklung es nicht sinnvoller wäre, auf das Label "Islam" gänzlich zu verzichten - genau so wie wir weitgehend darauf verzichten, uns als Christen oder christliche Welt oder christliches Abendland zu bezeichnen und stattdessen lieber "westliche Zivilisation" oder "westliche Wertegemeinschaft" nennen. Wir sind uns bewusst, dass die "westlichen Werte" nicht einfach mit dem Christentum gleichgesetzt werden können, soviel christliches darin auch sein mag.
Will man der Avantgarde der Software-Denker glauben schenken, so scheint der Islam derzeit in das Stadium zu gelangen, in dem sich das Christentum bereits seit längerem befindet. Ideen, die bis in die Gegenwart hinein dem herkömmlichen Islam-Verständnis (und zumal seiner Dogmatik) fremd sind, werden unter Ausblendung der Widerstände mit dem Islam zusammengedacht.
So ist es möglich, von einem islamischen Feminismus zu reden oder den Islam so zu interpretieren, dass er mit der Trennung von Religion und Politik im Westen vereinbar ist, und so weiter. Alles das ist nicht falsch, es sind wertvolle Versuche, den Islam für unsere Zeit fit zu machen. Aber im Zuge dieser neuen Definitionen des Islam wird es immer schwieriger zu bestimmen, was der Islam eigentlich ist. Daher hat gleichzeitig auch die Gegenbewegung Konjunktur, der Fundamentalismus, der den Islam für alle Zeiten so festschreiben will, wie er vor über tausend Jahren in seiner Blütezeit angeblich einmal war.
Der Kampf der Kulturen ist so gesehen auch ein Kampf um eine neue Definition des Islam. Nicht nur wir, vor allem die Muslime selbst streiten darum, was der Islam eigentlich ist oder sein soll. Daher ist gegenüber all jenen Misstrauen angezeigt (gleich ob es sich um Muslime handelt oder nicht), die behaupten zu wissen, wie es sich mit dem Islam in Wahrheit verhält. Letztlich definieren sie den Islam dann nämlich nur in ihrem eigenen Sinne.
Uns selbst geht es übrigens nicht anders. Wer wüsste schon zu definieren, was der "Westen" seinem Wesen nach ist?
3
In gewissem Sinne hat der Westen den Kulturkampf schon gewonnen: Denn dieser Kampf ist auf das Terrain des Gegners getragen worden und richtet jetzt dort und nicht bei uns seine Verwüstungen an: Nicht nur wir im Westen, vor allem die Muslime selber streiten sich darum, was der Islam ist oder sein soll.
Versuchen wir einmal, den Spieß umzudrehen, und uns zu fragen, was der Westen ist, wer eigentlich "wir" sind. Ich habe nämlich den Verdacht, dass sich hinter dem Kampf um das richtige Bild vom Islam, besonders wenn er von westlichen Meinungsmachern und Medien geführt wird, ein Kampf um das richtige Bild vom Westen verbirgt. Mit anderen Worten: Wenn wir über den Islam streiten, streiten wir immer auch über unser eigenes Selbstverständnis; und in dem Maße, in dem wir uns vom anderen abgrenzen oder ihm gegenüber durchlässig sind, definieren wir uns selber.
Als zentral für unser Selbstverständnis in der Auseinandersetzung mit dem Islam hat sich mittlerweile der Begriff der Aufklärung erwiesen. Ein wenig überraschend, könnte man meinen. Noch vor zehn Jahren hätte kaum ein Hahn danach gekräht. Heutzutage jedoch ist die Behauptung, dass der Islam keine Aufklärung kenne, zum Kulturkampfargument par excellence avanciert, und zwar keineswegs nur unter Intellektuellen, sondern bis in die Leserbriefspalten der Zeitungen hinein. "Darf die Religionsfreiheit für Glaubensbekenntnisse gelten, welche die Errungenschaften der Aufklärung bekämpfen müssen, weil sie mit deren heiligen Schriften nicht vereinbar sind?" So hieß es kürzlich in einem Leserbrief zu einer Moscheebaudebatte in der Neuen Zürcher Zeitung vom 5.7.2008. Auch im Kölner Moscheenstreit ist offensichtlich geworden, dass für viele die Religionsfreiheit beim Islam aufhört oder eingeschränkt zu werden verdient - im Namen der Aufklärung!
Bleiben wir zunächst bei der Frage, ob es stimmt, dass der Islam keine Aufklärung kennt. Die Antwort hängt davon ab, wie man Aufklärung definiert. Wenn man sie auf die Phänomene begrenzt, die ihre Entstehung in Europa begleitet haben, wird man sich selbstverständlich schwer damit tun, Ähnliches in der islamischen Welt zu finden: Eine islamische Aufklärung würde unseren Ansprüchen nur dann genügen, wenn sie mit unserer quasi identisch wäre.
Mit der Engführung des Aufklärungsbegriffs auf ein rein europäisches Phänomen wird der Islam essentialistisch festgeschrieben: Der Islam ist dann eben das, was keine Aufklärung kennt - und mit ihm übrigens genauso jede andere außereuropäische Kultur. Der Zirkelschluss, der in einer solchen Aussage liegt, ist so offensichtlich, dass er leicht übersehen wird. Denn wenn man Aufklärung als das definiert, was in Europa entstanden ist, braucht man außerhalb Europas nicht danach zu suchen. Sucht man eine Aufklärung außerhalb von Europa, muss man zugestehen, dass es eine Art Aufklärung geben könnte, die sich nicht einfach auf die Trennung von Staat und Religion oder die Religionskritik ganz allgemein reduzieren lässt.
Dabei ist die Aufklärung selbst gemäß ihren Ursprüngen im Europa des 18. Jahrhunderts weitaus mehr als eine bloße Religionskritik. Nach dem vielzitierten Wort von Kant ist Aufklärung "der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen." Obwohl auch Kant auf eine Religionskritik abzielt und ein Ausweg aus der Unmündigkeit auf Grundlage der Religion bei ihm nicht vorgesehen ist, erweist sich seine Definition von Aufklärung bei genauem Hinschauen als eine Ethik der Selbstkritik.
Nur wenn man die Aufklärung auf Religionskritik reduziert, taugt sie als Instrument im Kulturkampf gegen den Islam, und dann liegen die folgenden, verheerenden Schlüsse nah: Der Islam kennt keine Aufklärung. Folglich sind die Muslime unmündig. Folglich brauchen sie einen Vormund. Es ist diese Logik, die die Vorherrschaft der europäischen Kolonialmächte ebenso gerechtfertigt hat wie heute die amerikanisch-europäische Vormundschaft in Irak und Afghanistan.
Auf die Gefahren die ein solcher oberflächlicher und verselbständigter Aufklärungsbegriff mit sich bringen kann, haben kurz nach dem Zweiten Weltkrieg Horkheimer und Adorno in ihrer berühmten Schrift "Dialektik der Aufklärung" hingewiesen. Wer den Westen und die eigene Position umstandslos mit der Aufklärung gleichsetzt, verdrängt zudem die bis weit ins zwanzigste Jahrhundert gerade nicht von Aufklärung zeugende Geschichte Europas.
Dabei müssen wir gar nicht in die intellektuellen Tiefen von Adornos "Kritischer Theorie" abtauchen, um die Vorstellung, wir seien die Aufgeklärten, die anderen hingegen unaufgeklärt, als einigermaßen selbstgefällig zu entlarven. Es genügt, einen zweiten Blick in Kants Aufklärungsschrift zu werfen. Dort heißt es, und ich erlaube mir, zur Betonung der Aktualität, zwei leicht erkennbare Halbsätze hinzuzufügen: "Es ist so bequem, unmündig zu sein. Habe ich ein Buch, das für mich Verstand hat, einen Fernseher, der für mich quasselt, einen Seelsorger, der für mich Gewissen hat, einen Analytiker, der über mich nachdenkt, einen Arzt, der für mich die Diät beurteilt, u.s.w.: so brauche ich mich ja nicht selbst zu bemühen. Ich habe nicht nötig zu denken, wenn ich nur bezahlen kann; andere werden das verdrießliche Geschäft schon für mich übernehmen."
So Kant, und was von diesen Unmündigkeiten auch heute noch auf uns zutrifft, wird jeder am besten für sich selbst beantworten können. Wagen wir daher die Behauptung, dass die Verwendung des Begriffs Aufklärung in interkulturellen Zusammenhängen heller Unsinn ist. Im Namen der Aufklärung kann man nämlich alles und jeden kritisieren, den Islam ebenso wie den Papst, die Indianer ebenso wie den Nachbarn - oder, was im Sinne der Aufklärung am besten wäre, sich selbst.
Ob es uns passt oder nicht, das bedeutet: Die Versuche, uns gegen den Islam abzugrenzen, und sei es mit einer so schönen Idee wie der Aufklärung, helfen uns nicht dabei, zu verstehen, wer wir im Westen eigentlich sind. In dieser Unmöglichkeit, uns selbst und den anderen anhand von Schlagwörtern zu definieren, liegt aber zugleich ein großer Trost. Wenn wir nur darauf verzichten, uns immer abgrenzen zu wollen, müssen wir auch nicht mehr verstehen, wer wir sind. Wir sind dann einfach alle.
4
Der laufende Kulturkampf mit dem Islam artikuliert ein Bedürfnis nach Abgrenzung von den anderen. Wir versuchen zu definieren, wer wir sind, indem wir sagen, was wir nicht sind, nämlich Muslime. Erst in jüngerer Zeit ist dieses Bild, das die Beziehungen zwischen Ost und West seit jeher bestimmt hat, ins Wanken geraten: Denn immer mehr Muslime sind heutzutage ein nicht mehr wegzudenkender Bestandteil der westlichen Gesellschaften. Wenn sich im Westen bei der Frage, wer wir sind, etwas bewegt und wenn wir die Muslime nicht mehr einfach von uns ausschließen können, heißt dies jedoch nicht, dass es der Mehrheit der Muslime genauso geht. Im Gegenteil können wir davon ausgehen, dass eine Kultur wie der Islam je eher das Bedürfnis nach Abgrenzung verspürt, desto stärker sie sich bedroht fühlt und desto größer der Druck zur Verschmelzung mit anderen Kulturen wird.
Der Islam hat für diese Abgrenzung zwei wesentliche Mittel: Zum einen das Verbot, von der Religion abzufallen - ein Austritt aus dem Islam ist nicht vorgesehen, es gibt keine Regularien dafür, und wer seinen Abfall vom Islam erklärt, gilt als vogelfrei und todeswürdig. Andererseits hält der Islam das Mittel bereit, Muslime zu exkommunizieren, das heißt, sie für ungläubig und vogelfrei zu erklären. Man darf also aus dem Islam nicht austreten, doch man kann rausgeschmissen werden. Natürlich war es im Christentum die meiste Zeit nicht anders; heute jedoch kennen wir diese Problematik nur vom Islam.
Dieser Umgang mit Abtrünnigen wirft vielfältige Probleme auf, innerislamische, aber eben auch interkulturelle. Vor allem widerspricht er dem Artikel 18 der UN-Menschenrechtscharta, der die Religionsfreiheit festschreibt. Da die Identifikation mit den Menschenrechten zum westlichen Selbstverständnis zählt, ist der Streit um die Religionsfreiheit einer der Knackpunkte im Kulturkampf.
Anders als bei vielen anderen Konflikten zwischen Westen und Islam kann man gegenüber der islamischen Einschränkung der Religionsfreiheit kaum Toleranz walten lassen. Dies gilt besonders angesichts der Tatsache, dass der Austritt aus dem Islam nicht nur symbolisch verpönt ist, sondern tatsächlich schwer geahndet wird, ja schon zum Mord an Abtrünnigen geführt hat. Hinzu kommt, dass die Exkommunikation, arabisch Takfir, heutzutage selten von anerkannten religiösen Autoritäten, sondern von muslimischen Fanatikern nach dem Willkürprinzip ausgesprochen wird: So kann es vorkommen, dass jeder Muslim, der nicht mit den Ideen einer bestimmten Gruppe von Fanatikern einverstanden ist, von diesen für ungläubig erklärt und exkommuniziert wird. Sayyid Qutb, der 1966 hingerichtete Vordenker der Islamisten, erklärte den ganzen modernen ägyptischen Staat in Bausch und Bogen für heidnisch. Die Attentäter, die 1981 den ägyptischen Präsidenten Anwar as-Sadat umbrachten, beriefen sich auf Qutb und fanden Unterstützer in radikalen Bewegungen, die das Wort Takfir im Namen trugen.
Die Einschränkung der Religionsfreiheit betrifft also nicht nur die Muslime, die von sich aus ihren Austritt aus dem Islam erklären möchten, sondern auch jene, denen ein ungläubiger Akt unterstellt wird, wie etwa Sadat, weil er mit Israel Frieden geschlossen hatte. Bisweilen genügt es, den Koran modern zu interpretieren, um von Fundamentalisten für ungläubig erklärt zu werden. Das Apostasie-Verbot öffnet der Unterdrückung Andersmeinender Tür und Tor, und man sollte von den islamischen Gelehrten, Würdenträgern und sonstigen Autoritäten in diesem Punkt eine Korrektur der Tradition und ihrer mißbräuchlichen Auslegung erwarten dürfen. Somit erscheint es an diesem Punkt besonders sinnvoll, Druck auf die Vertreter des Islam auszuüben, medial, politisch, in Texten, Büchern, Talkshows, auf Podien.
Die Frage der Religionsfreiheit ist zugleich ein Paradebeispiel dafür, wo der Kampf der Kulturen als Wettstreit der besseren Ideen produktiv wird, und wo es geradezu angeraten ist, ihn zu führen. In dem Maße, wie der kulturkämpferische Druck auf den Islam zum Beispiel in der Frage nach dem Umgang mit Abtrünnigen erhöht wird, geraten die Vertreter des offiziellen Islams in eine Rechtfertigungsnot, die auf längere Sicht das Bewußtsein für die Problematik der Überlieferung schärfen wird und somit einen innerislamischen Bewußtseinswandel mitbewirken kann.
Wichtig wäre dabei jedoch, nicht gleich mit Maximalforderungen nach absoluter Religionsfreiheit an den Islam heranzutreten. Dies dürfte eher eine Trotzreaktion bewirken. Denn dass sich die offiziellen Vertreter des Islam in absehbarer Zeit explizit gegen das Verbot, aus dem Islam auszutreten, und für die absolute Religionsfreiheit aussprechen, steht selbst bei großem Druck aus dem Westen nicht zu erwarten. Dafür sind die Tradition und die Scharia zu sakrosankt.
Berechtigterweise kann man jedoch eine pragmatische Haltung und liberale Auslegung der althergebrachten Vorschriften einfordern. Vielfach geschieht das übrigens schon. Ein großer Teil der Muslime in der westlichen Welt, aber auch eine Minderheit in der islamischen, haben mit ihrer Religion genauso wenig zu tun wie ein gebürtiger Christ, der sich für die Religion nicht interessiert und aus der Kirche austritt. Nur dass man eben offiziell aus dem Islam nicht austreten kann, so dass der Abfall von der Religion gar nicht statistisch feststellbar ist. Aber solange ein Muslim seine Distanz zur Religion nicht an die große Glocke hängt, wird dies mittlerweile auch in den islamischen Ländern toleriert, selbst in Saudi-Arabien, wo die Religionspolizei noch vor wenigen Jahren die Betenden mit dem Knüppel zusammengetrieben hat.
Es besteht also die Hoffnung, dass vom strengen islamischen Verbot, die Religion aufzugeben, eines Tages nichts als eine leere Worthülse bleibt. Über das tägliche Verhalten und den tatsächlichen Glauben des Einzelnen entscheiden am Ende sowieso nicht Dekrete, Traditionen oder Gesetze, sondern das Streben nach Glück, die Aussicht auf das bessere Leben in der Wirklichkeit. Der Westen verspricht ein solches besseres Leben bereits im Diesseits und in der Gegenwart, und zwar allen Menschen, nicht nur denen im Westen. Dieses Versprechen ist schön, aber sehr riskant. Denn anders als das jenseitige Heilsversprechen der Religionen muß die Verheißung eines besseren diesseitigen Lebens an der Wirklichkeit gemessen werden.
Ob und in welchem Maß der Westen sein Versprechen halten kann: Davon hängt ab, in wieweit es für die Muslime lohnenswert scheint, sich dem Westen anzunähern. Betrachtet man die gegenwärtige Weltlage und das offensichtliche Abgrenzungsbedürfnis vieler Muslime, sieht es so aus, als sei das nicht sehr lohnenswert für sie. Offensichtlich trauen sie dem Westen nicht.
Es wäre an der Zeit, uns zu fragen, warum.
---------------------------------------------------------
Stefan Weidner, geb. 1967, lebt als Autor, Übersetzer und Chefredakteur einer auf arabisch, persisch und englisch erscheinenden Kulturzeitschrift in Köln. Für seine Übersetzungen arabischer Gedichte bekam er 2007 den Johann-Heinrich-Voß Preis der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung, für seinen erzählten Essay "Mohammedanische Versuchungen" den Clemens-Brentano-Preis der Stadt Heidelberg 2006. Im Oktober erscheint von ihm im Verlag der Weltreligionen "Manual für den Kampf der Kulturen. Warum der Islam eine Herausforderung ist".
Kommentieren