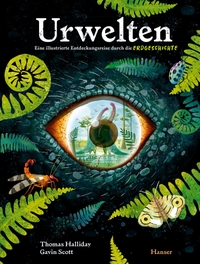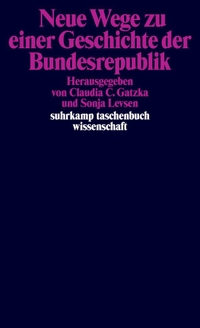Essay
Verteidigung der Gier
Von Gerhard Schulze
12.11.2009. Die Finanzkrise lässt moralische Instanzen wie Hans Küng gern nach Mäßigung rufen. Aber eine Gesellschaft, die auf Luxus verzichtet, wird nichts als Not produzieren Der nachstehende Text ist ein Auszug aus Gerhard Schulzes großem Essay "Gute Lebenswelten, böses System - eine Kritik populärer Deutungsmuster am Beispiel der Finanzkrise". Er ist erschienen in dem von Ulrike Ackermann herausgegebenen Buch "Freiheit in der Krise" im Verlag Humanities Online, Frankfurt 2009, 19,80 Euro. Das Buch erscheint in diesen Tagen. (D.REd.)
Der nachstehende Text ist ein Auszug aus Gerhard Schulzes großem Essay "Gute Lebenswelten, böses System - eine Kritik populärer Deutungsmuster am Beispiel der Finanzkrise". Er ist erschienen in dem von Ulrike Ackermann herausgegebenen Buch "Freiheit in der Krise" im Verlag Humanities Online, Frankfurt 2009, 19,80 Euro. Das Buch erscheint in diesen Tagen. (D.REd.)Das Ausmaß der Vertrauenskrise
Als die Banken noch für sicher galten, hatten sie kaum mehr Appeal als eine Behörde. Das Finanzsystem war etwas für Insider. Die Öffentlichkeit entrüstete sich über Gesten wie das Victory-Zeichen von Josef Ackermann und überließ das Tagesgeschäft den Experten. Freilich waren es ausgerechnet Experten, die vom Bankenbeben überrascht wurden. Ohne deren giergetriebenen Realitätsverlust, so meinten viele, hätte es keine Krise gegeben.
Im Moment der Destabilisierung geriet die bis dahin vom Finanzmarkt geschaffene jahrzehntelange Stabilität völlig in Vergessenheit. So ticken Menschen nun einmal: Sie ignorieren den Wert des Normalen, solange es störungsfrei funktioniert. Doch wenn das Normale aussetzt, reagieren sie wie jemand, der mit shampoonierten Haaren unter der Dusche steht, während plötzlich das Wasser abgedreht wird. Auch darin liegt freilich ein akzeptiertes Element moderner Normalität. Wenn man sich die Haare am Flussufer wäscht, statt sich von einem komplexen System abhängig zu machen, kann einem dieses Missgeschick nicht passieren.
Nachdem das Vertrauen in den Finanzmarkt weggeblasen war, stand sein Neuigkeits- und Skandalwert unversehens auf dem gleichen Niveau wie der Drogenkonsum eines Popstars. Mit grimmiger Ironie verfolgten die Menschen ein weltweites Drama mit ohnmächtigen Helden. Aber wer waren die Schurken? Der vergebliche Wunsch nach Schuldzuweisung und Genugtuung schlug um in die Erfahrung von Ohnmacht und Wut. Die einen konstatierten Systemversagen, die anderen Eliteversagen. Haften aber, soviel ist inzwischen allen klar, werden weder System noch Elite, sondern die Steuerzahler.
Allmählich enthüllte sich der Öffentlichkeit das Bild eines dramatischen ökonomischen Normalitätsbruchs, der sich vielleicht so tief im Gedächtnis einprägen wird wie die letzte Inflation und die Währungsreform 1948 in Westdeutschland. Damals freilich war sowohl das Problem klarer als auch die Lösung.
Auf der Suche nach Orientierung eigneten sich die Menschen Kenntnisse an, auf die sie gerne verzichtet hätten. Kleinanleger, die ihr Geld verloren hatten, wussten plötzlich, was Einlagensicherungsfonds sind. Neue Begriffe wurden geläufig: Giftige Papiere, Bad Banks, Bonuszahlungen, Konjunkturpakete, Systemrelevanz, Ratingagenturen.
Wer sich über diese Steigerung der ökonomischen Allgemeinbildung freute, sollte ihre Unfreiwilligkeit und Unvollständigkeit nicht vergessen. Fast schon zur Routine geworden, hantierte die Krisenrhetorik mit Notmaßnahmen, Symptombeschreibungen, Überlebenstipps und wohlfeilen Abgesängen. Der Markt habe versagt, die Aktie sei tot, der Kapitalismus am Ende, der Neoliberalismus blamiert, Europa kaputt, die Globalisierung vorbei. Niemand glaubte all das wirklich, aber woran sollte man glauben? Was blieb, war das kollektive Trauma einer Verletzung von Fairnessvorstellungen, verbunden mit einer Stimmungslage zwischen Galgenhumor, Fatalismus und Empörung.
Mit bloßem Wegducken, bis die Aufregung vorbei ist, wird sich die drohende Delegitimierung unserer Wirtschaftsordnung nicht aussitzen lassen. Alle ahnen, was kommen wird, aber wenige spüren es bereits. Selbst wenn es gut geht, die wirklich bitteren Zeiten stehen erst noch bevor. Sie bringen erst Deflation, dann Inflation, Staatsverschuldung, Arbeitslosigkeit, geringere Lebensqualität, geraubte Chancen und politische Verwerfungen mit ungewissem Ausgang. Die Vertrauenskrise ist umfassend, sie hat die Grenzen des Finanzmarkts übersprungen und führt zu fundamentalen Zweifeln.
Gier. Über die Untauglichkeit von Bußpredigten
In dieser Situation trat ein ewiger Wiedergänger auf, der Bußprediger. Er erscheint immer dann, wenn ohnmächtige Wut nach einem symbolischen Ausdruck sucht. Kleriker, Globalisierungsgegner, westliche Salonlinke und islamische Fundamentalisten reagierten mit ziemlich ähnlich lautenden Appellen auf die Krise. Die Gier sei an dem Desaster schuld. Muss man nicht einfach bloß endlich seine Augen aufmachen, um das zu erkennen?
Das erinnert an die Legende vom Heiligen Antonius von Padua. Als er die Kirche leer vorfand, ging er ans Meeresufer und predigte den Fischen. Andächtig hörten sie ihm zu. Aber was geschah dann? Die Antwort finden wir in einer Sammlung von Volksliedern, die Clemens Brentano und Achim von Arnim Anfang des 19. Jahrhunderts veröffentlichten. Dort heißt es in dem Lied über die Fischpredigt: "Die Predigt hat g'fallen, sie bleibe wie allen". Die Karpfen bleiben Karpfen, die Hechte bleiben Hechte, die Menschen bleiben Menschen. Die Fische hören zu, dann schwimmen sie wieder davon und machen das, was sie immer gemacht haben.
Stellen wir uns einmal vor, alle würden beherzigen, was etwa der weltbekannte Theologe Hans Küng in einem Zeitungskommentar Anfang 2009 geschrieben hat: "Statt einer unstillbaren Gier nach Geld, Prestige und Konsum ist wieder neu der Sinn für Maß und Bescheidenheit zu finden."
Wenn man darüber nachdenkt, was man braucht, um physisch und psychisch zu überleben, landet man beim täglichen Brot, ein paar Kleidungsstücken, einem Dach über dem Kopf, einem Fahrrad und einer Packung Tempotaschentücher. Seien wir großzügig. Nehmen wir noch ein ordentliches Bildungssystem mit dazu, medizinische Grundversorgung, fließendes Wasser, sanitäre Einrichtungen, Kanalisation, Elektrizität, Energiesparhäuser, Zeitungen, vielleicht auch einen ganz kleinen bescheidenen Computer, Internetzugang und ein Mobiltelefon.
Andererseits: Was alles brauchen wir nicht wirklich? Zum Beispiel Parfüm, Luxuskarossen, Hochglanzmagazine, Restaurants, Urlaub in Thailand, zwanzig verschiedene Deos im Supermarktregal, Golfplätze, Opernhäuser, Goldschmuck und Comedysendungen.
In der ersten Gruppe sind die notwendigen Güter zusammengefasst, in der zweiten die entbehrlichen. Ich führe nun ein Gedankenexperiment durch, das ich einer Versuchsanordnung von John Maynard Keynes nachgestellt habe. Keynes denkt über eine Insel namens Eden nach, auf der ausschließlich Bananen angebaut werden. In meinem Experiment treten an die Stelle der Bananen die notwendigen Güter. Auf meiner Insel Eden setzt die Regierung eins zu eins Hans Küngs Appell um, der Gier zu entsagen und bescheiden zu werden. Es werden nur noch notwendige Güter hergestellt, alle entbehrlichen Güter werden weggelassen. Die Frage ist: Was wird dann geschehen?
Es wird alles zusammenbrechen. In kurzer Frist wird es auch keine notwendigen Güter mehr geben. Warum ist das so? Stellen wir uns nur einmal vor, jemand müsse in Eden ein notwendiges Gut bezahlen, beispielsweise seine Stromrechnung. Wenn man den Dingen auf den Grund geht, ist dies nichts anderes als Tausch, denn hinter dem Geld stehen die in einer gegebenen Wirtschaftsperiode erzeugten Werte, sonst wäre das Geld nichts als heiße Luft. Indem man bezahlt, tauscht man Elektrizität gegen Brot gegen Wärmedämmungen gegen öffentlichen Nahverkehr gegen Bildung gegen medizinische Grundversorgung und so weiter. Nur die entbehrlichen Güter sind im Gedankenexperiment vom Tausch ausgeschlossen, denn es werden ja keine hergestellt.
Aber wo sollen die Normalbürger ihre Tauschmittel dann hernehmen? Die meisten von ihnen haben keine Arbeit, denn um die notwendigen Güter zu produzieren, genügen einige wenige. Wer nicht arbeitet, hat auch kein Geld und kann sich folglich selbst die notwendigen Güter nicht leisten. Weil somit die Nachfrage ausbleibt, liegt bald auch die Produktion der notwendigen Güter am Boden.
Jetzt müssen die Menschen hungern, frieren und an Krankheiten zugrunde gehen, die eigentlich heilbar wären. Aber könnten die Bedürftigen das Geld nicht einfach von den Reichen und vom Staat bekommen? Nein, nicht in Eden. Es gibt ja keine Reichen, und der Staat ist bankrott. Auch der Weg des Römischen Reichs käme für Küngsland nicht in Betracht. Dort beruhte die Wirtschaft auf Sklaverei und Ausbeutung der Kolonien. Als die Ausbeutungsökonomie ausgereizt war und die antike Wirtschaft zusammenbrach, verkamen die Städte, die Straßen, die Aquädukte, und der Lebensstandard fiel auf das Niveau der feudalen Subsistenzwirtschaft zurück.
Diese Konsequenz, das sieht jedes Kind, ist moralisch erst recht nicht haltbar. "Vom Bösen des Guten", hat Paul Watzlawick eines seiner Bücher betitelt. Eigentlich müssten die Bußprediger froh sein, dass ihre Verzichtsappelle zwar mit großem Beifall zur Kenntnis genommen, letztlich aber nicht befolgt werden. Wohl gäbe es keine Gier nach Designermöbeln mehr, dafür aber die Gier nach Brot, und zwar flächendeckend. Wohl gäbe es weniger soziale Ungleichheit, stattdessen aber eine Gleichheit der Not. Wohl gäbe es Mitleid mit den Armen, helfen aber könnte den Bedürftigen keiner, aus Geldmangel.
Weil Geld an reales Wirtschaften gekoppelt ist, bedeutet Geldmangel nichts anderes als Produktivitätsmangel. Nehmen wir nun an, man habe dies eingesehen und weite die Produktivität aus. Mehr und mehr Menschen arbeiten, Güter und Dienstleistungen entstehen, Geld kommt unter die Leute. Wenn dieser Prozess aus einer extremen Mangelsituation heraus startet, so spiegelt das Geld hauptsächlich Wirtschaftsaktivitäten, bei denen notwendige Güter entstehen. Die Menschen bauen Straßen, Elektrizitätswerke, Häuser, Wasserleitungen, Kühlschränke, und sie sorgen dafür, dass wenigstens soviel in den Kühlschränken ist, wie sie brauchen, um satt zu werden.
Nach einiger Zeit aber ist die häusliche und volkswirtschaftliche Infrastruktur aufgebaut, die Produktion wird immer mehr rationalisiert, Sättigung mit notwendigen Gütern kommt in Sicht. Mehr und mehr kann nun die Produktionskapazität in entbehrliche Güter investiert werden, nein, sie muss in entbehrliche Güter investiert werden, damit auch die Produktion und der Konsum der notwendigen Güter weiter laufen kann.
Genau so war es in der Wirtschaftsgeschichte Westeuropas nach dem Zweiten Weltkrieg. Hier wiederholte sich noch einmal im Zeitraffer, was die Wirtschaftsgeschichte der Moderne seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts insgesamt kennzeichnet: eine allmähliche Veränderung des Mischungsverhältnisses von notwendigen und entbehrlichen Gütern. Der relative Anteil der notwendigen Güter wurde immer kleiner, der Anteil der entbehrlichen Güter immer größer. Absolut gesehen, wuchs aber auch das Volumen der notwendigen Güter ständig. Für Parfüm müssen die Menschen nun keineswegs mehr auf Butter verzichten. Im Gegenteil, wenn man so will, haben sie eher ein Überflussproblem und müssen aufpassen, dass sie nicht dick werden.
Mit anderen Worten: Je mehr sich die Menschen dem Luxus zuwandten, desto geringer wurde die Not. Und das will einem nicht so richtig in den Kopf. Viel eingängiger ist die entgegengesetzte Botschaft der Bußprediger: Schluss mit der Gier, damit alle was vom Kuchen abkriegen. Das Gegenargument lautet: Ohne Gier entsteht erst gar kein Kuchen.
Vielleicht sollten wir deshalb, weniger moralisierend, besser "Begehren" oder "Habenwollen" sagen, auch aus Respekt vor der Freude der Menschen an Dingen, die ihnen gehören. In der Gierdiskussion liegt ein Element von asketischer Menschenverachtung, Neid und Lustfeindlichkeit. Um auf die Finanzkrise zurückzukommen: Natürlich wäre sie uns ohne die Begehrlichkeit der Menschen erspart geblieben, freilich nur deshalb, weil erst gar kein Finanzmarkt entstanden wäre. Wo es kein Geld gibt, ist man bestens gegen eine Finanzkrise gewappnet.
(...)
Gerhard Schulze
Kommentieren