Vom Nachttisch geräumt
Die Bücherkolumne. Von Arno Widmann
21.04.2004. Widmann träumt - von Angelika Klüssendorfs Mutter, dem Fußvolk der Dissenter im 17. und 18. Jahrhundert, großen Nackten, einer prächtigen gelben Ranunkelblüte und Christa Wolfs Halluzinogen. Liebe
 Zehn Erzählungen auf 140 Seiten. Sehr kurze Geschichten also. In Deutschland - heißt es - werde so etwas nicht gelesen. Das wäre schade. Nicht um der Geschichten, nicht einmal um der Autorin willen, sondern die Nicht-Leser wären zu bedauern, denn Angelika Klüssendorfs Geschichten sind schön und spannend. Das ist etwas ganz Seltenes. Für gewöhnlich kommen Spannung und Schönheit nur zusammen bei denen, für die Schönheit spannend und Spannung schön ist. Schönheit braucht Zeit. Sie entsteht in einer eigens für diesen Text geschaffenen Welt. Spannung dagegen kennt keine Muße. Sie hat es eilig. Sie zerrt einen weiter. Der schöne Text entfaltet ein Tableau, in dessen Betrachtung der Leser sich verliert. Er beginnt zu träumen. Der spannende Text dagegen reißt - auf dem Weg zum Ziel - wie ein Hürdenläufer alles nieder.
Zehn Erzählungen auf 140 Seiten. Sehr kurze Geschichten also. In Deutschland - heißt es - werde so etwas nicht gelesen. Das wäre schade. Nicht um der Geschichten, nicht einmal um der Autorin willen, sondern die Nicht-Leser wären zu bedauern, denn Angelika Klüssendorfs Geschichten sind schön und spannend. Das ist etwas ganz Seltenes. Für gewöhnlich kommen Spannung und Schönheit nur zusammen bei denen, für die Schönheit spannend und Spannung schön ist. Schönheit braucht Zeit. Sie entsteht in einer eigens für diesen Text geschaffenen Welt. Spannung dagegen kennt keine Muße. Sie hat es eilig. Sie zerrt einen weiter. Der schöne Text entfaltet ein Tableau, in dessen Betrachtung der Leser sich verliert. Er beginnt zu träumen. Der spannende Text dagegen reißt - auf dem Weg zum Ziel - wie ein Hürdenläufer alles nieder.
Die Geschichten in "Aus allen Himmeln" werden auf dem Umschlag wahrscheinlich "Erzählungen" genannt, weil sie zwar spannend wie Kurzgeschichten sind, gleichzeitig aber sich Zeit nehmen für die Schönheit. Es ist nicht die Schönheit des Dargestellten, sondern der Darstellung und - wenn man das sagen darf - der Empfindung. Die Geschichten erzählen von den Schrecken der Kindheit und Jugend. Sie lassen nichts aus, aber sie lassen einen nicht allein. Ihre Schönheit versöhnt. Wir haben das lange ausschließlich kritisch gesehen, es als ein Argument gegen die Schönheit, gegen die Kunst verstanden. Das war, als wir noch stark waren oder uns doch stark genug fühlten, mit den Schrecken des Lebens fertig zu werden, sie ungeschönt zu ertragen. Inzwischen sind wir dahinter gekommen, dass die Schönheit uns die Möglichkeit gibt, Dinge und Gefühle zu betrachten, ohne dass sie uns zerstören. So wie man den Vorgang der Sonnenfinsternis nur mit einem dicken, dunklen Glas bewaffnet erkennen kann. Ohne Ästhetik gibt es keine Erkenntnistheorie. Wer freilich das dunkle Glas für den eigentlichen Erkenntnisgegenstand hält, der hat das Thema verfehlt. Nichts liegt Angelika Klüssendorf ferner. Die letzten Sätze der letzten Erzählung, in der die Erzählerin eine Auseinandersetzung mit ihrer Mutter schildert, seien zitiert:
"Ihr Fingernagel traf meine Wange, ein Kratzer, vielleicht auch ein Riss. Ich wusste, es würde nichts nützen, mit ihr zu reden. Die Schläge kamen schnell, trafen mein Gesicht, meinen Hals, den gesamten Körper, und ich wich ihnen nicht aus. Ich konzentrierte mich auf mein Pfeifen und hielt still. Ich spürte, wie sie mir büschelweise Haare aus der Kopfhaut riss. Sie durfte nicht aufhören, ich musste sie in die Erschöpfung, in die Erschöpfung ohne Ende treiben, bis sie zu nichts mehr fähig war in dieser Nacht, außer zu ihrem eigenen Schlaf. Irgendwann konnte ich nicht mehr pfeifen, ich spuckte ihr ins Gesicht. Ich lag auf dem Boden, und kurz bevor ich die Schmerzen nicht mehr aushielt, versuchte ich in ihnen zu leben. Ich war da, hier, auf dieser Welt, das Gesicht meiner Mutter so nah über mir wie schon lange nicht mehr. Ich fühlte Tränen auf meiner Haut, und ich wusste nicht, ob es ihre oder meine waren. Ich empfing ihre Schläge in dem klebrigen Gefühl absoluter Hingabe. Der Schmerz weichte mich auf, und das war gut so, ich befand mich an einem Ort, wo ich mich für nichts mehr entscheiden musste. Meine Poren atmeten die Kälte des Universums aus, die Kälte des Essigbaums, und ich dachte, etwas in mir dachte immer noch: Ich liebe dich."
Wenn man es so für sich liest, ist es vielleicht ein wenig zu viel Jesus, aber so erscheint es nur im Zitat. In der Erzählung ist das eine plötzliche, sehr überraschende, ja den Leser überwältigende Weiterung. Eingeleitet von dem Satz, der verrät, was diese Autorin treibt: "Kurz bevor ich die Schmerzen nicht mehr aushielt, versuchte ich in ihnen zu leben."
Angelika Klüssendorf: "Aus allen Himmeln". S. Fischer Verlag, Frankfurt/Main 2004, 142 Seiten, gebunden, 14,90 Euro ISBN 3-10-038202-1.
Philosophische Größe
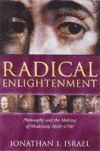 Jonathan I. Israel ist einer der besten Kenner jener lange verschütteten Traditionen, die heute gerne "radikale Aufklärung" genannt werden. Sein Buch "Radical Enlightenment - Philosophy and the Making of Modernity 1650-1750" ist die Summe einer jahrzehntelangen Beschäftigung mit Streitschriften und Manuskripten von - fast ausschließlich - Männern, die die religiösen und politischen Überlieferungen von Grund auf in Frage stellten. Israel kennt die Dissenter des Protestantismus so gut wie die der katholischen Kirche und des Judentums. Seine Forschungen zeigen, dass die meisten seiner Autoren einen sehr genauen Überblick darüber hatten, was an kritischen Einsichten zu ihrer Zeit kursierte. Manuskripte wurden abgeschrieben, umgeschrieben und übersetzt. Die Kritiker der Tradition stammten aus - fast - allen Schichten.
Jonathan I. Israel ist einer der besten Kenner jener lange verschütteten Traditionen, die heute gerne "radikale Aufklärung" genannt werden. Sein Buch "Radical Enlightenment - Philosophy and the Making of Modernity 1650-1750" ist die Summe einer jahrzehntelangen Beschäftigung mit Streitschriften und Manuskripten von - fast ausschließlich - Männern, die die religiösen und politischen Überlieferungen von Grund auf in Frage stellten. Israel kennt die Dissenter des Protestantismus so gut wie die der katholischen Kirche und des Judentums. Seine Forschungen zeigen, dass die meisten seiner Autoren einen sehr genauen Überblick darüber hatten, was an kritischen Einsichten zu ihrer Zeit kursierte. Manuskripte wurden abgeschrieben, umgeschrieben und übersetzt. Die Kritiker der Tradition stammten aus - fast - allen Schichten.
Die Volksüberlieferung spielt bei Israel keine Rolle. Er interessiert sich nicht für Müller, die sich die Welt als einen großen Käse vorstellen. Israel konzentriert sich auf die philosophische Debatte. Auch die verengt er noch einmal, indem er ins Zentrum seines Buches Spinoza stellt. So sehr, dass ihm alle radikale Aufklärung zu einer Spinoza-Nachfolge wird. Das hat innerhalb der angelsächsischen Debatte den Vorteil, dass Israel nicht mehr den englischen Empirismus und die ihm folgende Anglomania eines Voltaire an den Anfang der Aufklärung setzt, sondern den Amsterdamer Juden Baruch Spinoza, der die gesamte christliche Überlieferung in Frage stellte. Aber der Leser wundert sich, dass der vorspinozistische pantheistische Materialismus der Renaissance so gar keine Rolle in seiner Analyse spielt. Israel tut so als habe es ihn nie gegeben. Alle Texte werden nahezu ausschließlich in ihrer Beziehung auf Spinoza vorgestellt. Das hat etwas Komisches. Nach einhundertfünfzig Seiten spätestens sieht man den Autor auf einem Steckenpferd, Spinoza genannt, durch die europäische Geistesgeschichte reiten.
Israel referiert entlegene Autoren, seltene Schriften. Das macht den Reiz des Buches aus. Die übliche Philosophiegeschichte ist die von Gipfelgesprächen. Die Geistesheroen lösen einander in einer Kette kritischer Umarmungen ab. Das Fußvolk kommt nicht vor. Israel stellt die Tschirnhaus', Laus und Edelmanns vor. Man liest deren Kritik - zum Beispiel an dem Glauben, die Bibel sei ein von Gott offenbartes Buch - und beginnt sich zu fragen, was unsere Kriterien für philosophische Größe sind? Warum empfinden wir die Verrenkungen des deutschen Idealismus, Offenbarungsglaube und Wissenschaft zu vereinbaren, nicht als so lächerlich wie sie waren, wie sie vielen aufgeklärten Zeitgenossen erschienen? Sind die Argumente der Atheisten jemals widerlegt worden? Was treibt die Menschheit bis heute dazu, sich über sie lustig zu machen, gleichzeitig aber grenzenloses Verständnis für die absurdesten Glaubensvorstellungen zu entwickeln.
Es ist zu befürchten, dass es nicht der Einsicht einer über sich selbst aufgeklärten Aufklärung zu verdanken ist, sondern dem Opportunismus. Am 9. Mai 1750 wurden in Frankfurt/Main alle Exemplare von Johann Christian Edelmanns Schriften, derer man hatte habhaft werden können, verbrannt. Edelmann wurde dadurch zu einer in ganz Deutschland bekannten Figur. Mit der Folge, dass er aus Angst vor Tätlichkeiten aufgebrachter, gottesfürchtiger Nachbarn in Berlin - von Gnaden Friedrich II. - unter falschem Namen wohnte. Wer die großen Aufklärer liest, ohne die kleinen zu kennen, der bekommt ein falsches Bild. Die Großen waren die Kompromissbereiten, die "Anschlussfähigen". Man legt Jonathan I. Israels Buch aus der Hand und hat die Lektion gelernt, dass der Mangel an Radikalität eine wesentliche Voraussetzung der historischen Größe - jedenfalls in der Philosophiegeschichte - ist.
Jonathan I. Israel: "Radical Enlightenment - Philosophy and the Making of Modernity 1650-1750". Oxford University Press, Oxford 2001, 810 Seiten, 25 s/w Abbildungen, 42,50 Pfund ISBN 0-19-820608-9 Paperback 15,50 Pfund. ISBN 0-19-925456-7.
Variatio delectat
 Das Neue erfreut sich großer Beliebtheit. Jedenfalls wollen die Vertreter des Neuen uns das einreden. In Wahrheit mögen wir das Neue nicht. Es verunsichert uns. Es ist ungewohnt und unwohnlich. Noch verwirrender ist freilich das, was vertraut daherkommt und sich dann als neu und fremd herausstellt. Künstler lieben diese Verwirrung. Die Kritik preist den immer wieder sich gänzlich neu erfindenden Künstler. In Wahrheit aber sind selbst die größten Verwandlungszauberer Serientäter. "Variatio delectat" lautet der Grundlehrsatz aller Ästhetik. Man hat ihn gerne missverstanden. Er predigt gerade nicht, dass immer wieder etwas Neues geschaffen werden muss. Im Gegenteil, er sagt, dass uns die Variation des immer Gleichen erfreut. Es ist nicht das Neue, das unsere Sinne reizt, sondern die neue Variante des Alten, das uns schon einmal eine Lust war.
Das Neue erfreut sich großer Beliebtheit. Jedenfalls wollen die Vertreter des Neuen uns das einreden. In Wahrheit mögen wir das Neue nicht. Es verunsichert uns. Es ist ungewohnt und unwohnlich. Noch verwirrender ist freilich das, was vertraut daherkommt und sich dann als neu und fremd herausstellt. Künstler lieben diese Verwirrung. Die Kritik preist den immer wieder sich gänzlich neu erfindenden Künstler. In Wahrheit aber sind selbst die größten Verwandlungszauberer Serientäter. "Variatio delectat" lautet der Grundlehrsatz aller Ästhetik. Man hat ihn gerne missverstanden. Er predigt gerade nicht, dass immer wieder etwas Neues geschaffen werden muss. Im Gegenteil, er sagt, dass uns die Variation des immer Gleichen erfreut. Es ist nicht das Neue, das unsere Sinne reizt, sondern die neue Variante des Alten, das uns schon einmal eine Lust war.
Bei den Komponisten haben wir akzeptiert, dass ein Großteil ihrer Kunstfertigkeit darin besteht, ein Thema durch alle Instrumente, alle Stimmlagen zu schicken, dass wir es uns von hinten ansehen, dass wir es auseinander nehmen und wieder zusammen setzen sollen. In der Literaturkritik werden der Geschicklichkeit, mit der ein Autor seine Themen immer wieder behandelt, ein paar Sätze gewidmet, und dann tut man so, als spiele diese Fertigkeit für die Beurteilung des Werks keine Rolle.
In der Malerei ist es anders. Hier gab es Jahrhunderte lang ein paar große Themen, die immer wieder variiert wurden. Dicke Monografien sind den Kreuzabnahmen, den Abendmählern, den Marien mit dem Kinde gewidmet. Aber anders als in der Musik gibt es hier keine Analysen der Verfahren, denen die Themen unterworfen werden, um sie zu variieren. Solche Überlegungen weckt der Katalog "Max Neumann Peintures et Dessins", der gerade zu seiner Ausstellung im Musee d'Ixelles/Museum van Elsene in Brüssel erschienen ist.
Ich mag die Arbeiten des 1949 in Saarbrücken geborenen und in Berlin lebenden Malers schon seit einigen Jahren. Er ist ein Meister der Variation, und ein klügerer, ein genauerer Betrachter könnte an seinen Arbeiten sicher zeigen, wie Obession und Kalkulation sich glücklich verbinden können. Es gibt kaum ein Bild von Max Neumann, das nicht einen gesichtslosen Kopf zeigt. In den frühen Bildern war es eindeutig - die Haltung machte das klar - sein Kopf. Ein Werk aus wahrscheinlich Hunderten von Bildern, das immer wieder das gleiche Motiv spielte.
Die Liebhaber des Neuen wenden sich entsetzt ab. Aber auch sie freuen sich, wenn sie in der ihnen von der anderen Straßenseite entgegen kommenden Menge plötzlich und ganz und gar überraschend die Geliebte entdecken. Plötzlich ist falsch. Denn bevor das Bewusstsein sie sah, hatte das Unbewusste sie schon wahrgenommen. Wir waren erregt, ohne zu wissen wovon. Ähnlich stellt der Maler diese Bilder her. Er ist in ihnen nicht zu erkennen, aber er ist drin. Er zeigt und er verbirgt sich in ihnen wie ein Autor sich verbirgt und zeigt in seiner Figur. "Madame Bovary c'est moi," erklärte Flaubert. Wenn die Erregung, die der Künstler bei diesem kindlichen Versteckspiel empfindet - es ist die Fortsetzung des Fort-Da-Spiels mit der Spule, das Freud und dann vor allem Lacan so fasziniert hat -, sich dem Leser, dem Betrachter, dem Hörer mitteilt, dann fasziniert Kunst. Sie ist ja auch ein Erregungstransformator. Wer sich so konsequent über Jahrzehnte hinweg ein Rätsel ist wie Max Neumann, der hilft uns dabei, uns selbst rätselhaft zu werden. Das beunruhigt, aber es erhebt auch. Wir fühlen uns interessant. Das tun wir doch immer? Ja, aber Max Neumann gibt uns das Gefühl, dass wir uns zu Recht interessant vorkommen. Das ist das starke, kräftige affirmative Moment seiner so geheimnisvoll irritierenden, ja verstörenden großflächigen Bilder.
Max Neumann: "Peintures et Dessins". Le Musee d'Ixelles/Museum van Elsene, Brüssel, Ausstellung bis zum 16. Mai 2004, Katalog, 119 Seiten, zahlreiche farbige Abbildungen, mit Beiträgen von Andre de Nys und Joachim Sartorius, Brüssel 2004.
Der kluge Blick
 Das letzte Foto zeigt einen lächelnden jungen Mann, mit glatter Haut und sauberem Seitenscheitel. So hat man sich die "Brotausgabe an revolutionäre Truppen im Deutschen Reichstag durch den dortigen Arbeiter- und Soldatenrat, November 1918" nicht vorgestellt. Er sieht nicht wie ein Revolutionär, sondern nach nettem Schwiegersohn aus. Man kann mit Bildern lügen, man kann aber auch mit Bildern die, die wir uns machen, der Lüge überführen. Dies hier gehört zur zweiten Sorte. Günther Drommer hat im ersten einer auf fünf Bände angelegten Reihe "Die Wahrheit der Bilder - Zeitgenössische Fotografien vom Leben des deutschen Volkes" Hunderte von Fotos aus dem Kaiserreich vorgelegt. Kurze Bildunterschriften und kleine erläuternde Texte oder auch zeitgenössische Gedichte und eine Zeittafel komplettieren den schönen, intelligent gemachten Band.
Das letzte Foto zeigt einen lächelnden jungen Mann, mit glatter Haut und sauberem Seitenscheitel. So hat man sich die "Brotausgabe an revolutionäre Truppen im Deutschen Reichstag durch den dortigen Arbeiter- und Soldatenrat, November 1918" nicht vorgestellt. Er sieht nicht wie ein Revolutionär, sondern nach nettem Schwiegersohn aus. Man kann mit Bildern lügen, man kann aber auch mit Bildern die, die wir uns machen, der Lüge überführen. Dies hier gehört zur zweiten Sorte. Günther Drommer hat im ersten einer auf fünf Bände angelegten Reihe "Die Wahrheit der Bilder - Zeitgenössische Fotografien vom Leben des deutschen Volkes" Hunderte von Fotos aus dem Kaiserreich vorgelegt. Kurze Bildunterschriften und kleine erläuternde Texte oder auch zeitgenössische Gedichte und eine Zeittafel komplettieren den schönen, intelligent gemachten Band.
Da gibt es zum Beispiel gleich auf der Seite 12 das Foto einer Frau, die sich einen - ihren? - Jungen unter den Arm geklemmt hat und so die Straße überquert. Drommer hat einen Text dazu geschrieben, in dem er diese Frau und die Situation, in der sie sich bewegt, beschreibt. Mit diesem Text öffnet er dem Leser die Augen. Er zeigt ihm, wie viel ein Foto sagt und auch wie viel es verschweigt. Drommers liebevoll genauer Blick wird so für ein paar Minuten zu dem des Lesers. Dann blättert er wieder viel zu schnell. Das Wichtigste beim Schauen und Lesen aber ist Geduld. Mit "durchchecken" ist gar nichts gewonnen. Vergleichen schärft den Blick. Wer zum Beispiel das 1915 entstandene Familienbild im Schrebergarten kurz angeschaut hat, wird vielleicht zu ihm zurückblättern, wenn er die illustre Versammlung sieht, die 1906 die Künstlerbund-Ausstellung in Weimar eröffnete. Die Familie, die sich für den Fotografen ungelenk, aber freundlich aufstellte, die posierenden Künstler: Ludwig von Hofmann, Max Klinger, Henry van der Velde, die so sehr darauf achteten, dass selbst in diesem Augenblick jeder eine eigene Position hatte. Es hat einen unangenehmen Beigeschmack von Wichtigtuerei, wie sie sich vor dem Fotografen spreizen.
Dann kommt ein Foto, das das riesige Atelier eines Malers zeigt, der vor gewaltigen Bildern von nackten Männern mit übereinander geschlagenen Beinen in einem Armstuhl sitzt und sich sehr bewusst ist, dem Fotografen sein Profil zu zeigen. Diese Fotos waren bestimmt zu lügen, aber sie plaudern uns, die wir nicht mehr auf das Imponiergehabe von vor einhundert Jahren hereinfallen, sehr viel Wahres aus über Anmaßung, Arroganz und Protzertum des Wilhelminismus. Verglichen damit wirken die Aufnahmen, die den Kaiser und Moltke beim Kaisermanöver 1913 zeigen, wie unschuldige Schnappschüsse, die den Mächtigen keine Zeit gaben, sich ins rechte Licht zu rücken.
Es gibt das Foto einer schmalen lächelnden Frau, hinter ihr ein Mann mit Vatermörder, gefolgt von einer Schar Schülerinnen. Man übersieht es leicht. Es stammt aus dem Jahre 1912 und zeigt die erste Schuldirektorin Berlins. Daneben ein großes Foto mit acht Frauen an einem runden Tisch. Jede hat Papiere und Stifte vor sich liegen. Es gibt keine Kaffeetassen, nur Wasser, Wein und Sekt. Die Bildunterschrift klärt uns über das seltsame Nicht-Kaffeekränzchen auf. Es sind Helene Lange und Gertrud Bäumer mit einigen ihrer Mitstreiterinnen beim ersten Internationalen Berliner Frauenkongress, 1914. Das Buch ist voller Anfänge.
Günther Dommer: "Im Kaiserreich - Alltag unter den Hohenzollern 1871-1918". Verlag Faber & Faber, Leipzig 2003, 272 Seiten, 379 s/w Abbildungen, 39,90 Euro. ISBN 3-936618-02-X.
 Zehn Erzählungen auf 140 Seiten. Sehr kurze Geschichten also. In Deutschland - heißt es - werde so etwas nicht gelesen. Das wäre schade. Nicht um der Geschichten, nicht einmal um der Autorin willen, sondern die Nicht-Leser wären zu bedauern, denn Angelika Klüssendorfs Geschichten sind schön und spannend. Das ist etwas ganz Seltenes. Für gewöhnlich kommen Spannung und Schönheit nur zusammen bei denen, für die Schönheit spannend und Spannung schön ist. Schönheit braucht Zeit. Sie entsteht in einer eigens für diesen Text geschaffenen Welt. Spannung dagegen kennt keine Muße. Sie hat es eilig. Sie zerrt einen weiter. Der schöne Text entfaltet ein Tableau, in dessen Betrachtung der Leser sich verliert. Er beginnt zu träumen. Der spannende Text dagegen reißt - auf dem Weg zum Ziel - wie ein Hürdenläufer alles nieder.
Zehn Erzählungen auf 140 Seiten. Sehr kurze Geschichten also. In Deutschland - heißt es - werde so etwas nicht gelesen. Das wäre schade. Nicht um der Geschichten, nicht einmal um der Autorin willen, sondern die Nicht-Leser wären zu bedauern, denn Angelika Klüssendorfs Geschichten sind schön und spannend. Das ist etwas ganz Seltenes. Für gewöhnlich kommen Spannung und Schönheit nur zusammen bei denen, für die Schönheit spannend und Spannung schön ist. Schönheit braucht Zeit. Sie entsteht in einer eigens für diesen Text geschaffenen Welt. Spannung dagegen kennt keine Muße. Sie hat es eilig. Sie zerrt einen weiter. Der schöne Text entfaltet ein Tableau, in dessen Betrachtung der Leser sich verliert. Er beginnt zu träumen. Der spannende Text dagegen reißt - auf dem Weg zum Ziel - wie ein Hürdenläufer alles nieder.Die Geschichten in "Aus allen Himmeln" werden auf dem Umschlag wahrscheinlich "Erzählungen" genannt, weil sie zwar spannend wie Kurzgeschichten sind, gleichzeitig aber sich Zeit nehmen für die Schönheit. Es ist nicht die Schönheit des Dargestellten, sondern der Darstellung und - wenn man das sagen darf - der Empfindung. Die Geschichten erzählen von den Schrecken der Kindheit und Jugend. Sie lassen nichts aus, aber sie lassen einen nicht allein. Ihre Schönheit versöhnt. Wir haben das lange ausschließlich kritisch gesehen, es als ein Argument gegen die Schönheit, gegen die Kunst verstanden. Das war, als wir noch stark waren oder uns doch stark genug fühlten, mit den Schrecken des Lebens fertig zu werden, sie ungeschönt zu ertragen. Inzwischen sind wir dahinter gekommen, dass die Schönheit uns die Möglichkeit gibt, Dinge und Gefühle zu betrachten, ohne dass sie uns zerstören. So wie man den Vorgang der Sonnenfinsternis nur mit einem dicken, dunklen Glas bewaffnet erkennen kann. Ohne Ästhetik gibt es keine Erkenntnistheorie. Wer freilich das dunkle Glas für den eigentlichen Erkenntnisgegenstand hält, der hat das Thema verfehlt. Nichts liegt Angelika Klüssendorf ferner. Die letzten Sätze der letzten Erzählung, in der die Erzählerin eine Auseinandersetzung mit ihrer Mutter schildert, seien zitiert:
"Ihr Fingernagel traf meine Wange, ein Kratzer, vielleicht auch ein Riss. Ich wusste, es würde nichts nützen, mit ihr zu reden. Die Schläge kamen schnell, trafen mein Gesicht, meinen Hals, den gesamten Körper, und ich wich ihnen nicht aus. Ich konzentrierte mich auf mein Pfeifen und hielt still. Ich spürte, wie sie mir büschelweise Haare aus der Kopfhaut riss. Sie durfte nicht aufhören, ich musste sie in die Erschöpfung, in die Erschöpfung ohne Ende treiben, bis sie zu nichts mehr fähig war in dieser Nacht, außer zu ihrem eigenen Schlaf. Irgendwann konnte ich nicht mehr pfeifen, ich spuckte ihr ins Gesicht. Ich lag auf dem Boden, und kurz bevor ich die Schmerzen nicht mehr aushielt, versuchte ich in ihnen zu leben. Ich war da, hier, auf dieser Welt, das Gesicht meiner Mutter so nah über mir wie schon lange nicht mehr. Ich fühlte Tränen auf meiner Haut, und ich wusste nicht, ob es ihre oder meine waren. Ich empfing ihre Schläge in dem klebrigen Gefühl absoluter Hingabe. Der Schmerz weichte mich auf, und das war gut so, ich befand mich an einem Ort, wo ich mich für nichts mehr entscheiden musste. Meine Poren atmeten die Kälte des Universums aus, die Kälte des Essigbaums, und ich dachte, etwas in mir dachte immer noch: Ich liebe dich."
Wenn man es so für sich liest, ist es vielleicht ein wenig zu viel Jesus, aber so erscheint es nur im Zitat. In der Erzählung ist das eine plötzliche, sehr überraschende, ja den Leser überwältigende Weiterung. Eingeleitet von dem Satz, der verrät, was diese Autorin treibt: "Kurz bevor ich die Schmerzen nicht mehr aushielt, versuchte ich in ihnen zu leben."
Angelika Klüssendorf: "Aus allen Himmeln". S. Fischer Verlag, Frankfurt/Main 2004, 142 Seiten, gebunden, 14,90 Euro ISBN 3-10-038202-1.
Philosophische Größe
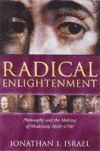 Jonathan I. Israel ist einer der besten Kenner jener lange verschütteten Traditionen, die heute gerne "radikale Aufklärung" genannt werden. Sein Buch "Radical Enlightenment - Philosophy and the Making of Modernity 1650-1750" ist die Summe einer jahrzehntelangen Beschäftigung mit Streitschriften und Manuskripten von - fast ausschließlich - Männern, die die religiösen und politischen Überlieferungen von Grund auf in Frage stellten. Israel kennt die Dissenter des Protestantismus so gut wie die der katholischen Kirche und des Judentums. Seine Forschungen zeigen, dass die meisten seiner Autoren einen sehr genauen Überblick darüber hatten, was an kritischen Einsichten zu ihrer Zeit kursierte. Manuskripte wurden abgeschrieben, umgeschrieben und übersetzt. Die Kritiker der Tradition stammten aus - fast - allen Schichten.
Jonathan I. Israel ist einer der besten Kenner jener lange verschütteten Traditionen, die heute gerne "radikale Aufklärung" genannt werden. Sein Buch "Radical Enlightenment - Philosophy and the Making of Modernity 1650-1750" ist die Summe einer jahrzehntelangen Beschäftigung mit Streitschriften und Manuskripten von - fast ausschließlich - Männern, die die religiösen und politischen Überlieferungen von Grund auf in Frage stellten. Israel kennt die Dissenter des Protestantismus so gut wie die der katholischen Kirche und des Judentums. Seine Forschungen zeigen, dass die meisten seiner Autoren einen sehr genauen Überblick darüber hatten, was an kritischen Einsichten zu ihrer Zeit kursierte. Manuskripte wurden abgeschrieben, umgeschrieben und übersetzt. Die Kritiker der Tradition stammten aus - fast - allen Schichten.Die Volksüberlieferung spielt bei Israel keine Rolle. Er interessiert sich nicht für Müller, die sich die Welt als einen großen Käse vorstellen. Israel konzentriert sich auf die philosophische Debatte. Auch die verengt er noch einmal, indem er ins Zentrum seines Buches Spinoza stellt. So sehr, dass ihm alle radikale Aufklärung zu einer Spinoza-Nachfolge wird. Das hat innerhalb der angelsächsischen Debatte den Vorteil, dass Israel nicht mehr den englischen Empirismus und die ihm folgende Anglomania eines Voltaire an den Anfang der Aufklärung setzt, sondern den Amsterdamer Juden Baruch Spinoza, der die gesamte christliche Überlieferung in Frage stellte. Aber der Leser wundert sich, dass der vorspinozistische pantheistische Materialismus der Renaissance so gar keine Rolle in seiner Analyse spielt. Israel tut so als habe es ihn nie gegeben. Alle Texte werden nahezu ausschließlich in ihrer Beziehung auf Spinoza vorgestellt. Das hat etwas Komisches. Nach einhundertfünfzig Seiten spätestens sieht man den Autor auf einem Steckenpferd, Spinoza genannt, durch die europäische Geistesgeschichte reiten.
Israel referiert entlegene Autoren, seltene Schriften. Das macht den Reiz des Buches aus. Die übliche Philosophiegeschichte ist die von Gipfelgesprächen. Die Geistesheroen lösen einander in einer Kette kritischer Umarmungen ab. Das Fußvolk kommt nicht vor. Israel stellt die Tschirnhaus', Laus und Edelmanns vor. Man liest deren Kritik - zum Beispiel an dem Glauben, die Bibel sei ein von Gott offenbartes Buch - und beginnt sich zu fragen, was unsere Kriterien für philosophische Größe sind? Warum empfinden wir die Verrenkungen des deutschen Idealismus, Offenbarungsglaube und Wissenschaft zu vereinbaren, nicht als so lächerlich wie sie waren, wie sie vielen aufgeklärten Zeitgenossen erschienen? Sind die Argumente der Atheisten jemals widerlegt worden? Was treibt die Menschheit bis heute dazu, sich über sie lustig zu machen, gleichzeitig aber grenzenloses Verständnis für die absurdesten Glaubensvorstellungen zu entwickeln.
Es ist zu befürchten, dass es nicht der Einsicht einer über sich selbst aufgeklärten Aufklärung zu verdanken ist, sondern dem Opportunismus. Am 9. Mai 1750 wurden in Frankfurt/Main alle Exemplare von Johann Christian Edelmanns Schriften, derer man hatte habhaft werden können, verbrannt. Edelmann wurde dadurch zu einer in ganz Deutschland bekannten Figur. Mit der Folge, dass er aus Angst vor Tätlichkeiten aufgebrachter, gottesfürchtiger Nachbarn in Berlin - von Gnaden Friedrich II. - unter falschem Namen wohnte. Wer die großen Aufklärer liest, ohne die kleinen zu kennen, der bekommt ein falsches Bild. Die Großen waren die Kompromissbereiten, die "Anschlussfähigen". Man legt Jonathan I. Israels Buch aus der Hand und hat die Lektion gelernt, dass der Mangel an Radikalität eine wesentliche Voraussetzung der historischen Größe - jedenfalls in der Philosophiegeschichte - ist.
Jonathan I. Israel: "Radical Enlightenment - Philosophy and the Making of Modernity 1650-1750". Oxford University Press, Oxford 2001, 810 Seiten, 25 s/w Abbildungen, 42,50 Pfund ISBN 0-19-820608-9 Paperback 15,50 Pfund. ISBN 0-19-925456-7.
Variatio delectat
 Das Neue erfreut sich großer Beliebtheit. Jedenfalls wollen die Vertreter des Neuen uns das einreden. In Wahrheit mögen wir das Neue nicht. Es verunsichert uns. Es ist ungewohnt und unwohnlich. Noch verwirrender ist freilich das, was vertraut daherkommt und sich dann als neu und fremd herausstellt. Künstler lieben diese Verwirrung. Die Kritik preist den immer wieder sich gänzlich neu erfindenden Künstler. In Wahrheit aber sind selbst die größten Verwandlungszauberer Serientäter. "Variatio delectat" lautet der Grundlehrsatz aller Ästhetik. Man hat ihn gerne missverstanden. Er predigt gerade nicht, dass immer wieder etwas Neues geschaffen werden muss. Im Gegenteil, er sagt, dass uns die Variation des immer Gleichen erfreut. Es ist nicht das Neue, das unsere Sinne reizt, sondern die neue Variante des Alten, das uns schon einmal eine Lust war.
Das Neue erfreut sich großer Beliebtheit. Jedenfalls wollen die Vertreter des Neuen uns das einreden. In Wahrheit mögen wir das Neue nicht. Es verunsichert uns. Es ist ungewohnt und unwohnlich. Noch verwirrender ist freilich das, was vertraut daherkommt und sich dann als neu und fremd herausstellt. Künstler lieben diese Verwirrung. Die Kritik preist den immer wieder sich gänzlich neu erfindenden Künstler. In Wahrheit aber sind selbst die größten Verwandlungszauberer Serientäter. "Variatio delectat" lautet der Grundlehrsatz aller Ästhetik. Man hat ihn gerne missverstanden. Er predigt gerade nicht, dass immer wieder etwas Neues geschaffen werden muss. Im Gegenteil, er sagt, dass uns die Variation des immer Gleichen erfreut. Es ist nicht das Neue, das unsere Sinne reizt, sondern die neue Variante des Alten, das uns schon einmal eine Lust war.Bei den Komponisten haben wir akzeptiert, dass ein Großteil ihrer Kunstfertigkeit darin besteht, ein Thema durch alle Instrumente, alle Stimmlagen zu schicken, dass wir es uns von hinten ansehen, dass wir es auseinander nehmen und wieder zusammen setzen sollen. In der Literaturkritik werden der Geschicklichkeit, mit der ein Autor seine Themen immer wieder behandelt, ein paar Sätze gewidmet, und dann tut man so, als spiele diese Fertigkeit für die Beurteilung des Werks keine Rolle.
In der Malerei ist es anders. Hier gab es Jahrhunderte lang ein paar große Themen, die immer wieder variiert wurden. Dicke Monografien sind den Kreuzabnahmen, den Abendmählern, den Marien mit dem Kinde gewidmet. Aber anders als in der Musik gibt es hier keine Analysen der Verfahren, denen die Themen unterworfen werden, um sie zu variieren. Solche Überlegungen weckt der Katalog "Max Neumann Peintures et Dessins", der gerade zu seiner Ausstellung im Musee d'Ixelles/Museum van Elsene in Brüssel erschienen ist.
Ich mag die Arbeiten des 1949 in Saarbrücken geborenen und in Berlin lebenden Malers schon seit einigen Jahren. Er ist ein Meister der Variation, und ein klügerer, ein genauerer Betrachter könnte an seinen Arbeiten sicher zeigen, wie Obession und Kalkulation sich glücklich verbinden können. Es gibt kaum ein Bild von Max Neumann, das nicht einen gesichtslosen Kopf zeigt. In den frühen Bildern war es eindeutig - die Haltung machte das klar - sein Kopf. Ein Werk aus wahrscheinlich Hunderten von Bildern, das immer wieder das gleiche Motiv spielte.
Die Liebhaber des Neuen wenden sich entsetzt ab. Aber auch sie freuen sich, wenn sie in der ihnen von der anderen Straßenseite entgegen kommenden Menge plötzlich und ganz und gar überraschend die Geliebte entdecken. Plötzlich ist falsch. Denn bevor das Bewusstsein sie sah, hatte das Unbewusste sie schon wahrgenommen. Wir waren erregt, ohne zu wissen wovon. Ähnlich stellt der Maler diese Bilder her. Er ist in ihnen nicht zu erkennen, aber er ist drin. Er zeigt und er verbirgt sich in ihnen wie ein Autor sich verbirgt und zeigt in seiner Figur. "Madame Bovary c'est moi," erklärte Flaubert. Wenn die Erregung, die der Künstler bei diesem kindlichen Versteckspiel empfindet - es ist die Fortsetzung des Fort-Da-Spiels mit der Spule, das Freud und dann vor allem Lacan so fasziniert hat -, sich dem Leser, dem Betrachter, dem Hörer mitteilt, dann fasziniert Kunst. Sie ist ja auch ein Erregungstransformator. Wer sich so konsequent über Jahrzehnte hinweg ein Rätsel ist wie Max Neumann, der hilft uns dabei, uns selbst rätselhaft zu werden. Das beunruhigt, aber es erhebt auch. Wir fühlen uns interessant. Das tun wir doch immer? Ja, aber Max Neumann gibt uns das Gefühl, dass wir uns zu Recht interessant vorkommen. Das ist das starke, kräftige affirmative Moment seiner so geheimnisvoll irritierenden, ja verstörenden großflächigen Bilder.
Max Neumann: "Peintures et Dessins". Le Musee d'Ixelles/Museum van Elsene, Brüssel, Ausstellung bis zum 16. Mai 2004, Katalog, 119 Seiten, zahlreiche farbige Abbildungen, mit Beiträgen von Andre de Nys und Joachim Sartorius, Brüssel 2004.
Der kluge Blick
 Das letzte Foto zeigt einen lächelnden jungen Mann, mit glatter Haut und sauberem Seitenscheitel. So hat man sich die "Brotausgabe an revolutionäre Truppen im Deutschen Reichstag durch den dortigen Arbeiter- und Soldatenrat, November 1918" nicht vorgestellt. Er sieht nicht wie ein Revolutionär, sondern nach nettem Schwiegersohn aus. Man kann mit Bildern lügen, man kann aber auch mit Bildern die, die wir uns machen, der Lüge überführen. Dies hier gehört zur zweiten Sorte. Günther Drommer hat im ersten einer auf fünf Bände angelegten Reihe "Die Wahrheit der Bilder - Zeitgenössische Fotografien vom Leben des deutschen Volkes" Hunderte von Fotos aus dem Kaiserreich vorgelegt. Kurze Bildunterschriften und kleine erläuternde Texte oder auch zeitgenössische Gedichte und eine Zeittafel komplettieren den schönen, intelligent gemachten Band.
Das letzte Foto zeigt einen lächelnden jungen Mann, mit glatter Haut und sauberem Seitenscheitel. So hat man sich die "Brotausgabe an revolutionäre Truppen im Deutschen Reichstag durch den dortigen Arbeiter- und Soldatenrat, November 1918" nicht vorgestellt. Er sieht nicht wie ein Revolutionär, sondern nach nettem Schwiegersohn aus. Man kann mit Bildern lügen, man kann aber auch mit Bildern die, die wir uns machen, der Lüge überführen. Dies hier gehört zur zweiten Sorte. Günther Drommer hat im ersten einer auf fünf Bände angelegten Reihe "Die Wahrheit der Bilder - Zeitgenössische Fotografien vom Leben des deutschen Volkes" Hunderte von Fotos aus dem Kaiserreich vorgelegt. Kurze Bildunterschriften und kleine erläuternde Texte oder auch zeitgenössische Gedichte und eine Zeittafel komplettieren den schönen, intelligent gemachten Band.Da gibt es zum Beispiel gleich auf der Seite 12 das Foto einer Frau, die sich einen - ihren? - Jungen unter den Arm geklemmt hat und so die Straße überquert. Drommer hat einen Text dazu geschrieben, in dem er diese Frau und die Situation, in der sie sich bewegt, beschreibt. Mit diesem Text öffnet er dem Leser die Augen. Er zeigt ihm, wie viel ein Foto sagt und auch wie viel es verschweigt. Drommers liebevoll genauer Blick wird so für ein paar Minuten zu dem des Lesers. Dann blättert er wieder viel zu schnell. Das Wichtigste beim Schauen und Lesen aber ist Geduld. Mit "durchchecken" ist gar nichts gewonnen. Vergleichen schärft den Blick. Wer zum Beispiel das 1915 entstandene Familienbild im Schrebergarten kurz angeschaut hat, wird vielleicht zu ihm zurückblättern, wenn er die illustre Versammlung sieht, die 1906 die Künstlerbund-Ausstellung in Weimar eröffnete. Die Familie, die sich für den Fotografen ungelenk, aber freundlich aufstellte, die posierenden Künstler: Ludwig von Hofmann, Max Klinger, Henry van der Velde, die so sehr darauf achteten, dass selbst in diesem Augenblick jeder eine eigene Position hatte. Es hat einen unangenehmen Beigeschmack von Wichtigtuerei, wie sie sich vor dem Fotografen spreizen.
Dann kommt ein Foto, das das riesige Atelier eines Malers zeigt, der vor gewaltigen Bildern von nackten Männern mit übereinander geschlagenen Beinen in einem Armstuhl sitzt und sich sehr bewusst ist, dem Fotografen sein Profil zu zeigen. Diese Fotos waren bestimmt zu lügen, aber sie plaudern uns, die wir nicht mehr auf das Imponiergehabe von vor einhundert Jahren hereinfallen, sehr viel Wahres aus über Anmaßung, Arroganz und Protzertum des Wilhelminismus. Verglichen damit wirken die Aufnahmen, die den Kaiser und Moltke beim Kaisermanöver 1913 zeigen, wie unschuldige Schnappschüsse, die den Mächtigen keine Zeit gaben, sich ins rechte Licht zu rücken.
Es gibt das Foto einer schmalen lächelnden Frau, hinter ihr ein Mann mit Vatermörder, gefolgt von einer Schar Schülerinnen. Man übersieht es leicht. Es stammt aus dem Jahre 1912 und zeigt die erste Schuldirektorin Berlins. Daneben ein großes Foto mit acht Frauen an einem runden Tisch. Jede hat Papiere und Stifte vor sich liegen. Es gibt keine Kaffeetassen, nur Wasser, Wein und Sekt. Die Bildunterschrift klärt uns über das seltsame Nicht-Kaffeekränzchen auf. Es sind Helene Lange und Gertrud Bäumer mit einigen ihrer Mitstreiterinnen beim ersten Internationalen Berliner Frauenkongress, 1914. Das Buch ist voller Anfänge.
Günther Dommer: "Im Kaiserreich - Alltag unter den Hohenzollern 1871-1918". Verlag Faber & Faber, Leipzig 2003, 272 Seiten, 379 s/w Abbildungen, 39,90 Euro. ISBN 3-936618-02-X.












