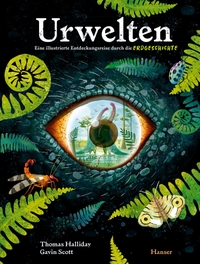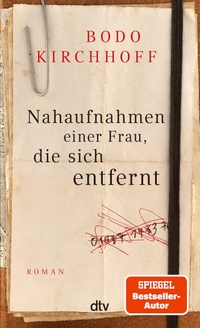Essay
No mirrors please!
Von Daniele Dell'Agli
26.07.2012. Indiskrete Zooms auf die gegenwärtige Krise der Autorschaft.Unlängst konnte man im Internet auf der Suche nach einer (im Handel nicht mehr erhältlichen) historischen Aufnahme von Arnold Schönbergs "Pierrot Lunaire" einem verzweifelten Aufruf begegnen: "Blog Needs New Authors!" Wer, selbst der schreibenden Zunft zugehörig, dem Link mit der in solchen Fällen angebrachten Mischung von Neugier und Skepsis folgte, musste feststellen, dass mit "authors" keineswegs Texturheber gemeint sind, sondern jene, die im Netsprech - technisch korrekt - "poster" genannt werden, also Beitragslieferanten, die per elektronischer Post etwas schicken, was zum jeweiligen Blog passt, in diesem Falle Musikdateien. Allein schon durch die Lieferung von "files" wird also jemand - pseudonymisch, versteht sich - zum "Autor", womit lediglich die Urheberschaft für eine Sendung angezeigt wird (nicht zuletzt, um Dank für die Gabe zu ernten), also weder eine Verantwortlichkeit für die Veröffentlichung (die liegt beim Blogger), noch für den Inhalt des "posts" (der stammt in der Regel nicht vom Uploader) reklamiert wird.
Seit den Anfängen des Filesharing ist es üblich, sich für die mühevolle Tätigkeit des Rippens, Konvertierens und Uploadens von Film- und Musikdateien wenigstens symbolisch mit dem Adelstitel des "Autors" zu entschädigen. Wem die Ironie solchen Tuns peinlich ist, der pflegt dem mitschwingenden (und nicht zu eskamotierenden) Anspruch durch die Beigabe von Klappentexten, Kritiken oder selbst verfassten Kurzinformationen (nicht selten zuvor bei Amazon eingeübt) nachzukommen. Dafür, dass die Beteiligten darunter leiden, ihre Klarnamen nicht preisgeben zu können und insofern - Ghostwritern nicht unähnlich - als Autoren ein Schattendasein führen zu müssen, gibt es bislang keine Anzeichen. Das stärkt die Vermutung, daß die Poster ihre Rolle als Imposteure, also als Simulanten (oder, nach Philip K. Dick, als Replikanten) durchaus genießen.
Man kann anhand solcher Entwicklungen einmal mehr den Niedergang des Abendlands diagnostizieren oder zumindest den Ausverkauf einer gesellschaftlich ebenso hoch angesehenen wie schlecht honorierten Kompetenz, der weit über das gekränkte Selbstbild von kulturellen Primärproduzenten hinaus weist, das Thierry Chervel zeichnet. Bei genauerer Betrachtung jedoch scheinen User und Blogger im Netz lediglich eine Tendenz zu vollstrecken, die sich mit der Überproduktion von Textfabrikanten vor allem in den geistes- und sozialwissenschaftlichen Fakultäten der Universitäten in den achtziger Jahren angekündigt hatte.
In einem heiter-sarkastischen Vortrag über die "Die Krise der Wiederholung in der Moderne" (hier als pdf-Dokument) hat Peter Sloterdijk unlängst den "Krullfaktor" literarischer Produktionen, insbesondere akademischer Provenienz ins Visier genommen und der Hochstapelei von Plagiatoren zwar die beachtliche Simulationsleistung, die sie erfordert, zugute gehalten, um dann doch angesichts der Masse an unlesbaren (und ungelesenen) universitären Schriftsachen wenigstens die "digitalen Sittenwächter" (die Zitatsuchprogramme) als letzte und unbestechliche Kontrollinstanz zu loben. Die keineswegs ironisch gemeinte Abschreckungsdoktrin, die allen Geistesdieben den Ernstfall der ansonsten kaum noch vorgesehenen Lektüre ("cave lectorem!") androht, ist aus dem Munde eines Professors verständlich, aber genau besehen mindestens inkonsequent. Nicht nur, weil die derart Vorgewarnten sich künftig hüten werden, Zitate wörtlich zu übernehmen. Die entscheidende Frage ist doch, warum Texte, die - mit oder ohne fremden Federschmuck - erkennbar und nachweislich keine eigene intellektuelle Leistung des Autors aufweisen (Kompilationsfleiß und paraphrasierende Phantasie lassen wir nicht gelten) überhaupt urheberrechtlichen Schutz sollen beanspruchen dürfen. Warum genügt es den angehenden wie den akkreditierten Mitgliedern einer Körperschaft im Dienste von "Wiederholungsverfahren" (Sloterdijk) nicht, für die Verfertigung ihrer administrativen Substrate mit einer durch "Scheinerwerb" (Sloterdijk) beglaubigten Karriere belohnt zu werden? Welcher narzisstische Dämon treibt sie an, die Agglomerate von affektbereinigten, fachterminologisch aufgerüsteten Standardsätzen, die sie als "persönliche Leistung" bescheinigt bekommen, auch noch als Buch zu veröffentlichen?
Dem Verfasser dieser Glossen wurde bereits 1981 ein Dissertationsstipendium an der FU Berlin mit der Begründung verweigert, die angegebene Literaturliste sei nicht lang genug, es fehle insbesondere die "Sekundärliteratur". Beim nächsten Anlauf ein Semester später hieß es dann: "Die Arbeit verspricht ein interessanter Essay zu werden, der wissenschaftliche Ertrag ist nicht gesichert." Es ging wohlgemerkt nicht um geophysikalische Probleme bei der Endlagerung von Atommüll, sondern um religionsphilosophische Alternativen zum apokalyptischen Denken. Man beachte das Pochen auf die zu erhebende Fachliteratur als Nachweis der Orientierung nicht an der Sache, sondern an interne Hierarchien der Institution. Qualifizieren tut sich, wem es gelingt, aus dem Wust der vorhandenen Sekundärliteratur ein überschaubares Exemplar von Tertiärliteratur zu kompilieren. In Sloterdijks Diktion: "Auf diese Weise generiert das akademische Schattenreich eine Textwelt zweiter Ordnung, in der junge real Ungelesene ältere, virtuell Ungelesene in Umlauf halten." Just gegen potentielle Lesbarkeit wendete sich darum der Essayismusverdacht, der zur zweiten Ablehnung führte: die NaFöG-Kommission ahndete, daß hier ein Kandidat offensichtlich nicht bereit war, alles aus seiner Dissertation zu verbannen, was den Anschein von stilistischem Eigenwillen oder gar selbstdenkerischer Umtriebigkeit erwecken konnte.
Im Lichte solcher Selektionsprozesse schrumpft aber der Unterschied zwischen der Hochstapelei mit Zitatnachweis und jener ohne auf die Differenz zwischen Bioeiern mit individuellem Herkunftsstempel auf der Schale und solchen mit generischem Verpackungsaufdruck. Daher verwundert es doch, wenn ausgerechnet der begabteste deutsche Transzendentalbelletrist auf die Wahrung von "geistigem Eigentum" an Texten insistiert, aus denen der Geist vollständig ausgetrieben und der Eigentumstitel de facto einer anonymen Diskursgemeinschaft übertragen wurde. Gefragt ist in dieser Situation weniger die verschärfte Lektüre von Suchmaschinen als vielmehr eine Bundesprüfstelle zur Evaluierung tatsächlich vorhandener, unverwechselbarer geistiger Regsamkeit (Formulierungskunst inbegriffen) beim Zustandekommen einer Arbeit, die dann im - unwahrscheinlichen - Fall eines positiven Bescheids das betreffende Produkt mit einem urheberrechtlich gültigen Zertifikat versehen würde. Angesehen der gigantischen Fülle der zu bewältigenden Schriftstücke würde ein solches Amt mit all seinen regionalen und kommunalen Ablegern nebenbei Legionen arbeitsloser Akademiker einen krisensicheren Job verschaffen. Daß dabei nicht die Böcke zu Gärtnern gemacht werden, ist zweifellos ein Rekrutierungsproblem, aber eines, das sich mit einiger Phantasie lösen ließe - zum Beispiel indem man die kritische Lektüre grundsätzlich Fachfremden anvertraut.
Leider hat die Mesalliance von Hochstapelei und Mediokrität, die man historisch als Preis für die Massendemokratisierung von Hochschulabschlüssen verbuchen muss, weit über die Grenzen des Campus hinaus auf den Kulturbetrieb im ganzen, in den nach wie vor die meisten Absolventen entlassen werden, ausgestrahlt. Zum inflationär aufgeblähten Krullfaktor gehört schon seit Jahrzehnten, dass jeder Werbetexter sich "Schriftsteller" schimpft und jeder Journalist als "Intellektueller" apostrophiert wird. Da diese Berufsbezeichnungen nicht geschützt sind, verführt diese Nobilitierung von Hinzundkunz zu Wortmagiern und Reflexionsakrobaten zur allseitigen wohlfeilen Nachahmung mit tendenziell abnehmendem Wiedererkennungseffekt. Den traurigen Tiefpunkt dieser Verfallslogik berichtete ein befreundeter (derzeit erwerbsloser) Philosoph erst vor kurzem: Als er seine Sachbearbeiterin in einer der staatlichen Arbeitsagenturen fragte, wie sie darauf käme, daß die Tätigkeit als Ladenverkäufer einem Intellektuellen zumutbar sei, antwortete sie pampig (und wörtlich): "Was heißt hier schon Intellektueller, ich habe auch einen akademischen Titel und war mir nicht zu schade, andere Arbeiten als meine jetzige anzunehmen." Dieser Gesinnung zufolge würden dann auch an den Börsen nichts als "Intellektuelle" zocken, die, wenn sie halbstündlich ihr Bulletin über Gewinne und Verluste in Telegrammdeutsch updaten, sogar zeitweise zu Epigrammatikern mutierten. Schon ihre Unzahl ist Frevel, möchte man Stefan George korrigieren, und schon die bloße Unzahl desavouiert das exklusive Selbstverständnis aller Akteure. Anders gesagt: Wo Hochstapelei generalisiert wird, schwindet nicht nur die selbstkritische Distanz gegenüber der eigenen Produktion (und die Ahnung, wieviel man anderen dafür verdankt), es schwinden vor allem Anerkennung und Respekt für Talente, Vermögen und Kompetenzen, die keine Unbedenklichkeit dank eines prominenten Status ihrer Träger genießen.
Was nun die Stammhalter von Autorschaft im engeren Sinne, die Schriftsteller, die diesen Namen verdienen und die bislang so wenig Lust zum Bloggen verspüren wie "die letzten Mohikaner" auf Small talk, so hat Karl-Heinz Ott in einem eindringlichen Plädoyer für die notwendige Weltfremdheit ihrer Arbeit im Grunde alles gesagt. Es sei nur ein pragmatischer Gesichtspunkt hinzugefügt: Wem das Schreiben ethische Verpflichtung, intellektuelle Herausforderung und stilistische Präzisionskunst ist, der arbeitet zwangsläufig langsam und mit störungsanfälligen Routinen, die sich nicht mal eben zwischendurch in einen Bloggermodus umschalten lassen. Und selbst das Schwätzchen mit dem Leser, das Paolo Coelho als Ideal eines bloggenden Romanciers vorschwebt, kostet schlicht und einfach Zeit. Würden freiberufliche Autoren - im Gegensatz zu Prominenten und Professoren, Chefredakteuren, Filmemachern, Architekten und Designern - nicht überwiegend, trotz zeitraubender Quersubventionierungen, am Existenzminimum entlang wirtschaften, dann könnte man über eine solche generöse Gabe reden, vorausgesetzt die Onlineleser wären bereit, manche Sätze mehr als einmal zu lesen. Was wir für eine wünschenswerte Steigerung der Gratisdiffusion kreativer und durchdachter Texte (Bilder, Filme, Musikstücke) im Internet demnach brauchen, ist ein Grundeinkommen für alle Schlechterverdienenden unter den Kulturschaffenden.
Dieses werden besonders Schriftsteller (sofern sie nicht das Erbe der Vorfahren in Vers und Prosa versetzen) künftig immer dringender benötigen, da ihre Population antizyklisch zum Gesellschaftstrend ebenso wächst wie das Wissen jedes Einzelnen um die enormen Bestände an bereits vorhandener und unvermindert gültiger Literatur. Von dem Anspruch, etwas Individuelles, Inkommensurables zu produzieren, das unbedingt in Werkform gegossen werden muss, werden andererseits gerade sie (schon berufsbedingt) als letzte lassen können. Denn wenn die Beobachtung stimmt, dass die Individualität aus den Werken schwindet in dem Maße, da sich ihre Produzenten vervielfältigen und des Profilierungszwangs müde alle Energien der Abweichung, der Innovation und Gestaltung lieber in alternative, verwandlungsmächtige Alltagsentwürfe umleiten, so profitieren davon allein die bildkünstlerisch, audiovisuell und musisch Begabten, denen - im Rahmen eines erweiterten, das heißt werkfernen Kunstbegriffs - ungleich größere Betätigungsfelder zur Verfügung stehen als Schreibtische mit Tastaturen und Monitoren.
Das Selbstbild, wenn nicht gar die Existenzgrundlage schreibender Autoren sieht sich künftig noch von einer ganz anderen Seite bedroht. Wer sich die Mühe macht, auf der Suche nach einer (im Handel längst nicht mehr erhältlichen) historischen Aufnahme - sagen wir jetzt lieber von Georges "Entflieht auf leichten Kähnen", wunderbar für Chor gesetzt von Anton Webern - einmal einen russischen Musikblog anzusteuern und mangels Sprachkenntnisse den Google-Übersetzer aktiviert, wird je nach Art und Informationsdichte des kyrillischen Schriftsatzes mit Kostproben experimenteller Literatur belohnt werden, die es an Originalität, Verschrobenheit und Wortwitz mit dem Besten aufnehmen, was diese Disziplin vermeintlich höheren (metaphysischen) Unfugs von Gertrude Stein über Arno Schmidt bis Oskar Pastior zu bieten hat. Es wäre ein Leichtes, eine Kompilation solcher Trouvaillen zu edieren und das Endprodukt samt Urheber - das nämliche Übersetzerprogramm - für den Literaturnobelpreis zu indizieren.
Daniele Dell'Agli
Seit den Anfängen des Filesharing ist es üblich, sich für die mühevolle Tätigkeit des Rippens, Konvertierens und Uploadens von Film- und Musikdateien wenigstens symbolisch mit dem Adelstitel des "Autors" zu entschädigen. Wem die Ironie solchen Tuns peinlich ist, der pflegt dem mitschwingenden (und nicht zu eskamotierenden) Anspruch durch die Beigabe von Klappentexten, Kritiken oder selbst verfassten Kurzinformationen (nicht selten zuvor bei Amazon eingeübt) nachzukommen. Dafür, dass die Beteiligten darunter leiden, ihre Klarnamen nicht preisgeben zu können und insofern - Ghostwritern nicht unähnlich - als Autoren ein Schattendasein führen zu müssen, gibt es bislang keine Anzeichen. Das stärkt die Vermutung, daß die Poster ihre Rolle als Imposteure, also als Simulanten (oder, nach Philip K. Dick, als Replikanten) durchaus genießen.
Man kann anhand solcher Entwicklungen einmal mehr den Niedergang des Abendlands diagnostizieren oder zumindest den Ausverkauf einer gesellschaftlich ebenso hoch angesehenen wie schlecht honorierten Kompetenz, der weit über das gekränkte Selbstbild von kulturellen Primärproduzenten hinaus weist, das Thierry Chervel zeichnet. Bei genauerer Betrachtung jedoch scheinen User und Blogger im Netz lediglich eine Tendenz zu vollstrecken, die sich mit der Überproduktion von Textfabrikanten vor allem in den geistes- und sozialwissenschaftlichen Fakultäten der Universitäten in den achtziger Jahren angekündigt hatte.
In einem heiter-sarkastischen Vortrag über die "Die Krise der Wiederholung in der Moderne" (hier als pdf-Dokument) hat Peter Sloterdijk unlängst den "Krullfaktor" literarischer Produktionen, insbesondere akademischer Provenienz ins Visier genommen und der Hochstapelei von Plagiatoren zwar die beachtliche Simulationsleistung, die sie erfordert, zugute gehalten, um dann doch angesichts der Masse an unlesbaren (und ungelesenen) universitären Schriftsachen wenigstens die "digitalen Sittenwächter" (die Zitatsuchprogramme) als letzte und unbestechliche Kontrollinstanz zu loben. Die keineswegs ironisch gemeinte Abschreckungsdoktrin, die allen Geistesdieben den Ernstfall der ansonsten kaum noch vorgesehenen Lektüre ("cave lectorem!") androht, ist aus dem Munde eines Professors verständlich, aber genau besehen mindestens inkonsequent. Nicht nur, weil die derart Vorgewarnten sich künftig hüten werden, Zitate wörtlich zu übernehmen. Die entscheidende Frage ist doch, warum Texte, die - mit oder ohne fremden Federschmuck - erkennbar und nachweislich keine eigene intellektuelle Leistung des Autors aufweisen (Kompilationsfleiß und paraphrasierende Phantasie lassen wir nicht gelten) überhaupt urheberrechtlichen Schutz sollen beanspruchen dürfen. Warum genügt es den angehenden wie den akkreditierten Mitgliedern einer Körperschaft im Dienste von "Wiederholungsverfahren" (Sloterdijk) nicht, für die Verfertigung ihrer administrativen Substrate mit einer durch "Scheinerwerb" (Sloterdijk) beglaubigten Karriere belohnt zu werden? Welcher narzisstische Dämon treibt sie an, die Agglomerate von affektbereinigten, fachterminologisch aufgerüsteten Standardsätzen, die sie als "persönliche Leistung" bescheinigt bekommen, auch noch als Buch zu veröffentlichen?
Dem Verfasser dieser Glossen wurde bereits 1981 ein Dissertationsstipendium an der FU Berlin mit der Begründung verweigert, die angegebene Literaturliste sei nicht lang genug, es fehle insbesondere die "Sekundärliteratur". Beim nächsten Anlauf ein Semester später hieß es dann: "Die Arbeit verspricht ein interessanter Essay zu werden, der wissenschaftliche Ertrag ist nicht gesichert." Es ging wohlgemerkt nicht um geophysikalische Probleme bei der Endlagerung von Atommüll, sondern um religionsphilosophische Alternativen zum apokalyptischen Denken. Man beachte das Pochen auf die zu erhebende Fachliteratur als Nachweis der Orientierung nicht an der Sache, sondern an interne Hierarchien der Institution. Qualifizieren tut sich, wem es gelingt, aus dem Wust der vorhandenen Sekundärliteratur ein überschaubares Exemplar von Tertiärliteratur zu kompilieren. In Sloterdijks Diktion: "Auf diese Weise generiert das akademische Schattenreich eine Textwelt zweiter Ordnung, in der junge real Ungelesene ältere, virtuell Ungelesene in Umlauf halten." Just gegen potentielle Lesbarkeit wendete sich darum der Essayismusverdacht, der zur zweiten Ablehnung führte: die NaFöG-Kommission ahndete, daß hier ein Kandidat offensichtlich nicht bereit war, alles aus seiner Dissertation zu verbannen, was den Anschein von stilistischem Eigenwillen oder gar selbstdenkerischer Umtriebigkeit erwecken konnte.
Im Lichte solcher Selektionsprozesse schrumpft aber der Unterschied zwischen der Hochstapelei mit Zitatnachweis und jener ohne auf die Differenz zwischen Bioeiern mit individuellem Herkunftsstempel auf der Schale und solchen mit generischem Verpackungsaufdruck. Daher verwundert es doch, wenn ausgerechnet der begabteste deutsche Transzendentalbelletrist auf die Wahrung von "geistigem Eigentum" an Texten insistiert, aus denen der Geist vollständig ausgetrieben und der Eigentumstitel de facto einer anonymen Diskursgemeinschaft übertragen wurde. Gefragt ist in dieser Situation weniger die verschärfte Lektüre von Suchmaschinen als vielmehr eine Bundesprüfstelle zur Evaluierung tatsächlich vorhandener, unverwechselbarer geistiger Regsamkeit (Formulierungskunst inbegriffen) beim Zustandekommen einer Arbeit, die dann im - unwahrscheinlichen - Fall eines positiven Bescheids das betreffende Produkt mit einem urheberrechtlich gültigen Zertifikat versehen würde. Angesehen der gigantischen Fülle der zu bewältigenden Schriftstücke würde ein solches Amt mit all seinen regionalen und kommunalen Ablegern nebenbei Legionen arbeitsloser Akademiker einen krisensicheren Job verschaffen. Daß dabei nicht die Böcke zu Gärtnern gemacht werden, ist zweifellos ein Rekrutierungsproblem, aber eines, das sich mit einiger Phantasie lösen ließe - zum Beispiel indem man die kritische Lektüre grundsätzlich Fachfremden anvertraut.
Leider hat die Mesalliance von Hochstapelei und Mediokrität, die man historisch als Preis für die Massendemokratisierung von Hochschulabschlüssen verbuchen muss, weit über die Grenzen des Campus hinaus auf den Kulturbetrieb im ganzen, in den nach wie vor die meisten Absolventen entlassen werden, ausgestrahlt. Zum inflationär aufgeblähten Krullfaktor gehört schon seit Jahrzehnten, dass jeder Werbetexter sich "Schriftsteller" schimpft und jeder Journalist als "Intellektueller" apostrophiert wird. Da diese Berufsbezeichnungen nicht geschützt sind, verführt diese Nobilitierung von Hinzundkunz zu Wortmagiern und Reflexionsakrobaten zur allseitigen wohlfeilen Nachahmung mit tendenziell abnehmendem Wiedererkennungseffekt. Den traurigen Tiefpunkt dieser Verfallslogik berichtete ein befreundeter (derzeit erwerbsloser) Philosoph erst vor kurzem: Als er seine Sachbearbeiterin in einer der staatlichen Arbeitsagenturen fragte, wie sie darauf käme, daß die Tätigkeit als Ladenverkäufer einem Intellektuellen zumutbar sei, antwortete sie pampig (und wörtlich): "Was heißt hier schon Intellektueller, ich habe auch einen akademischen Titel und war mir nicht zu schade, andere Arbeiten als meine jetzige anzunehmen." Dieser Gesinnung zufolge würden dann auch an den Börsen nichts als "Intellektuelle" zocken, die, wenn sie halbstündlich ihr Bulletin über Gewinne und Verluste in Telegrammdeutsch updaten, sogar zeitweise zu Epigrammatikern mutierten. Schon ihre Unzahl ist Frevel, möchte man Stefan George korrigieren, und schon die bloße Unzahl desavouiert das exklusive Selbstverständnis aller Akteure. Anders gesagt: Wo Hochstapelei generalisiert wird, schwindet nicht nur die selbstkritische Distanz gegenüber der eigenen Produktion (und die Ahnung, wieviel man anderen dafür verdankt), es schwinden vor allem Anerkennung und Respekt für Talente, Vermögen und Kompetenzen, die keine Unbedenklichkeit dank eines prominenten Status ihrer Träger genießen.
Was nun die Stammhalter von Autorschaft im engeren Sinne, die Schriftsteller, die diesen Namen verdienen und die bislang so wenig Lust zum Bloggen verspüren wie "die letzten Mohikaner" auf Small talk, so hat Karl-Heinz Ott in einem eindringlichen Plädoyer für die notwendige Weltfremdheit ihrer Arbeit im Grunde alles gesagt. Es sei nur ein pragmatischer Gesichtspunkt hinzugefügt: Wem das Schreiben ethische Verpflichtung, intellektuelle Herausforderung und stilistische Präzisionskunst ist, der arbeitet zwangsläufig langsam und mit störungsanfälligen Routinen, die sich nicht mal eben zwischendurch in einen Bloggermodus umschalten lassen. Und selbst das Schwätzchen mit dem Leser, das Paolo Coelho als Ideal eines bloggenden Romanciers vorschwebt, kostet schlicht und einfach Zeit. Würden freiberufliche Autoren - im Gegensatz zu Prominenten und Professoren, Chefredakteuren, Filmemachern, Architekten und Designern - nicht überwiegend, trotz zeitraubender Quersubventionierungen, am Existenzminimum entlang wirtschaften, dann könnte man über eine solche generöse Gabe reden, vorausgesetzt die Onlineleser wären bereit, manche Sätze mehr als einmal zu lesen. Was wir für eine wünschenswerte Steigerung der Gratisdiffusion kreativer und durchdachter Texte (Bilder, Filme, Musikstücke) im Internet demnach brauchen, ist ein Grundeinkommen für alle Schlechterverdienenden unter den Kulturschaffenden.
Dieses werden besonders Schriftsteller (sofern sie nicht das Erbe der Vorfahren in Vers und Prosa versetzen) künftig immer dringender benötigen, da ihre Population antizyklisch zum Gesellschaftstrend ebenso wächst wie das Wissen jedes Einzelnen um die enormen Bestände an bereits vorhandener und unvermindert gültiger Literatur. Von dem Anspruch, etwas Individuelles, Inkommensurables zu produzieren, das unbedingt in Werkform gegossen werden muss, werden andererseits gerade sie (schon berufsbedingt) als letzte lassen können. Denn wenn die Beobachtung stimmt, dass die Individualität aus den Werken schwindet in dem Maße, da sich ihre Produzenten vervielfältigen und des Profilierungszwangs müde alle Energien der Abweichung, der Innovation und Gestaltung lieber in alternative, verwandlungsmächtige Alltagsentwürfe umleiten, so profitieren davon allein die bildkünstlerisch, audiovisuell und musisch Begabten, denen - im Rahmen eines erweiterten, das heißt werkfernen Kunstbegriffs - ungleich größere Betätigungsfelder zur Verfügung stehen als Schreibtische mit Tastaturen und Monitoren.
Das Selbstbild, wenn nicht gar die Existenzgrundlage schreibender Autoren sieht sich künftig noch von einer ganz anderen Seite bedroht. Wer sich die Mühe macht, auf der Suche nach einer (im Handel längst nicht mehr erhältlichen) historischen Aufnahme - sagen wir jetzt lieber von Georges "Entflieht auf leichten Kähnen", wunderbar für Chor gesetzt von Anton Webern - einmal einen russischen Musikblog anzusteuern und mangels Sprachkenntnisse den Google-Übersetzer aktiviert, wird je nach Art und Informationsdichte des kyrillischen Schriftsatzes mit Kostproben experimenteller Literatur belohnt werden, die es an Originalität, Verschrobenheit und Wortwitz mit dem Besten aufnehmen, was diese Disziplin vermeintlich höheren (metaphysischen) Unfugs von Gertrude Stein über Arno Schmidt bis Oskar Pastior zu bieten hat. Es wäre ein Leichtes, eine Kompilation solcher Trouvaillen zu edieren und das Endprodukt samt Urheber - das nämliche Übersetzerprogramm - für den Literaturnobelpreis zu indizieren.
Daniele Dell'Agli
Kommentieren