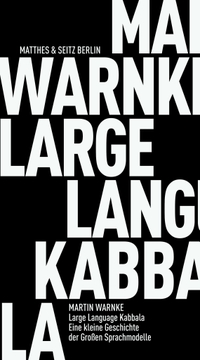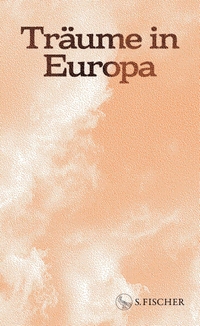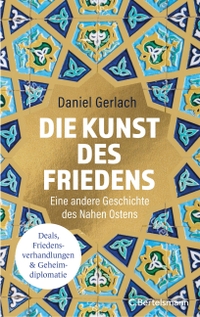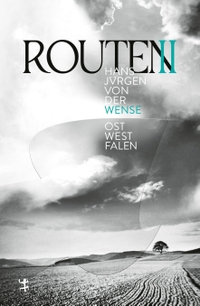Magazinrundschau
Andrzej Szahaj: Soll der Liberalismus doch welken
Ein Blick in internationale Magazine. Jeden Dienstag ab 10 Uhr.
08.05.2007. The Nation wünscht sich etwas mehr Debattenkultur bei amerikanischen Politikern. Im Nouvel Obs streiten Bernard-Henri Levy und Andre Glucksmann über Royal und Sarkozy. Outlook India untersucht die Lage der Frauen in Pakistan. In der London Review setzt sich Judith Butler mit Hannah Arendt auseinander. Elet es Irodalom fragt sich, warum die EU für Mausefallen, nicht aber Raketenabwehrsysteme zuständig sein soll. Die Gazeta Wyborcza denkt über den größten Unterschied zwischen Europäern und Amerikanern nach. In der Weltwoche möchte Lawrence Wright von Al Qaida wissen, was sie eigentlich politisch anzubieten hat. Der New Statesman betrachtet deprimiert das Erbe Tony Blairs.
The Nation (USA), 04.05.2007
 Nicholas von Hoffman schwärmt exklusiv im Internet von französischen Präsidentschaftskandidaten, die sich zweieinhalb Stunden lang ohne Unterbrechung beharken. "Hin und her ging es hier, wie unter Erwachsenen. Auch die Debatte zwischen Abraham Lincoln und Stephen A. Douglas zur Frage der Sklaverei und der Zukunft der Union im Jahr 1858 ging über Stunden. Was dagegen heutzutage unter politischer Debatte läuft, ist nicht mehr als ein Tonschnipsel. Die republikanischen Kandiaten waren in einer Talkshow aufgerufen, nicht länger als sechzig Sekunden zu antworten. Derartige Begrenzungen sind die Regel in der amerikanischen Debattenkultur und lassen vermuten, dass diese Politiker nicht fähig sind, ein Thema in mehr als 100 Wörtern zu behandeln. Danach geht ihnen anscheinend das Material aus. Sie sind auf kurze Ausbrüche abgerichtet, mehr nicht."
Nicholas von Hoffman schwärmt exklusiv im Internet von französischen Präsidentschaftskandidaten, die sich zweieinhalb Stunden lang ohne Unterbrechung beharken. "Hin und her ging es hier, wie unter Erwachsenen. Auch die Debatte zwischen Abraham Lincoln und Stephen A. Douglas zur Frage der Sklaverei und der Zukunft der Union im Jahr 1858 ging über Stunden. Was dagegen heutzutage unter politischer Debatte läuft, ist nicht mehr als ein Tonschnipsel. Die republikanischen Kandiaten waren in einer Talkshow aufgerufen, nicht länger als sechzig Sekunden zu antworten. Derartige Begrenzungen sind die Regel in der amerikanischen Debattenkultur und lassen vermuten, dass diese Politiker nicht fähig sind, ein Thema in mehr als 100 Wörtern zu behandeln. Danach geht ihnen anscheinend das Material aus. Sie sind auf kurze Ausbrüche abgerichtet, mehr nicht." Nouvel Observateur (Frankreich), 03.05.2007
 Andre Glucksmann und Bernard-Henri Levy führen im Nouvel Obs ein leidenschaftliches Gespräch über ihr Engagement im französischen Wahlkampf. Es wurde zwar noch vor dem zweiten Wahlgang aufgezeichnet, reißt aber einige kommende Perspektiven auf. Levy, der selbst für Segolene Royal optierte, bekennt gegenüber dem Interviewer seine Irritation über Glucksmanns Votum für Sarkozy: "Was mich überrascht hat, ist, dass er sich so früh engagiert hat und dass er ein solches Feuer hineinlegt - eine Leidenschaft, die wir gemeinsam seit dreißig Jahren für bosnische Widerstandskämpfer, tschetschenische Märtyrer und sowjetische Dissidenten reserviert hatten, denen wir entscheidenden Lektionen über Geschmack und Sinn der Freiheit verdankten." BHL wirft Sarkozy, der im Wahlkampf ein Ministerium für Immigration und nationale Identität gefordert hat, einen an Le Pen gemahnenden Populismus vor. Glucksmann antwortet: "Was das famose 'Ministerium' angeht, so weißt du genauso gut wie ich, dass Sarkozys Begriff der nationalen Identität nicht ethnisch, sondern republikanisch ist und auf der Integration vieler nachfolgender Wellen der Immigration beruhte, zu denen auch seine eigene Familie gehörte. Sarkozy hat uns von der Last befreit, die der Front national auf das demokratische Leben in Frankreich gelegt hatte."
Andre Glucksmann und Bernard-Henri Levy führen im Nouvel Obs ein leidenschaftliches Gespräch über ihr Engagement im französischen Wahlkampf. Es wurde zwar noch vor dem zweiten Wahlgang aufgezeichnet, reißt aber einige kommende Perspektiven auf. Levy, der selbst für Segolene Royal optierte, bekennt gegenüber dem Interviewer seine Irritation über Glucksmanns Votum für Sarkozy: "Was mich überrascht hat, ist, dass er sich so früh engagiert hat und dass er ein solches Feuer hineinlegt - eine Leidenschaft, die wir gemeinsam seit dreißig Jahren für bosnische Widerstandskämpfer, tschetschenische Märtyrer und sowjetische Dissidenten reserviert hatten, denen wir entscheidenden Lektionen über Geschmack und Sinn der Freiheit verdankten." BHL wirft Sarkozy, der im Wahlkampf ein Ministerium für Immigration und nationale Identität gefordert hat, einen an Le Pen gemahnenden Populismus vor. Glucksmann antwortet: "Was das famose 'Ministerium' angeht, so weißt du genauso gut wie ich, dass Sarkozys Begriff der nationalen Identität nicht ethnisch, sondern republikanisch ist und auf der Integration vieler nachfolgender Wellen der Immigration beruhte, zu denen auch seine eigene Familie gehörte. Sarkozy hat uns von der Last befreit, die der Front national auf das demokratische Leben in Frankreich gelegt hatte." Outlook India (Indien), 14.05.2007
 Unter Pakistans Frauen geht die Angst um, berichtet Mariana Baabar. "Gerade erst gestern fuhr Tahera Abdullah die schicke Margalla Road in Islamabad entlang, das Fenster heruntergekurbelt, damit sie die Abendluft genießen konnte. Das silberne Haar der Entwicklungshelferin zeigt jedem, dass sie über 50 ist. Als Tahera an einer Ampel hielt, sprach sie ein Achtjähriger an: ob sie nicht wisse, dass der Islam von ihr verlange, dass sie ihren Kopf bedeckt. Tahera kurbelte sofort das Fenster hoch. 'Wie diskutiert man mit einem Achtjährigen', fragt sie. Aber die Begegnung mit Pakistans religiösem Extremismus, zugleich einschüchternd und kindisch, hat Tahera veranlasst, künftig lieber schwitzend mit geschlossenen Fenstern zu fahren. 'Wir Frauen fühlen uns heute immer bedrohter', sagt sie. Die Straßen von Islamabad sind gefährlich für Frauen, sie verlangen von ihnen zu sein, was sie nicht sind, was sie nie waren. Der Beraterin Sara Javeed wurde das bewusst, als sie sich kürzlich im Auto eine Zigarette anzündete. 'Ich drückte sie schnell wieder aus. Ich will nicht, dass Fremde mich fragen, warum ich rauche. Das ist neu für mich', sagt sie traurig."
Unter Pakistans Frauen geht die Angst um, berichtet Mariana Baabar. "Gerade erst gestern fuhr Tahera Abdullah die schicke Margalla Road in Islamabad entlang, das Fenster heruntergekurbelt, damit sie die Abendluft genießen konnte. Das silberne Haar der Entwicklungshelferin zeigt jedem, dass sie über 50 ist. Als Tahera an einer Ampel hielt, sprach sie ein Achtjähriger an: ob sie nicht wisse, dass der Islam von ihr verlange, dass sie ihren Kopf bedeckt. Tahera kurbelte sofort das Fenster hoch. 'Wie diskutiert man mit einem Achtjährigen', fragt sie. Aber die Begegnung mit Pakistans religiösem Extremismus, zugleich einschüchternd und kindisch, hat Tahera veranlasst, künftig lieber schwitzend mit geschlossenen Fenstern zu fahren. 'Wir Frauen fühlen uns heute immer bedrohter', sagt sie. Die Straßen von Islamabad sind gefährlich für Frauen, sie verlangen von ihnen zu sein, was sie nicht sind, was sie nie waren. Der Beraterin Sara Javeed wurde das bewusst, als sie sich kürzlich im Auto eine Zigarette anzündete. 'Ich drückte sie schnell wieder aus. Ich will nicht, dass Fremde mich fragen, warum ich rauche. Das ist neu für mich', sagt sie traurig."Warum darf ich nicht in Westbengalen leben, fragt verzweifelt die bangladeschische Autorin Taslima Nasreen, die ihr eigenes Land seit zwölf Jahren nicht mehr betreten darf, jahrelang in Europa lebte und sich nun schon seit längerem um ein unbegrenztes Aufenthaltsrecht in Indien bewirbt. "Ist das wirklich zuviel verlangt? Ich nehme niemandem den Job weg. Ich möchte nur das Leben eines Schriftstellers leben. Als Autor sehne ich mich nach meiner Sprache, ich sehne mich danach, mit Menschen aus meiner Kultur zusammenzuleben - ist das so ungerechtfertigt? Westeuropa hat mein Leben gerettet, ich hoffe, dass Indien mich als Schriftstellerin retten wird." Und sie erinnert noch einmal daran, warum sie nicht mehr nach Bangladesch zurück darf: Nicht weil sie gestohlen, betrogen oder gemordet hat. Sondern weil sie gegen die Diskriminierung der Frauen durch den Islam protestiert hat.
London Review of Books (UK), 10.05.2007
 Die Philosophin Judith Butler ("Das Unbehagen der Geschlechter") bespricht einen Band mit den "Jewish Writings" der Philosophin Hannah Arendt. Ausführlich referiert Butler viele der Positionen Hannah Arendts, zu den aktuell diskutierten Themen Nationalstaat und Souveränität hat sie aber noch einige Fragen: "Arendts Widerstand gegen die Enteignungen, die eine jede Minderheit treffen, bedeutet eine Abweichung vom jüdischen Denken über Gerechtigkeit. Ihre Position besteht nicht in der Universalisierung des Jüdischen, sondern widersetzt sich dem mit Staatenlosigkeit verbundenen Leiden ganz unabhängig von der staatlichen Zugehörigkeit. Dass die 'Nation' die Grenze ihrer Konzeption der enteigneten Minderheit darstellt, ist klar - und sie lässt eine Reihe wichtiger Fragen unbeantwortet: Gibt es ein 'Außerhalb' zu jeder föderalen Politik? Muss eine Föderation im Kontext internationaler Beziehungen ihre 'Souveränität' behaupten? Können internationale Beziehungen auf der Basis föderativer Politik organisiert werden und, wenn ja: Können internationale Föderationen ihre Gesetze ohne Rückgriff auf Souveränität durchsetzen?"
Die Philosophin Judith Butler ("Das Unbehagen der Geschlechter") bespricht einen Band mit den "Jewish Writings" der Philosophin Hannah Arendt. Ausführlich referiert Butler viele der Positionen Hannah Arendts, zu den aktuell diskutierten Themen Nationalstaat und Souveränität hat sie aber noch einige Fragen: "Arendts Widerstand gegen die Enteignungen, die eine jede Minderheit treffen, bedeutet eine Abweichung vom jüdischen Denken über Gerechtigkeit. Ihre Position besteht nicht in der Universalisierung des Jüdischen, sondern widersetzt sich dem mit Staatenlosigkeit verbundenen Leiden ganz unabhängig von der staatlichen Zugehörigkeit. Dass die 'Nation' die Grenze ihrer Konzeption der enteigneten Minderheit darstellt, ist klar - und sie lässt eine Reihe wichtiger Fragen unbeantwortet: Gibt es ein 'Außerhalb' zu jeder föderalen Politik? Muss eine Föderation im Kontext internationaler Beziehungen ihre 'Souveränität' behaupten? Können internationale Beziehungen auf der Basis föderativer Politik organisiert werden und, wenn ja: Können internationale Föderationen ihre Gesetze ohne Rückgriff auf Souveränität durchsetzen?" Weitere Artikel: Michael Dobson hat die Shakespeare-Ausgabe der Royal Shakespeare Society genau unter die Lupe genommen. Thomas Jones befasst sich mit Darren Wershler-Henry Darstellung der Geschichte der Schreibmaschine, die unter dem Titel "The Iron Whim: A Fragmented History of Typewriting" erschienen ist.
Elsevier (Niederlande), 07.05.2007
 "Unverbindliches Geplapper" schimpft Leon de Winter beim Lesen von Jan Pronks Rede "Freiheit ohne Grenzen" zum Nationalfeiertag am 5. Mai, dem niederländischen "Bevrijdingsdag". Der prominente Politiker und UN-Sonderbeauftragter schütte über den ganzen Text "eine Busladung Selbstkritik und Schuldbewusstsein. Er möchte, dass wir nicht einfach so frei sind, sondern frei um zu geben, oder so ähnlich. Klischees umranken diese Rede, dass es eine liebe Lust ist und wer sie aufmerksam liest, wird feststellen, dass dort eigentlich nichts steht."
"Unverbindliches Geplapper" schimpft Leon de Winter beim Lesen von Jan Pronks Rede "Freiheit ohne Grenzen" zum Nationalfeiertag am 5. Mai, dem niederländischen "Bevrijdingsdag". Der prominente Politiker und UN-Sonderbeauftragter schütte über den ganzen Text "eine Busladung Selbstkritik und Schuldbewusstsein. Er möchte, dass wir nicht einfach so frei sind, sondern frei um zu geben, oder so ähnlich. Klischees umranken diese Rede, dass es eine liebe Lust ist und wer sie aufmerksam liest, wird feststellen, dass dort eigentlich nichts steht."Ähnlich viele "Worte statt Taten" entdeckt Elsevier-Kommentator Gertjan van Schoonhoven beim Rückblick auf die fünf Jahre, die seit dem Mord an Rechtspopulist Pim Fortuyn vergangen sind. "Erst gab es die Debatte, warum es in den Jahren vor Fortuyn keine Debatte gegeben hatte, dann wurde darüber debattiert, ob die Debatte denn noch sinnvoll sei, und zum Schluss wurden die Grenzen der Debatte debattiert. Die Hauptenergie der letzten Jahre versickerte in verbalen Aktivitäten: Probleme benennen, Probleme 'diskutieren' und dann natürlich auch Probleme überhaupt erst 'diskutierbar machen'. Das mag jetzt kein 'Ausverkauf' Fortuynscher Ideen sein, aber als 'Erbe' ist es doch ziemlich einseitig."
Elet es Irodalom (Ungarn), 07.05.2007
 Die EU darf den Polen und Tschechen das Rauchen verbieten. Aber wenn sie ein US-Raketenabwehrsystem auf dem Gebiet der EU stationieren wollen, geht sie das nach Ansicht von Washington, Warschau und Prag nichts an. Das findet Kolumnist Istvan Vancsa völlig absurd: "Das US-Raketenabwehrsystem würde die sicherheitspolitische Lage der EU grundsätzlich verändern und ihr Territorium zum potentiellen Ziel militärischer Angriffe machen. Washington und Moskau meinen trotzdem, dass die EU nichts damit zu tun habe und sich weiterhin nur mit der Standardisierung von Mäusefallen und der EU-konformen Reinigung von Eierschalen zu befassen hat."
Die EU darf den Polen und Tschechen das Rauchen verbieten. Aber wenn sie ein US-Raketenabwehrsystem auf dem Gebiet der EU stationieren wollen, geht sie das nach Ansicht von Washington, Warschau und Prag nichts an. Das findet Kolumnist Istvan Vancsa völlig absurd: "Das US-Raketenabwehrsystem würde die sicherheitspolitische Lage der EU grundsätzlich verändern und ihr Territorium zum potentiellen Ziel militärischer Angriffe machen. Washington und Moskau meinen trotzdem, dass die EU nichts damit zu tun habe und sich weiterhin nur mit der Standardisierung von Mäusefallen und der EU-konformen Reinigung von Eierschalen zu befassen hat." Aus der letzten Ausgabe, die verspätet online ging: Ungarn hat einen neuen Stasi-Skandal: Der Journalist Peter Kende hat am 27. April in der Wochenzeitung enthüllt, der ehemalige ungarische Außenminister Janos Martonyi habe in den 1960er Jahren dem ungarischen Geheimdienst Berichte geliefert. Das belegten Akten der Staatssicherheit. Demnach habe Martonyi während seines Studiums unter anderem über die ungarische Emigrantenszene in Deutschland und Frankreich Berichte angefertigt. Martonyi gehört der rechtskonservativen Partei Fidesz an, die den regierenden Sozialisten konsequent Stasivergangenheit vorwirft. Kende kommentiert: "Gibt es etwas Wichtigeres, als die Glaubwürdigkeit eines Außenministers? Das ist für das internationale Renommee unseres Landes, aber auch für die innenpolitische Rolle eines Politikers maßgebend." Kende schreibt, Martonyi habe in einem Gespräch mit ihm am 16. April 2007 eingeräumt, identisch mit IM "Marosvasarhelyi" gewesen zu sein. Nach Erscheinen des Artikels wies Martonyi gegenüber der ungarischen Presseagentur MTI alle Vorwürfe zurück.
Europa (Polen), 05.05.2007
 Nachdem der Liberalismus als gesellschaftliches und weltanschauliches Konzept momentan in Polen ins Hintertreffen geraten ist, entwickelt sich im Magazin der Tageszeitung Dziennik eine Debatte über notwendige Veränderungen. Hatte Agata Bielik-Robson vor kurzem noch gefordert, dem Liberalismus etwas mehr Leben und Lebensfreude einzuhauchen, antwortet der Philosoph Andrzej Szahaj betont kühl: "Wenn das Welken des Liberalismus darin besteht, dass er stur an einer Vervollkommnung der gesellschaftlichen Verhältnisse arbeiten will, statt revolutionäre Umstürze zu fordern; dass er Versöhnung und Kompromiss will, statt Kampf auf Leben und Tod; dass er nicht im Namen einer Großen Idee Menschen verletzt, und dass er am sozialen Frieden festhält, dann soll er ruhig welken. Zum Wohl!"
Nachdem der Liberalismus als gesellschaftliches und weltanschauliches Konzept momentan in Polen ins Hintertreffen geraten ist, entwickelt sich im Magazin der Tageszeitung Dziennik eine Debatte über notwendige Veränderungen. Hatte Agata Bielik-Robson vor kurzem noch gefordert, dem Liberalismus etwas mehr Leben und Lebensfreude einzuhauchen, antwortet der Philosoph Andrzej Szahaj betont kühl: "Wenn das Welken des Liberalismus darin besteht, dass er stur an einer Vervollkommnung der gesellschaftlichen Verhältnisse arbeiten will, statt revolutionäre Umstürze zu fordern; dass er Versöhnung und Kompromiss will, statt Kampf auf Leben und Tod; dass er nicht im Namen einer Großen Idee Menschen verletzt, und dass er am sozialen Frieden festhält, dann soll er ruhig welken. Zum Wohl!" Guardian (UK), 05.05.2007
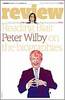 Peter Wilby hat rund zehn Biografien über Tony Blair gelesen, kann sich aber immer noch kein Bild darüber machen, wer eigentlich zehn Jahre lang Großbritannien regiert hat. Einen Mann ohne Schatten nennt er ihn. "Biografen und andere Autoren haben lange versucht, sich ein Bild von seinem Leben zu machen, Bedeutung darin zu finden. Er hat ihnen keine Chance gegeben. Er ist kein Thatcherist, kein Tory, kein Liberaler und ganz bestimmt kein Sozialdemokrat." Man könne nicht einmal sagen, dass er Labour betrogen hat, weil er sich der Partei nie verpflichtet gefühlt hatte. "Die einzige Erklärung, warum er überhaupt in die Politik gegangen ist, gab er 1989 in einen Interview: 'Naja, du siehst dir die Welt um dich herum an. Denkst dir, da stimmt was nicht. Und willst es ändern.'"
Peter Wilby hat rund zehn Biografien über Tony Blair gelesen, kann sich aber immer noch kein Bild darüber machen, wer eigentlich zehn Jahre lang Großbritannien regiert hat. Einen Mann ohne Schatten nennt er ihn. "Biografen und andere Autoren haben lange versucht, sich ein Bild von seinem Leben zu machen, Bedeutung darin zu finden. Er hat ihnen keine Chance gegeben. Er ist kein Thatcherist, kein Tory, kein Liberaler und ganz bestimmt kein Sozialdemokrat." Man könne nicht einmal sagen, dass er Labour betrogen hat, weil er sich der Partei nie verpflichtet gefühlt hatte. "Die einzige Erklärung, warum er überhaupt in die Politik gegangen ist, gab er 1989 in einen Interview: 'Naja, du siehst dir die Welt um dich herum an. Denkst dir, da stimmt was nicht. Und willst es ändern.'"Die australische DDR-Historikerin Anna Funder ("Stasi-Land") erklärt, warum "Das Leben der Anderen" vielleicht ein schöner Film sei, aber nichts mit der hässlichen Realität des Stasi-Apparats gemein habe. Zum Buch der Woche gekürt wird Nicola Barkers "phänomenal gutes" 840-Seiten-Epos "Darkmans".
Gazeta Wyborcza (Polen), 05.05.2007
 "Eines unterscheidet Amerikaner von Europäern und erklärt, warum erstere eine Nation sind, und letztere ein geografischer Terminus: Jedes Jahr ziehen 3 Prozent der Amerikaner von Staat zu Staat, während in der EU lediglich 1,7 Prozent in einem anderen als das Geburtsland leben". Für Witold Gadomski steht somit fest: "Ohne Mobilität wären die USA heute ein Mosaik aus Nationen, die ihre Ethnie zelebrieren und verschiedene Sprachen sprechen. Mobilität fördert die Dynamik und Innovation der amerikanischen Wirtschaft. Eine wirkliche Integration kann in der EU nur dann gelingen, wenn eine Völkerwanderung einsetzt, viel größer als die heutige Arbeitsmigration aus Mitteleuropa." Dafür seien aber Anstrengung seitens der EU-Institutionen und der nationalstaatlichen Regierungen - besonders Deutschlands und Frankreichs - notwendig, so Gadomski.
"Eines unterscheidet Amerikaner von Europäern und erklärt, warum erstere eine Nation sind, und letztere ein geografischer Terminus: Jedes Jahr ziehen 3 Prozent der Amerikaner von Staat zu Staat, während in der EU lediglich 1,7 Prozent in einem anderen als das Geburtsland leben". Für Witold Gadomski steht somit fest: "Ohne Mobilität wären die USA heute ein Mosaik aus Nationen, die ihre Ethnie zelebrieren und verschiedene Sprachen sprechen. Mobilität fördert die Dynamik und Innovation der amerikanischen Wirtschaft. Eine wirkliche Integration kann in der EU nur dann gelingen, wenn eine Völkerwanderung einsetzt, viel größer als die heutige Arbeitsmigration aus Mitteleuropa." Dafür seien aber Anstrengung seitens der EU-Institutionen und der nationalstaatlichen Regierungen - besonders Deutschlands und Frankreichs - notwendig, so Gadomski.Und: Noch bis zum 10. Mai dauert das Warschauer Filmfestival "Jüdische Motive" an. "Das wichtigste Thema ist die jüdische Emigration aus Polen nach dem Zweiten Weltkrieg und die nicht verheilten Wunden nach der antisemitischen Kampagne von 1968. Nicht jedoch die Politik steht dabei im Vordergrund, sondern private, emotionsgeladene Geschichten der Auswanderer", schreibt Pawel T. Felis.
Foglio (Italien), 05.05.2007
Eine Dame mit dem schönen Namen Michaela Vittoria Barmbilla, die von sich behauptet, keine Politikerin, sondern Unternehmerin zu sein, könnte der kleinste gemeinsame Nenner einer vereinigten Mitte-Rechts Partei werden. "Ecce homo novus berlusconianus", verkündet Marianna Rizzini. Dieser homo berluscionianus ist "ein ernstzunehmender Kandidat für den Premierposten. Er ist kein Politiker, dieser neue Mensch. Er ist überhaupt kein Mann, auch wenn er von sich immer in mannhafter Weise spricht. Er ist eine großgewachsene Frau mit langen Haaren, in einem schönen hellen Rot mit einem Hauch Orange, wie ein Blogger nach ihrem Auftritt in Ballaro bemerkte. Sie heißt Michaela Vittoria und hat diesen ruhigen lombardischen Familiennamen Brambilla. Als Enddreißiggerin ist sie sie Präsidentin des Handelsverbands Confcommercio, sitzt im Vorstand zweier Unternehmen und ist Präsidentin der Circoli della Liberta."
Weitere Artikel: Joe Warren porträtiert Rupert Murdoch. Eduardo Camurri fragt sich, ob das Fernsehen nicht in unguter Weise dem Schöpfer Konkurrenz macht. Angiolo Bandinelli erinnert sich an die koloniale Vergangenheit Italiens.
Weitere Artikel: Joe Warren porträtiert Rupert Murdoch. Eduardo Camurri fragt sich, ob das Fernsehen nicht in unguter Weise dem Schöpfer Konkurrenz macht. Angiolo Bandinelli erinnert sich an die koloniale Vergangenheit Italiens.
Economist (UK), 04.05.2007
 Besprochen werden die politischen Memoiren des ehemaligen tschechischen Präsidenten Vaclav Havel, die der Economist durchaus einzigartig findet: "Vaclav Havel mischt offizielle Chronik, Satire, Abrechnung, selbstkritische Apologie und lebenskluge Gedanken zur Staatskunst zusammen, ohne auf chronologische Abfolge oder säuberliche Einführungen zu achten. Aus dem scheinbaren Chaos entsteht aber ein Muster. Am Ende hat man eindeutig das Gefühl, mit Havels komplizierter Persönlichkeit - er ist kantig, schüchtern, ohne dass man es äußerlich merkt - vertraut geworden zu sein und zugleich überzeugend dargestellt bekommen zu haben, was Aufrichtigkeit und moralische Autorität, wenn die Zeiten danach sind, in der Politik vermögen."
Besprochen werden die politischen Memoiren des ehemaligen tschechischen Präsidenten Vaclav Havel, die der Economist durchaus einzigartig findet: "Vaclav Havel mischt offizielle Chronik, Satire, Abrechnung, selbstkritische Apologie und lebenskluge Gedanken zur Staatskunst zusammen, ohne auf chronologische Abfolge oder säuberliche Einführungen zu achten. Aus dem scheinbaren Chaos entsteht aber ein Muster. Am Ende hat man eindeutig das Gefühl, mit Havels komplizierter Persönlichkeit - er ist kantig, schüchtern, ohne dass man es äußerlich merkt - vertraut geworden zu sein und zugleich überzeugend dargestellt bekommen zu haben, was Aufrichtigkeit und moralische Autorität, wenn die Zeiten danach sind, in der Politik vermögen."Weitere Artikel: Der Economist macht auf die rasante Tendenz zur globalen Urbanisierung aufmerksam: "Das schiere Ausmaß, die schiere Geschwindigkeit der aktuellen Expansion des Städtischen unterscheidet sie von allen bisherigen Veränderungen in der Geschichte der Städte. Diese Expansion besteht im nicht dagewesenen Zuzug der Armen, die dann eine bisher ebenfalls nicht dagewesene Zahl von Kindern produzieren." Kommentiert werden die Pläne Rupert Murdochs, das Medienunternehmen Dow Jones aufzukaufen.
Die Titelgeschichte widmet sich dem "Kampf um die türkische Seele". Im Leitartikel zum Thema stellt der Economist fest: "Falls es dazu kommt, dass die Türken sich entscheiden müssen, ist die Demokratie wichtiger als der Säkularismus".
Times Literary Supplement (UK), 04.05.2007
 Vergrößert oder schmälert das Internet die Ungleichheit? Jon Garvie hat mit großem Interesse Kieron O?Haras und David Stevens' Buch "Inequality.com" zum Thema gelesen: "Wir produzieren jährlich eine Menge an digitalen Informationen, die der Summe aller in der Menschheitsgeschichte gesprochenen Wörtern entspricht, wenn auch die übergroße Mehrheit aus banalen persönlichen Trivialitäten besteht. Und während der Westen Schnappschüsse aus dem Urlaub hochlädt, Musik runterlädt und über Pornoseiten surft, verändert sich das politische Verhältnis zwischen Bürgern, Staat und Wirtschaft auf subtile, aber fundamentale Weise. Die Autoren argumentieren, dass digitale Ungleichheit sich nicht nur auf Zugang und Verteilung beziehen sollte, sondern auch auf den Verlust grundlegender Freiheitsrechte (zum Beispiel das Recht auf eine Privatsphäre), den wir regelmäßig über uns ergehen lassen, um beschleunigte soziale und kommerzielle Interaktionen zu genießen. Die Universalität von Handys versorgt Regierung und Unternehmen mit der Fähigkeit, unsere Bewegungen zu überwachen, unsere Handlungen zu interpretieren und unsere Wünsche vorwegzunehmen."
Vergrößert oder schmälert das Internet die Ungleichheit? Jon Garvie hat mit großem Interesse Kieron O?Haras und David Stevens' Buch "Inequality.com" zum Thema gelesen: "Wir produzieren jährlich eine Menge an digitalen Informationen, die der Summe aller in der Menschheitsgeschichte gesprochenen Wörtern entspricht, wenn auch die übergroße Mehrheit aus banalen persönlichen Trivialitäten besteht. Und während der Westen Schnappschüsse aus dem Urlaub hochlädt, Musik runterlädt und über Pornoseiten surft, verändert sich das politische Verhältnis zwischen Bürgern, Staat und Wirtschaft auf subtile, aber fundamentale Weise. Die Autoren argumentieren, dass digitale Ungleichheit sich nicht nur auf Zugang und Verteilung beziehen sollte, sondern auch auf den Verlust grundlegender Freiheitsrechte (zum Beispiel das Recht auf eine Privatsphäre), den wir regelmäßig über uns ergehen lassen, um beschleunigte soziale und kommerzielle Interaktionen zu genießen. Die Universalität von Handys versorgt Regierung und Unternehmen mit der Fähigkeit, unsere Bewegungen zu überwachen, unsere Handlungen zu interpretieren und unsere Wünsche vorwegzunehmen."Besprochen werden außerdem Lew Losews bisher nur auf Russisch erschienener Essay über "Joseph Brodsky", Wilbur Smith' neuer Thriller "The Quest" und Jake Halperns Buch "Fame Junkies", das mit der Idee aufräumt, die Welt der Celebrities sei demokratischer geworden, nur weil Fernsehzuschauer ihre Superstars jetzt selber wählen.
Weltwoche (Schweiz), 03.05.2007
 Urs Gehringer interviewt den Autor Lawrence Wright, der für seine Recherche "The Looming Tower - Al-Qaeda and the Road to 9/11" (Auszug) den Pulitzer-Preis bekommen hat und als einer der besten Kenner von Al Qaida überhaupt gilt. Er hält die Bekämpfung Al Qaidas mit den Mitteln des Krieges für fatal: "Wir sollten den Kampf gegen Al Qaida und den radikalen Islam auf eine strikt politische Basis verlegen. Wir sollten sie fragen: 'Was offeriert ihr?' Die Wahrheit ist: Al Qaida offeriert nichts. Sie hat keine politische Agenda. Beim Durchblättern von Tausenden Dokumenten habe ich keine einzige Seite über Politik gefunden. Al Qaida hat keinen Wirtschaftsplan, keinen Plan gegen Arbeitslosigkeit, keine Umweltpolitik. Al Qaida bietet ihren Anhängern nichts, außer Zerstörung." Durch den Irak-Krieg wurde Al Qaida wieder gestärkt, meint Wright: "Es kommt die Zeit, da die Dschihadisten aus dem Irak weiterziehen. Sie werden in ihre Heimatländer zurückkehren, nach Europa, woher viele kommen. Sie werden gut trainiert, hoch motiviert und gut organisiert sein."
Urs Gehringer interviewt den Autor Lawrence Wright, der für seine Recherche "The Looming Tower - Al-Qaeda and the Road to 9/11" (Auszug) den Pulitzer-Preis bekommen hat und als einer der besten Kenner von Al Qaida überhaupt gilt. Er hält die Bekämpfung Al Qaidas mit den Mitteln des Krieges für fatal: "Wir sollten den Kampf gegen Al Qaida und den radikalen Islam auf eine strikt politische Basis verlegen. Wir sollten sie fragen: 'Was offeriert ihr?' Die Wahrheit ist: Al Qaida offeriert nichts. Sie hat keine politische Agenda. Beim Durchblättern von Tausenden Dokumenten habe ich keine einzige Seite über Politik gefunden. Al Qaida hat keinen Wirtschaftsplan, keinen Plan gegen Arbeitslosigkeit, keine Umweltpolitik. Al Qaida bietet ihren Anhängern nichts, außer Zerstörung." Durch den Irak-Krieg wurde Al Qaida wieder gestärkt, meint Wright: "Es kommt die Zeit, da die Dschihadisten aus dem Irak weiterziehen. Sie werden in ihre Heimatländer zurückkehren, nach Europa, woher viele kommen. Sie werden gut trainiert, hoch motiviert und gut organisiert sein."Vorletzten Sonntag stand Bob Dylan in der Schweiz auf der Bühne. Unerträglicher als Stimme und Mundharmonika des Mannes sind nur seine Verehrer, meint Albert Kuhn mit giftigem Blick auf eine Berufsgruppe. "Der reflexartige Kniefall vor Sankt Bob ist für Journalisten über dreißig sozusagen der global gültige Presseausweis. Keine Redaktion ohne berufsmäßigen Dylan-Exegeten mit dem Hang zur vollen Zeitungsseite. Kein anderer Künstler hat eine Branche derart an der Gurgel wie dieser, dieser... Aber warum denn?"
Nepszabadsag (Ungarn), 03.05.2007
 Die Grabstätte des langjährigen Kommunistenführers Janos Kadar auf dem Budapester Zentralfriedhof wurde in der Nacht zum letzten Mittwoch geschändet. Unbekannte Täter öffneten den Metallsarg und entwendeten seine sterblichen Überreste. Die Marmorwand des Pantheons beschmierten die Täter mit den Worten: "Mörder und Verräter dürfen in der heiligen Erde keine Ruhe finden." Als Täter werden Mitglieder der rechtsextremen Szene vermutet. Der Philosoph Miklos T. Gaspar kommentiert die Schändigung seiner Grabstätte: "Die Ungarn ringen mit ihren Toten. Sterbliche Überreste historischer Persönlichkeiten, die in der Emigration gestorben sind, werden zurück in die Heimat gebracht, umstrittene Denkmäler werden sorgfältig renoviert oder aber zerstört. Nicht nur Ungarn, auch andere osteuropäische Länder kämpfen sich müde mit der Vergangenheit, wenn auch nicht so heftig, wie hierzulande. ... Sowjetische Denkmäler fallen zu Staub, das millionenmal erniedrigte Gespenst des Leninschen Systems kehrt trotzdem zurück. Die Rechte ist zu feige, mit ihm offen zu kämpfen, sie bleibt verborgen, sie greift ihn nur nachts an und zwar mit dem gleichen Instrument, wie Mitte des 20. Jahrhunderts, dem Faschismus."
Die Grabstätte des langjährigen Kommunistenführers Janos Kadar auf dem Budapester Zentralfriedhof wurde in der Nacht zum letzten Mittwoch geschändet. Unbekannte Täter öffneten den Metallsarg und entwendeten seine sterblichen Überreste. Die Marmorwand des Pantheons beschmierten die Täter mit den Worten: "Mörder und Verräter dürfen in der heiligen Erde keine Ruhe finden." Als Täter werden Mitglieder der rechtsextremen Szene vermutet. Der Philosoph Miklos T. Gaspar kommentiert die Schändigung seiner Grabstätte: "Die Ungarn ringen mit ihren Toten. Sterbliche Überreste historischer Persönlichkeiten, die in der Emigration gestorben sind, werden zurück in die Heimat gebracht, umstrittene Denkmäler werden sorgfältig renoviert oder aber zerstört. Nicht nur Ungarn, auch andere osteuropäische Länder kämpfen sich müde mit der Vergangenheit, wenn auch nicht so heftig, wie hierzulande. ... Sowjetische Denkmäler fallen zu Staub, das millionenmal erniedrigte Gespenst des Leninschen Systems kehrt trotzdem zurück. Die Rechte ist zu feige, mit ihm offen zu kämpfen, sie bleibt verborgen, sie greift ihn nur nachts an und zwar mit dem gleichen Instrument, wie Mitte des 20. Jahrhunderts, dem Faschismus." al-Sharq al-Awsat (Saudi Arabien / Vereinigtes Königreich), 02.05.2007
Aus Ägypten berichtet Samar al-Hilu vom schweren Stand der Menschenrechtsorganisationen vor Ort. Die Organisationen seien oft unmittelbar politisch motiviert, es werde aber nichts unternommen, um die eigentlichen, kulturellen Voraussetzungen von Freiheit zu schaffen, so lautet ein Vorwurf, der von der ägyptischen Schriftstellerin Salwa Bakr geteilt wird. Hilu fasst ihr Argument zusammen: "Diese Organisationen habe eine besondere Agenda, die von den Finanziers, die das repressive Regime aufzeigen und skandalisieren wollen, vorgegeben wird. Die großen Staaten benutzen diese Enthüllungen als Druckmittel gegen die 'rückständigen' und undemokratischen Staaten, wenn sich diese nicht der von ihnen vorgegebenen Politik fügen. Die Programmatik dieser Organisationen stehe damit im Zusammenhang. Daher würden Fragen der Kultur in der Arbeit dieser Organisationen, die den Ruf nach Menschenrechten als Dekor (für ihre politische Ziele) benutzen würden, nur am Rande behandelt. Nur so lasse sich die Ignoranz dieser Organisationen gegenüber kulturellen Fragen erklären: Sie beschränken ihre Aktivitäten auf politische Rechte, als ob die Menschen, für die diese Organisationen eintreten, nicht auch soziale und ökonomische Rechte hätten."
Literaturen (Deutschland), 01.05.2007
 Dieter Thomä hat Ulrich Becks "Weltrisikogesellschaft" und Cass R. Sunsteins Plädoyer für einen liberalen Paternalismus "Gesetze der Angst" gelesen. Unterschiedlicher könnten beide nicht sein, weder in Stil noch in ihren Antworten, meint Thomä, aber sie reagierten auf das gleiche Phänomen: Das Primat der Zukunft: "Inzwischen hat sie der Gegenwart, was Prominenz und Brisanz betrifft, schon fast den Rang abgelaufen. Die demografische Zusammensetzung der Gesellschaft im Jahre 2050 erhitzt die Gemüter ebenso wie die Höhe des Meeresspiegels am Ende des 21. Jahrhunderts. Die Zukunftsfähigkeit von Politikern wird nicht an Visionen, sondern an Datensätzen abgeprüft. So beginnt sich auch die Logik des Handelns zu verwandeln. Früher war die Zukunft das, was irgendwie hinten herauskam, wenn man vorne etwas tat: eine Mischung aus Zufällen und Vorhaben. Nun schiebt sich die Zukunft nach vorne und übernimmt die Macht über die aktuelle Agenda. Mit dieser Demütigung der eigenen Selbstherrlichkeit muss der Handelnde erst mal zurechtkommen."
Dieter Thomä hat Ulrich Becks "Weltrisikogesellschaft" und Cass R. Sunsteins Plädoyer für einen liberalen Paternalismus "Gesetze der Angst" gelesen. Unterschiedlicher könnten beide nicht sein, weder in Stil noch in ihren Antworten, meint Thomä, aber sie reagierten auf das gleiche Phänomen: Das Primat der Zukunft: "Inzwischen hat sie der Gegenwart, was Prominenz und Brisanz betrifft, schon fast den Rang abgelaufen. Die demografische Zusammensetzung der Gesellschaft im Jahre 2050 erhitzt die Gemüter ebenso wie die Höhe des Meeresspiegels am Ende des 21. Jahrhunderts. Die Zukunftsfähigkeit von Politikern wird nicht an Visionen, sondern an Datensätzen abgeprüft. So beginnt sich auch die Logik des Handelns zu verwandeln. Früher war die Zukunft das, was irgendwie hinten herauskam, wenn man vorne etwas tat: eine Mischung aus Zufällen und Vorhaben. Nun schiebt sich die Zukunft nach vorne und übernimmt die Macht über die aktuelle Agenda. Mit dieser Demütigung der eigenen Selbstherrlichkeit muss der Handelnde erst mal zurechtkommen."Jan Engelmann liest die neuesten Ratgeber zur vielbeschworenen Krise der Männlichkeit. Zum Buch des Monats kürt Martin Lüdke Cormac McCarthys Roman "Die Straße". Besprochen werden außerdem Thomas Langs Roman "Unter Paaren" (Leseprobe hier) sowie, in Franz Schuhs Kriminal-Kolumne, Lilian Faschingers Kriminalroman "Stadt der Verlierer". Manuela Reichart hat sich zwei Verfilmungen von Thomas Manns "Buddenbrooks" auf DVD angesehen. In der "Netzkarte" stellt Aram Lintzel die bei Professorinnen und Professoren nicht durchweg beliebte Website meinprof.de vor, auf der Studierende Lehrende benoten und bewerten dürfen - das Ergebnis, so Lintzel, ist freilich "Controlling und Evaluation in knallharter McKinsey-Manier".
New Statesman (UK), 07.05.2007
 Der New Statesman resümiert in mehreren Artikel die Amtszeit von Tony Blair. Für Suzanne Moore steht am Ende eine zersplitterte Gesellschaft, die nicht mehr weiß, wer sie als Öffentlichkeit ist. "Unser Misstrauen in die Institutionen hat sich verstärkt. Ja, wir alle wissen, welche Riesensummen das Gesundheitssystem frisst. Aber die meisten von uns machen die Erfahrung eine brillanten Notversorgung und erbärmlicher Nachsorge. Unsere Schulen, selbst wenn sie von verrückten Millionären finanziert werden, unterliegen endlosem Planen, Testen und Druck ausüben auf kleine Kinder. Mit Lernen hat das nichts zu tun. Der Schaden, den das Irakdesaster bei Labour und unseren Idealen von humanitärer Intervention und Demokratie hinterlassen hat, muss auf diesen Seiten nicht erläutert werden. Ich würde schlicht sagen, das die katastrophalen Nachwirkungen des Kriegs gegen den Terror mit vielen anderen kulturellen Trends ineinandergreifen und eine nationale Stimmung von Misstrauen und Unsicherheit geschaffen haben. Traue nur dir selbst. Daher dominieren auch die Beichtstühle, Dinge, die das Gefühl ansprechen, die Blogger, das Persönliche. Wenn wir nur für uns selbst sprechen können, dann sprechen wir nur von uns selbst. Wir sind jetzt Unternehmer, verkaufen unsere unique personalities, ständig um uns selbst kreisend."
Der New Statesman resümiert in mehreren Artikel die Amtszeit von Tony Blair. Für Suzanne Moore steht am Ende eine zersplitterte Gesellschaft, die nicht mehr weiß, wer sie als Öffentlichkeit ist. "Unser Misstrauen in die Institutionen hat sich verstärkt. Ja, wir alle wissen, welche Riesensummen das Gesundheitssystem frisst. Aber die meisten von uns machen die Erfahrung eine brillanten Notversorgung und erbärmlicher Nachsorge. Unsere Schulen, selbst wenn sie von verrückten Millionären finanziert werden, unterliegen endlosem Planen, Testen und Druck ausüben auf kleine Kinder. Mit Lernen hat das nichts zu tun. Der Schaden, den das Irakdesaster bei Labour und unseren Idealen von humanitärer Intervention und Demokratie hinterlassen hat, muss auf diesen Seiten nicht erläutert werden. Ich würde schlicht sagen, das die katastrophalen Nachwirkungen des Kriegs gegen den Terror mit vielen anderen kulturellen Trends ineinandergreifen und eine nationale Stimmung von Misstrauen und Unsicherheit geschaffen haben. Traue nur dir selbst. Daher dominieren auch die Beichtstühle, Dinge, die das Gefühl ansprechen, die Blogger, das Persönliche. Wenn wir nur für uns selbst sprechen können, dann sprechen wir nur von uns selbst. Wir sind jetzt Unternehmer, verkaufen unsere unique personalities, ständig um uns selbst kreisend."