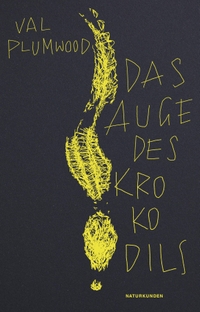Vom Nachttisch geräumt
Die Bücherkolumne. Von Arno Widmann
17.12.2002. Wer spricht schon mingrelisch? Welche Revolution ist nicht verspielt? Und wie sieht der Kopf einer in eine Venusfliegenfalle geratenen Heuschrecke aus? Sowohlalsauch
 Marcel Reich-Ranickis "Frankfurter Anthologie" hat nicht ihresgleichen. Seit 1974 erscheinen an jedem Wochenende in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ein Gedicht und ein Kommentar. In diesem Jahr sind zwölf das bisher Erschienene sammelnde Bände mit - so schreibt der Verlag - 1.400 deutschen Gedichten und den sie erläuternden Kommentaren in einer Taschenbuch-Kassette erschienen. Es gibt weltweit nichts Vergleichbares und schon gar nicht, wenn man bedenkt, dass die letzten fünfzig Jahre allein vier Bände einnehmen. Man mag es bedauern, dass die ersten großen Zeiten der deutschsprachigen Lyrik, das Hochmittelalter, der Humanismus und vor allem das Barock zusammengedrängt in einem Band "Von Walter von der Vogelweide bis Matthias Claudius" untergebracht sind, aber es versteht sich für den ursprünglichen Erscheinungsort, eine Tageszeitung, von selbst, dass das Schwergewicht auf der Gegenwart und ihren Dichtern liegt. Die letzten drei Zeilen des letzten der 1.400 Gedichte stammen von Durs Grünbein und sie lauten:
Marcel Reich-Ranickis "Frankfurter Anthologie" hat nicht ihresgleichen. Seit 1974 erscheinen an jedem Wochenende in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ein Gedicht und ein Kommentar. In diesem Jahr sind zwölf das bisher Erschienene sammelnde Bände mit - so schreibt der Verlag - 1.400 deutschen Gedichten und den sie erläuternden Kommentaren in einer Taschenbuch-Kassette erschienen. Es gibt weltweit nichts Vergleichbares und schon gar nicht, wenn man bedenkt, dass die letzten fünfzig Jahre allein vier Bände einnehmen. Man mag es bedauern, dass die ersten großen Zeiten der deutschsprachigen Lyrik, das Hochmittelalter, der Humanismus und vor allem das Barock zusammengedrängt in einem Band "Von Walter von der Vogelweide bis Matthias Claudius" untergebracht sind, aber es versteht sich für den ursprünglichen Erscheinungsort, eine Tageszeitung, von selbst, dass das Schwergewicht auf der Gegenwart und ihren Dichtern liegt. Die letzten drei Zeilen des letzten der 1.400 Gedichte stammen von Durs Grünbein und sie lauten:
"Wie uns der Wind in die Baumkronen hob,/
Aus denen wir fallen sollten,/
Glücklich, mit einem langen Himmelsschrei."
Reinhard Baumgarts Kommentar ist klug und betroffen zugleich. Er liebt diesen Schluss, der aus dem bitteren Reigen, "dem spröden Trostlosigkeitspathos des Zyklus" an dessen Ende er steht, ausbricht. Wer so aufgeklärt an die Hand genommen sich diesem Führer auch andernorts anvertrauen möchte, der schaut ins Register und kann mit Baumgart Goethe, Brecht, Enzensberger, Gernhardt lesen.
Es war ein Montag im Jahre 1960 als unser Deutschlehrer, Dr. Neumann, sich vor die Klasse 15-, 16jähriger hinsetzte und las:
"I
eia wasser regnet schlaf
eia abend schwimmt ins gras
wer zum wasser geht wird schlaf
wer zum abend kommt wird gras
weißes wasser grüner schlaf
großer abend kleines gras
es kommt es kommt
ein fremder
II
was sollen wir mit dem ertrunkenen matrosen tun?
wir ziehen ihm die stiefel aus
wir ziehen ihm die weste aus
und legen ihn ins gras
mein kind im fluß ists dunkel
mein kind im fluß ists naß
was sollen wir mit dem ertrunkenen matrosen tun?
wir ziehen ihm das wasser an
wir ziehen ihm den abend an
und tragen ihn zurück
mein kind du mußt nicht weinen
mein kind das ist nur schlaf
was sollen wir mit dem ertrunkenen matrosen tun?
wir singen ihm das wasserlied
wir sprechen ihm das grasgebet
dann will er gern zurück
III
es geht es geht
ein fremder
ins große gras den kleinen abend
im weißen schlaf das grüne naß
und geht zum gras und wird ein abend
und kommt zum schlaf und wird ein naß
eia schwimmt ins gras der abend
eia regnet's wasserschlaf"
Wer sechzehn ist, ist stolz auf seinen Verstand. Er durchschaut alles. "eia wasser schlaf" ist ein traumhaftes Ritornell. Dr. Neumanns Lesung verletzte unseren gerade erst erwachten Rationalismus. Also feixten wir. Der Todessingsang, das süße Hinabgleiten ins Jenseits war unsere Sache nicht. Jedenfalls nicht in dieser Stunde. Aber nicht nur mir hat sich das "wasser regnet schlaf" von Elisabeth Borchers eingesengt ins Gedächtnis. Sicher trug dazu bei, dass damals noch wochenlang in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung darüber debattiert wurde, ob das ein Gedicht sei, das es verdiene gedruckt zu werden.
Elisabeth Borchers' kunstvoll-verführerisches Lied hat uns nicht davor bewahrt, ein paar Jahre später vor der Musik davonzulaufen ins nichts als Bedeutungsvolle. Es hat sehr lange gedauert bis die Generation der 68er ihren großen Widerspruch gegen den Lauf der Dinge auch einmal wieder ablegen konnte, um sich einzustimmen ins Unvermeidliche. Und sei es nur für die Dauer eines Gedichtes. Es gibt - das entdeckten sie erst spät, aber dann desto heftiger - auch eine Schönheit der Anpassung. Die 1.400 Gedichte halten die unterschiedlichsten Formen des Schönen fest. In ihnen zu blättern ist ein auf- und anregendes Gegengift gegen die immer wieder aufkommende Definitionslust, gegen die Vorstellung, etwas müsse so und so und dürfe auf keinen Fall anders sein. Schon wenn man den Titel des Bandes von "Hugo von Hofmannsthal bis Joachim Ringelnatz" nur ansieht, bekommt man eine Ahnung davon, wie lächerlich, wenn nicht gar verbrecherisch, die Entwederoders auch in der Lyrik sind.
"1400 Deutsche Gedichte und ihre Interpretationen", herausgegeben von Marcel Reich-Ranicki, 12 Bände in Kassette, Insel Verlag, 2002, 150 Euro. Bestellen.
Reisen
 343 Fotos - wenn ich richtig gezählt habe - von den "Spuren in einer Blasenkammer, die Protonen, Neutronen und Elektronen, die Bausteine der Atome nachweisen, bis zu einer Aufnahme des Hubble-Teleskops, die Tausende von Galaxien im Sternbild des Großen Bären zeigt. Der begleitende Text erklärt: "Die entferntesten Objekte sind die kleinen, unregelmäßigen blauen Wolken. Sie liegen fast am Rand des sichtbaren Universums. Ihr Licht begann seine Reise durch den Raum vor über zehn Milliarden Jahren, weshalb wir sie so sehen, als hätte das Universum erst ein Zehntel seines heutigen Alters. Sie sind klein und unreif - Struktur und Form der meisten heutigen Galaxien fehlen ihnen noch." Dazwischen der mit einem Rasterelektronenmikroskop bei 48 000 facher Vergrößerung festgehaltene Augenblick, da eine Samen- in eine Eizelle eindringt, der Kopf einer in eine Venusfliegenfalle geratenen Heuschrecke (17 fache Vergrößerung), die 1895 entstandene Röntgenaufnahme der Hand der Ehefrau des Physikers mit dem Ehering. Man findet auch eine Teleskopaufnahme vom Orionnebel, in dem - so erklärt das Buch - "vor unseren Augen", 1500 Lichtjahre von uns entfernt, neue Sterne geboren werden. Man sieht nur, was man weiß, lernt man auch hier wieder. Aber sähe man es nicht, wüsste man es dann?
343 Fotos - wenn ich richtig gezählt habe - von den "Spuren in einer Blasenkammer, die Protonen, Neutronen und Elektronen, die Bausteine der Atome nachweisen, bis zu einer Aufnahme des Hubble-Teleskops, die Tausende von Galaxien im Sternbild des Großen Bären zeigt. Der begleitende Text erklärt: "Die entferntesten Objekte sind die kleinen, unregelmäßigen blauen Wolken. Sie liegen fast am Rand des sichtbaren Universums. Ihr Licht begann seine Reise durch den Raum vor über zehn Milliarden Jahren, weshalb wir sie so sehen, als hätte das Universum erst ein Zehntel seines heutigen Alters. Sie sind klein und unreif - Struktur und Form der meisten heutigen Galaxien fehlen ihnen noch." Dazwischen der mit einem Rasterelektronenmikroskop bei 48 000 facher Vergrößerung festgehaltene Augenblick, da eine Samen- in eine Eizelle eindringt, der Kopf einer in eine Venusfliegenfalle geratenen Heuschrecke (17 fache Vergrößerung), die 1895 entstandene Röntgenaufnahme der Hand der Ehefrau des Physikers mit dem Ehering. Man findet auch eine Teleskopaufnahme vom Orionnebel, in dem - so erklärt das Buch - "vor unseren Augen", 1500 Lichtjahre von uns entfernt, neue Sterne geboren werden. Man sieht nur, was man weiß, lernt man auch hier wieder. Aber sähe man es nicht, wüsste man es dann?
Die Erläuterungen zu den stets rätselhaften Fotos sind knapp, aber sie vollbringen fast immer das Wunder, einem das ganz und gar Unverständliche zu erklären. Sie schaffen das, weil sie nicht sagen, was der Wissenschaftler weiß, sondern erklären, was die Abbildung zeigt. Zum Beispiel "Mississippidelta, USA. Das Mississippidelta ist ein Lehrbuchbeispiel für ein Vogelfußdelta; diese Form nehmen Flussmündungen an, wenn Schlammflächen größer werden und sich von der Küste ins Meer erweitern. Am höchsten sind die Schlammablagerungen am Hauptarm des Flusses, von dem kleinere Nebenarme in alle Richtungen abzweigen. Links in der Satellitenaufnahme erkennt man Wolken aus feinkörnigem Fluss-Sediment, die von windgetriebenen Strömungen des Oberflächenwassers verteilt werden. Zwischen der Stelle, wo der Fluss ins Bild eintritt, und dem anderen Ende des Deltas liegen rund 60 Kilometer." Womit wir auch wieder über die Größenverhältnisse, die ja das Buch organisieren, aufgeklärt sind.
"Himmel und Erde" heißt der Band. Es gibt kein schöneres Reisebuch.
"Himmel & Erde", mit einer Einleitung von David Malin, 384 Seiten, sw und farbige Fotos, Phaidon Verlag, 2002, Übersetzer: Sebastian Vogel, Susanne Kuhlmann-Krieg, 49,95 Euro. Bestellen.
Oper
Es gibt wahrscheinlich keine intelligentere, wachere, - man verzeihe die gespreizte Wendung - problembewusstere Einführung in die Oper als das Einleitungskapitel zu Oskar Bies "Die Oper". Ich habe vor mir die sehr schöne dritte und vierte Auflage aus dem Jahre 1919. Dreiundneunzig Seiten hat das "Die Parodoxie der Oper" überschriebene Kapitel und es gibt keinen Abschnitt, in dem Bie nicht unseren Blick auf die Unsinnigkeiten des Genres lenkt und keinen, in denen er uns nicht klarmacht, dass wir es genau um deretwillen lieben. Da ist nicht nur der niemals zu versöhnende Widerspruch zwischen Text und Musik. Da ist vor allem der Widerspruch in der Musik selbst. Sie ist einerseits Ausdruck eines Gefühls, einer inneren Bewegung und andererseits ist sie die Lust an der Bewegung dieses Ausdrucks. Bie erinnert daran, dass - was immer die Komponisten beabsichtigt haben mochten - Sänger und Sängerinnen Wert darauf legten zu zeigen, was sie können. Den Ton halten, ihn in ungeahnte Höhen treiben, dort oben, wo er ganz schwach wird, ihn nochmal stemmen und ihn dann über alle Köpfe hinweg knallen lassen - das ist eine Seite der Oper, ohne die sie nicht ist, gegen die aber immer wieder gerade ihre besten Komponisten und Interpreten ankämpfen. Im Namen der Kunst. Aber die Verzierungen sind auch eine Kunst, eine vielbejubelte und eine viel verachtete. Es gibt keinen Mittelweg, der aus diesen Verwirrungen herausführt. Es gibt nur den Kampf, die ständige Auseinandersetzung und mal siegt die eine, mal die andere Seite.
So schildert Bie die Oper vor der Oper: "Noch ehe unsere Oper getauft war, im Jahre 1597, erschien eine 'commedia harmonica' von Orazio Vecchi, unter dem Titel L'Amfiparnasso. Sie ist die interessanteste aller alten Madrigalopern. Ein merkwürdiges Werk, eine Oper, die keine Oper ist, sondern nur eine Zusammenstellung von Madrigalen oder Chansons, in fünf Stimmen zu singen, wie sie es sonst auch gab, hier aber vereinigt als Darstellung eines dramatischen Stoffes. Der Autor sagt in der Vorrede, wie ein Maler auf seinem Bilde einige Hauptfiguren in ganzer Größe male, andere nur als Brust- oder Kopfstücke, den Rest in der Ferne untereinander gemengt, so sei dies Stück. Nie hat ein Autor seine Arbeit mit einem größeren Missverständnis eingeleitet. Das Bild, wie es ihm vorschwebt, entspricht der späteren, der wirklichen Oper, die ihre Hauptdarsteller ganz in den Vordergrund bringt und die Nebenfiguren leicht darum ordnet, nach dem Muster der reifen Renaissancekunst, die den edlen Menschen in harmonischer Umgebung kultiviert. Sein Werk aber ist byzantinische, ravennatische Kunst: Parallelismus des Mosaiks, Korporation des Gegenständlichen, Projektion des Inhalts in ein neutrales dekoratives Ensemble. Hier singen irgendwelche Stimmen Szenen, die zwischen bestimmten Menschen spielen, Szenen zwischen Herr und Diener, Herr und Kurtisane, ein besseres Liebespaar, ja sie singen die Klage der Liebenden allein, sie singen Eifersucht und sie singen Parodien, in vielen Dialekten, sie singen (als Vorahnung der 'Salome') eine Szene lärmender Juden, die bei der Sabbatfeier keine Zeit haben, einen Diamanten zu beleihen, halb feierlich, halb komisch, Kontrapunktik auf hebräischen Jargon - sie singen, wie unbeteiligte Instrumente, irgendwelche Szenen, die sie von der Persönlichkeit absichtlich loslösen. Es war die Anwendung des mittelalterlichen Musikstils auf ein Drama: geschehen durch den Zufall, dass das Instrument des Mittelalters der Chor war. Das ist das Merkwürdige."
Auf das Merkwürdige versteht Bie sich. Er arbeitet es heraus mit dem Blick fürs Paradoxe, den eine spätere Generation bei seinem Zeitgenossen Simmel gern rühmte, der aber wohl auch ein Zeitstil war - sich selbst kaum weniger fremd als die Oper im Augenblick ihrer Geburt. Oskar Bie arbeitet den Patchwork-Charakter der Oper heraus. Sie fügt die unterschiedlichsten Momente zusammen. Sie schmilzt sie nicht ein im Gesamtkunstwerk Oper - das geht gar nicht - sondern sie lässt die einzelnen Elemente immer wieder für sich auftreten. Im Rezitativ verschwindet die Musik fast ganz und der Text beherrscht die Bühne und beim Auftritt des Steinernen Gastes, besiegen Bühnentechnik und Bühnenbild Text und Musik. In den Aktschlüssen, wenn sieben, acht, neun Menschen auf der Bühne stehen und jeder singt seinen Part und alles löst sich auf in einer einzigen großen ganz und gar unverständlichen Harmonie, dann ist das Drama mitten auf seinem Höhepunkt gestorben und es herrscht minutenlang nur Rausch und Klang.
In der Oper kommt das alles zusammen. Es wird verrührt und dann steht es wieder nebeneinander, frei und autonom. Ohne Montagetechnik könnte die Oper nicht sein. Die concept-art Oper erscheint bei Oskar Bie modern als sei sie eine Erfindung Eisensteins, den Bie aber nicht kennt. Das Buch ist - wie alle großen Bücher - klüger als sein Autor. Wer es lesen will, muss in Antiquariaten danach forschen. Am besten er geht ins Internet und gibt ein:
Oskar Bie, "Die Oper", S. Fischer, Berlin 1919, 576 Seiten mit vielen farbigen und s/w Abbildungen.
Trennungen
Das Handbuch zur Osterweiterung der Europäischen Union ist die "Wieser Enzyklopädie des europäischen Ostens" nicht. Sie soll am Ende zwanzig Bände umfassen. Jeder davon um die eintausend Seiten. Das ist nichts für Leser. Das ist für Bibliotheken, etwas zum Nachschlagen. Vor mir liegt Band 10. "Lexikon der Sprachen des europäischen Ostens", und schon bin ich verloren. Von "podhalisch" habe ich noch nie etwas gehört und auch auf "moliseslawisch" stoße ich hier das erste Mal, auch "arvanitisch" kenne ich nicht und "wotisch" und "mingrelisch" sind mir ebenfalls neu. Das sind alles Sprachen, die heute gesprochen werden. Daneben informiert der Band natürlich auch über untergegangene Sprachen wie das Päonische, bei dem ich an Eichendorffs "Kaiserkron' und Päonien rot" denke ohne zu wissen, ob es irgendetwas mit dem wohl thrakischen Stamm der Päonen zu tun hat.
Von der Sprache sind noch ein paar Stammes-, Personen- und Ortsnamen überliefert, ein Gottesname und ein Appelativ. Alles in allem gerade mal 13 Zeilen. Mehr ist nicht geblieben. Nicht von den Menschen, nicht von ihrer Sprache.
An einem Strand unweit von Thessaloniki hörte ich vor ein paar Jahren alte Leute noch judenspanisch sprechen. Sie standen bis zu den Knien in den sanft auslaufenden Wellen des Golfs von Siggotikos und unterhielten sich über den sehr dick geratenen Enkel einer Freundin, der sie nicht verstehen sollte. Ihre Vorfahren hatten diese Sprache, als sie 1492 aus Spanien vertrieben wurden, hierher mitgebracht. Vor sechzig Jahren gab es noch Zeitungen und Bücher auf sephardisch. Bis die Deutschen ihren Sprechern im Zweiten Weltkrieg den Garaus machten. Einige haben sich oder wurden gerettet. Die 1996 verstorbene Dichterin Clarisse Nikoidski ist eine davon. Einige ihrer Gedichte hat Tobias Burghardt übersetzt. Sie sind in dem Bändchen "Flussufer" in der Edition 350 im Verlag der Kooperative Dürnau erschienen. Diese Angabe sei hier nachgetragen. Sie fehlt in der Enzyklopädie. Aber das tut dem Vergnügen mit ihr keinen Abbruch. Nach zwei Stunden merkt man, dass es nicht beim Blättern geblieben ist, sondern dass man sich sehr intensiv festgelesen hat in den klaren, instruktiven Artikeln.
Und was ist mingrelisch? 400.000 Menschen im Westen der Republik Georgien sprechen diese südkaukasische Sprache. Sie entstand wohl zwischen dem 6. und dem 9. Jahrhundert. Das Lasische, mit dem sie eins war, setzte sich durch die Islamisierung der Lasen ab und das Mingrelische separierte sich von diesem. Setzt die Abstoßung erst einmal ein, dann neigt sie offenbar zur Radikalisierung. Auch das kann man hier nachlesen.
"Wieser Enzyklopädie des europäischen Ostens", 20 Bände, Vorauszahlungspreis: 1.700 Euro. Wieser Verlag, Klagenfurt, Wien, Ljubljana, 2002. Band 10: Lexikon der Sprachen des Ostens, herausgegeben von Milos Okuka unter Mitwirkung von Gerald Krenn, 1031 Seiten, 145 Euro.
 Marcel Reich-Ranickis "Frankfurter Anthologie" hat nicht ihresgleichen. Seit 1974 erscheinen an jedem Wochenende in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ein Gedicht und ein Kommentar. In diesem Jahr sind zwölf das bisher Erschienene sammelnde Bände mit - so schreibt der Verlag - 1.400 deutschen Gedichten und den sie erläuternden Kommentaren in einer Taschenbuch-Kassette erschienen. Es gibt weltweit nichts Vergleichbares und schon gar nicht, wenn man bedenkt, dass die letzten fünfzig Jahre allein vier Bände einnehmen. Man mag es bedauern, dass die ersten großen Zeiten der deutschsprachigen Lyrik, das Hochmittelalter, der Humanismus und vor allem das Barock zusammengedrängt in einem Band "Von Walter von der Vogelweide bis Matthias Claudius" untergebracht sind, aber es versteht sich für den ursprünglichen Erscheinungsort, eine Tageszeitung, von selbst, dass das Schwergewicht auf der Gegenwart und ihren Dichtern liegt. Die letzten drei Zeilen des letzten der 1.400 Gedichte stammen von Durs Grünbein und sie lauten:
Marcel Reich-Ranickis "Frankfurter Anthologie" hat nicht ihresgleichen. Seit 1974 erscheinen an jedem Wochenende in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ein Gedicht und ein Kommentar. In diesem Jahr sind zwölf das bisher Erschienene sammelnde Bände mit - so schreibt der Verlag - 1.400 deutschen Gedichten und den sie erläuternden Kommentaren in einer Taschenbuch-Kassette erschienen. Es gibt weltweit nichts Vergleichbares und schon gar nicht, wenn man bedenkt, dass die letzten fünfzig Jahre allein vier Bände einnehmen. Man mag es bedauern, dass die ersten großen Zeiten der deutschsprachigen Lyrik, das Hochmittelalter, der Humanismus und vor allem das Barock zusammengedrängt in einem Band "Von Walter von der Vogelweide bis Matthias Claudius" untergebracht sind, aber es versteht sich für den ursprünglichen Erscheinungsort, eine Tageszeitung, von selbst, dass das Schwergewicht auf der Gegenwart und ihren Dichtern liegt. Die letzten drei Zeilen des letzten der 1.400 Gedichte stammen von Durs Grünbein und sie lauten: "Wie uns der Wind in die Baumkronen hob,/
Aus denen wir fallen sollten,/
Glücklich, mit einem langen Himmelsschrei."
Reinhard Baumgarts Kommentar ist klug und betroffen zugleich. Er liebt diesen Schluss, der aus dem bitteren Reigen, "dem spröden Trostlosigkeitspathos des Zyklus" an dessen Ende er steht, ausbricht. Wer so aufgeklärt an die Hand genommen sich diesem Führer auch andernorts anvertrauen möchte, der schaut ins Register und kann mit Baumgart Goethe, Brecht, Enzensberger, Gernhardt lesen.
Es war ein Montag im Jahre 1960 als unser Deutschlehrer, Dr. Neumann, sich vor die Klasse 15-, 16jähriger hinsetzte und las:
"I
eia wasser regnet schlaf
eia abend schwimmt ins gras
wer zum wasser geht wird schlaf
wer zum abend kommt wird gras
weißes wasser grüner schlaf
großer abend kleines gras
es kommt es kommt
ein fremder
II
was sollen wir mit dem ertrunkenen matrosen tun?
wir ziehen ihm die stiefel aus
wir ziehen ihm die weste aus
und legen ihn ins gras
mein kind im fluß ists dunkel
mein kind im fluß ists naß
was sollen wir mit dem ertrunkenen matrosen tun?
wir ziehen ihm das wasser an
wir ziehen ihm den abend an
und tragen ihn zurück
mein kind du mußt nicht weinen
mein kind das ist nur schlaf
was sollen wir mit dem ertrunkenen matrosen tun?
wir singen ihm das wasserlied
wir sprechen ihm das grasgebet
dann will er gern zurück
III
es geht es geht
ein fremder
ins große gras den kleinen abend
im weißen schlaf das grüne naß
und geht zum gras und wird ein abend
und kommt zum schlaf und wird ein naß
eia schwimmt ins gras der abend
eia regnet's wasserschlaf"
Wer sechzehn ist, ist stolz auf seinen Verstand. Er durchschaut alles. "eia wasser schlaf" ist ein traumhaftes Ritornell. Dr. Neumanns Lesung verletzte unseren gerade erst erwachten Rationalismus. Also feixten wir. Der Todessingsang, das süße Hinabgleiten ins Jenseits war unsere Sache nicht. Jedenfalls nicht in dieser Stunde. Aber nicht nur mir hat sich das "wasser regnet schlaf" von Elisabeth Borchers eingesengt ins Gedächtnis. Sicher trug dazu bei, dass damals noch wochenlang in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung darüber debattiert wurde, ob das ein Gedicht sei, das es verdiene gedruckt zu werden.
Elisabeth Borchers' kunstvoll-verführerisches Lied hat uns nicht davor bewahrt, ein paar Jahre später vor der Musik davonzulaufen ins nichts als Bedeutungsvolle. Es hat sehr lange gedauert bis die Generation der 68er ihren großen Widerspruch gegen den Lauf der Dinge auch einmal wieder ablegen konnte, um sich einzustimmen ins Unvermeidliche. Und sei es nur für die Dauer eines Gedichtes. Es gibt - das entdeckten sie erst spät, aber dann desto heftiger - auch eine Schönheit der Anpassung. Die 1.400 Gedichte halten die unterschiedlichsten Formen des Schönen fest. In ihnen zu blättern ist ein auf- und anregendes Gegengift gegen die immer wieder aufkommende Definitionslust, gegen die Vorstellung, etwas müsse so und so und dürfe auf keinen Fall anders sein. Schon wenn man den Titel des Bandes von "Hugo von Hofmannsthal bis Joachim Ringelnatz" nur ansieht, bekommt man eine Ahnung davon, wie lächerlich, wenn nicht gar verbrecherisch, die Entwederoders auch in der Lyrik sind.
"1400 Deutsche Gedichte und ihre Interpretationen", herausgegeben von Marcel Reich-Ranicki, 12 Bände in Kassette, Insel Verlag, 2002, 150 Euro. Bestellen.
Reisen
 343 Fotos - wenn ich richtig gezählt habe - von den "Spuren in einer Blasenkammer, die Protonen, Neutronen und Elektronen, die Bausteine der Atome nachweisen, bis zu einer Aufnahme des Hubble-Teleskops, die Tausende von Galaxien im Sternbild des Großen Bären zeigt. Der begleitende Text erklärt: "Die entferntesten Objekte sind die kleinen, unregelmäßigen blauen Wolken. Sie liegen fast am Rand des sichtbaren Universums. Ihr Licht begann seine Reise durch den Raum vor über zehn Milliarden Jahren, weshalb wir sie so sehen, als hätte das Universum erst ein Zehntel seines heutigen Alters. Sie sind klein und unreif - Struktur und Form der meisten heutigen Galaxien fehlen ihnen noch." Dazwischen der mit einem Rasterelektronenmikroskop bei 48 000 facher Vergrößerung festgehaltene Augenblick, da eine Samen- in eine Eizelle eindringt, der Kopf einer in eine Venusfliegenfalle geratenen Heuschrecke (17 fache Vergrößerung), die 1895 entstandene Röntgenaufnahme der Hand der Ehefrau des Physikers mit dem Ehering. Man findet auch eine Teleskopaufnahme vom Orionnebel, in dem - so erklärt das Buch - "vor unseren Augen", 1500 Lichtjahre von uns entfernt, neue Sterne geboren werden. Man sieht nur, was man weiß, lernt man auch hier wieder. Aber sähe man es nicht, wüsste man es dann?
343 Fotos - wenn ich richtig gezählt habe - von den "Spuren in einer Blasenkammer, die Protonen, Neutronen und Elektronen, die Bausteine der Atome nachweisen, bis zu einer Aufnahme des Hubble-Teleskops, die Tausende von Galaxien im Sternbild des Großen Bären zeigt. Der begleitende Text erklärt: "Die entferntesten Objekte sind die kleinen, unregelmäßigen blauen Wolken. Sie liegen fast am Rand des sichtbaren Universums. Ihr Licht begann seine Reise durch den Raum vor über zehn Milliarden Jahren, weshalb wir sie so sehen, als hätte das Universum erst ein Zehntel seines heutigen Alters. Sie sind klein und unreif - Struktur und Form der meisten heutigen Galaxien fehlen ihnen noch." Dazwischen der mit einem Rasterelektronenmikroskop bei 48 000 facher Vergrößerung festgehaltene Augenblick, da eine Samen- in eine Eizelle eindringt, der Kopf einer in eine Venusfliegenfalle geratenen Heuschrecke (17 fache Vergrößerung), die 1895 entstandene Röntgenaufnahme der Hand der Ehefrau des Physikers mit dem Ehering. Man findet auch eine Teleskopaufnahme vom Orionnebel, in dem - so erklärt das Buch - "vor unseren Augen", 1500 Lichtjahre von uns entfernt, neue Sterne geboren werden. Man sieht nur, was man weiß, lernt man auch hier wieder. Aber sähe man es nicht, wüsste man es dann?Die Erläuterungen zu den stets rätselhaften Fotos sind knapp, aber sie vollbringen fast immer das Wunder, einem das ganz und gar Unverständliche zu erklären. Sie schaffen das, weil sie nicht sagen, was der Wissenschaftler weiß, sondern erklären, was die Abbildung zeigt. Zum Beispiel "Mississippidelta, USA. Das Mississippidelta ist ein Lehrbuchbeispiel für ein Vogelfußdelta; diese Form nehmen Flussmündungen an, wenn Schlammflächen größer werden und sich von der Küste ins Meer erweitern. Am höchsten sind die Schlammablagerungen am Hauptarm des Flusses, von dem kleinere Nebenarme in alle Richtungen abzweigen. Links in der Satellitenaufnahme erkennt man Wolken aus feinkörnigem Fluss-Sediment, die von windgetriebenen Strömungen des Oberflächenwassers verteilt werden. Zwischen der Stelle, wo der Fluss ins Bild eintritt, und dem anderen Ende des Deltas liegen rund 60 Kilometer." Womit wir auch wieder über die Größenverhältnisse, die ja das Buch organisieren, aufgeklärt sind.
"Himmel und Erde" heißt der Band. Es gibt kein schöneres Reisebuch.
"Himmel & Erde", mit einer Einleitung von David Malin, 384 Seiten, sw und farbige Fotos, Phaidon Verlag, 2002, Übersetzer: Sebastian Vogel, Susanne Kuhlmann-Krieg, 49,95 Euro. Bestellen.
Oper
Es gibt wahrscheinlich keine intelligentere, wachere, - man verzeihe die gespreizte Wendung - problembewusstere Einführung in die Oper als das Einleitungskapitel zu Oskar Bies "Die Oper". Ich habe vor mir die sehr schöne dritte und vierte Auflage aus dem Jahre 1919. Dreiundneunzig Seiten hat das "Die Parodoxie der Oper" überschriebene Kapitel und es gibt keinen Abschnitt, in dem Bie nicht unseren Blick auf die Unsinnigkeiten des Genres lenkt und keinen, in denen er uns nicht klarmacht, dass wir es genau um deretwillen lieben. Da ist nicht nur der niemals zu versöhnende Widerspruch zwischen Text und Musik. Da ist vor allem der Widerspruch in der Musik selbst. Sie ist einerseits Ausdruck eines Gefühls, einer inneren Bewegung und andererseits ist sie die Lust an der Bewegung dieses Ausdrucks. Bie erinnert daran, dass - was immer die Komponisten beabsichtigt haben mochten - Sänger und Sängerinnen Wert darauf legten zu zeigen, was sie können. Den Ton halten, ihn in ungeahnte Höhen treiben, dort oben, wo er ganz schwach wird, ihn nochmal stemmen und ihn dann über alle Köpfe hinweg knallen lassen - das ist eine Seite der Oper, ohne die sie nicht ist, gegen die aber immer wieder gerade ihre besten Komponisten und Interpreten ankämpfen. Im Namen der Kunst. Aber die Verzierungen sind auch eine Kunst, eine vielbejubelte und eine viel verachtete. Es gibt keinen Mittelweg, der aus diesen Verwirrungen herausführt. Es gibt nur den Kampf, die ständige Auseinandersetzung und mal siegt die eine, mal die andere Seite.
So schildert Bie die Oper vor der Oper: "Noch ehe unsere Oper getauft war, im Jahre 1597, erschien eine 'commedia harmonica' von Orazio Vecchi, unter dem Titel L'Amfiparnasso. Sie ist die interessanteste aller alten Madrigalopern. Ein merkwürdiges Werk, eine Oper, die keine Oper ist, sondern nur eine Zusammenstellung von Madrigalen oder Chansons, in fünf Stimmen zu singen, wie sie es sonst auch gab, hier aber vereinigt als Darstellung eines dramatischen Stoffes. Der Autor sagt in der Vorrede, wie ein Maler auf seinem Bilde einige Hauptfiguren in ganzer Größe male, andere nur als Brust- oder Kopfstücke, den Rest in der Ferne untereinander gemengt, so sei dies Stück. Nie hat ein Autor seine Arbeit mit einem größeren Missverständnis eingeleitet. Das Bild, wie es ihm vorschwebt, entspricht der späteren, der wirklichen Oper, die ihre Hauptdarsteller ganz in den Vordergrund bringt und die Nebenfiguren leicht darum ordnet, nach dem Muster der reifen Renaissancekunst, die den edlen Menschen in harmonischer Umgebung kultiviert. Sein Werk aber ist byzantinische, ravennatische Kunst: Parallelismus des Mosaiks, Korporation des Gegenständlichen, Projektion des Inhalts in ein neutrales dekoratives Ensemble. Hier singen irgendwelche Stimmen Szenen, die zwischen bestimmten Menschen spielen, Szenen zwischen Herr und Diener, Herr und Kurtisane, ein besseres Liebespaar, ja sie singen die Klage der Liebenden allein, sie singen Eifersucht und sie singen Parodien, in vielen Dialekten, sie singen (als Vorahnung der 'Salome') eine Szene lärmender Juden, die bei der Sabbatfeier keine Zeit haben, einen Diamanten zu beleihen, halb feierlich, halb komisch, Kontrapunktik auf hebräischen Jargon - sie singen, wie unbeteiligte Instrumente, irgendwelche Szenen, die sie von der Persönlichkeit absichtlich loslösen. Es war die Anwendung des mittelalterlichen Musikstils auf ein Drama: geschehen durch den Zufall, dass das Instrument des Mittelalters der Chor war. Das ist das Merkwürdige."
Auf das Merkwürdige versteht Bie sich. Er arbeitet es heraus mit dem Blick fürs Paradoxe, den eine spätere Generation bei seinem Zeitgenossen Simmel gern rühmte, der aber wohl auch ein Zeitstil war - sich selbst kaum weniger fremd als die Oper im Augenblick ihrer Geburt. Oskar Bie arbeitet den Patchwork-Charakter der Oper heraus. Sie fügt die unterschiedlichsten Momente zusammen. Sie schmilzt sie nicht ein im Gesamtkunstwerk Oper - das geht gar nicht - sondern sie lässt die einzelnen Elemente immer wieder für sich auftreten. Im Rezitativ verschwindet die Musik fast ganz und der Text beherrscht die Bühne und beim Auftritt des Steinernen Gastes, besiegen Bühnentechnik und Bühnenbild Text und Musik. In den Aktschlüssen, wenn sieben, acht, neun Menschen auf der Bühne stehen und jeder singt seinen Part und alles löst sich auf in einer einzigen großen ganz und gar unverständlichen Harmonie, dann ist das Drama mitten auf seinem Höhepunkt gestorben und es herrscht minutenlang nur Rausch und Klang.
In der Oper kommt das alles zusammen. Es wird verrührt und dann steht es wieder nebeneinander, frei und autonom. Ohne Montagetechnik könnte die Oper nicht sein. Die concept-art Oper erscheint bei Oskar Bie modern als sei sie eine Erfindung Eisensteins, den Bie aber nicht kennt. Das Buch ist - wie alle großen Bücher - klüger als sein Autor. Wer es lesen will, muss in Antiquariaten danach forschen. Am besten er geht ins Internet und gibt ein:
Oskar Bie, "Die Oper", S. Fischer, Berlin 1919, 576 Seiten mit vielen farbigen und s/w Abbildungen.
Trennungen
Das Handbuch zur Osterweiterung der Europäischen Union ist die "Wieser Enzyklopädie des europäischen Ostens" nicht. Sie soll am Ende zwanzig Bände umfassen. Jeder davon um die eintausend Seiten. Das ist nichts für Leser. Das ist für Bibliotheken, etwas zum Nachschlagen. Vor mir liegt Band 10. "Lexikon der Sprachen des europäischen Ostens", und schon bin ich verloren. Von "podhalisch" habe ich noch nie etwas gehört und auch auf "moliseslawisch" stoße ich hier das erste Mal, auch "arvanitisch" kenne ich nicht und "wotisch" und "mingrelisch" sind mir ebenfalls neu. Das sind alles Sprachen, die heute gesprochen werden. Daneben informiert der Band natürlich auch über untergegangene Sprachen wie das Päonische, bei dem ich an Eichendorffs "Kaiserkron' und Päonien rot" denke ohne zu wissen, ob es irgendetwas mit dem wohl thrakischen Stamm der Päonen zu tun hat.
Von der Sprache sind noch ein paar Stammes-, Personen- und Ortsnamen überliefert, ein Gottesname und ein Appelativ. Alles in allem gerade mal 13 Zeilen. Mehr ist nicht geblieben. Nicht von den Menschen, nicht von ihrer Sprache.
An einem Strand unweit von Thessaloniki hörte ich vor ein paar Jahren alte Leute noch judenspanisch sprechen. Sie standen bis zu den Knien in den sanft auslaufenden Wellen des Golfs von Siggotikos und unterhielten sich über den sehr dick geratenen Enkel einer Freundin, der sie nicht verstehen sollte. Ihre Vorfahren hatten diese Sprache, als sie 1492 aus Spanien vertrieben wurden, hierher mitgebracht. Vor sechzig Jahren gab es noch Zeitungen und Bücher auf sephardisch. Bis die Deutschen ihren Sprechern im Zweiten Weltkrieg den Garaus machten. Einige haben sich oder wurden gerettet. Die 1996 verstorbene Dichterin Clarisse Nikoidski ist eine davon. Einige ihrer Gedichte hat Tobias Burghardt übersetzt. Sie sind in dem Bändchen "Flussufer" in der Edition 350 im Verlag der Kooperative Dürnau erschienen. Diese Angabe sei hier nachgetragen. Sie fehlt in der Enzyklopädie. Aber das tut dem Vergnügen mit ihr keinen Abbruch. Nach zwei Stunden merkt man, dass es nicht beim Blättern geblieben ist, sondern dass man sich sehr intensiv festgelesen hat in den klaren, instruktiven Artikeln.
Und was ist mingrelisch? 400.000 Menschen im Westen der Republik Georgien sprechen diese südkaukasische Sprache. Sie entstand wohl zwischen dem 6. und dem 9. Jahrhundert. Das Lasische, mit dem sie eins war, setzte sich durch die Islamisierung der Lasen ab und das Mingrelische separierte sich von diesem. Setzt die Abstoßung erst einmal ein, dann neigt sie offenbar zur Radikalisierung. Auch das kann man hier nachlesen.
"Wieser Enzyklopädie des europäischen Ostens", 20 Bände, Vorauszahlungspreis: 1.700 Euro. Wieser Verlag, Klagenfurt, Wien, Ljubljana, 2002. Band 10: Lexikon der Sprachen des Ostens, herausgegeben von Milos Okuka unter Mitwirkung von Gerald Krenn, 1031 Seiten, 145 Euro.