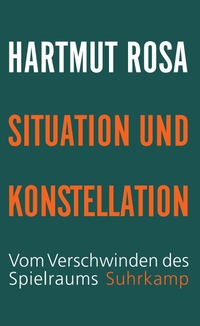Essay
Die Fatwa als Handlungsmodell
Von Thierry Chervel
09.01.2025. Niemand hätte heute mehr den Mut, die "Satanischen Verse" zu schreiben, geschweige denn zu publizieren. Zu machtvoll ist das mit der Fatwa wieder errichtete Tabu. Aber die Fatwa war auch inspirierend: Im Kleinen hat die westliche Linke nach 1989 das Modell der Fatwa immer wieder kopiert und sich angeeignet. Die Fatwa als neues Verfahren zur Einschüchterung der Mehrheit begründete das Bündnis zwischen westlicher Linker und dem Islamismus. Auszug aus dem Buch "Das verordnete Schweigen", das am Montag in Berlin vorgestellt wird.
==============
Die Fatwa sitzt uns in den Knochen. Sie ist in uns gefahren. Sie strukturiert unser Denken. Sie ist der effektivste Zensurakt seit der Institutionalisierung der Inquisition im Zeitalter des Buchdrucks, seit der Papst dem Ketzer Bruno einen Nagel in die Zunge trieb.
Mit dem Jahr 1989 assoziieren die meisten Menschen den Mauerfall. An historische Tage erinnert man sich: Alle, die damals schon lebten, wissen, wo sie am 9. November waren. Ich weiß auch, wo ich am Valentinstag war. An diesem Tag hatte der Ajatollah seinen Blitz herabgesandt. Ich war damals bei der taz, organisierte zusammen mit Christiane Peitz und Arno Widmann die Berlinale-Seiten - vier Seiten am Tag. Es war im Nachhinein gesehen ein ziemlich guter Jahrgang. Den Goldenen Bären bekam am Ende "Rain Man" mit Tom Cruise und Dustin Hoffman. Wir sammelten Unterschriften gegen die Fatwa und waren stolz, auch Wim Wenders gewonnen zu haben.
Rushdies Romantitel bezieht sich auf die "Satanischen Verse", in denen der Koran vorübergehend andere Gottheiten neben Allah anerkennt. Khomeini hatte als Reaktion darauf Muslime weltweit dazu aufgerufen, Rushdie zu umzubringen. Ich habe darüber vor einigen Jahren im Perlentaucher geschrieben.
Die unmittelbaren Folgen der Fatwa sind bekannt. Rushdie musste jahrelang untertauchen. In seinem Roman hatte er Khomeini und "Ms. Torture" (so heißt Margaret Thatcher in den "Versen") als parallele Monster aufgebaut. Nun musste ihn Thatcher vor Khomeini verstecken - aber nur aus Prinzip, denn "die britische Regierung, das britische Volk haben keine Sympathie für das Buch" insistierte ihr Außenminister Sir Geoffrey Howe, "es vergleicht Großbritannien mit Hitlerdeutschland".
Rushdie erzählt all das in seinem großartigen autobiografischen Buch "Joseph Anton", in dem er in distanzierender Er-Form über seine Erlebnisse berichtet. "Er fand die Zahl der Labour-Parlamentarier erschreckend, die sich auf die Seite der Muslime schlugen - schließlich war er sein Leben lang Anhänger der Labour-Partei gewesen -, und betrübt stellte er fest, dass 'die wahren Konservativen Großbritanniens heutzutage in der Labour-Partei sind, während die Radikalen Blau, die Farbe der Konservativen, tragen'." Besonders aber schmerzte der Verrat im Literaturbetrieb, auch in Deutschland. Der deutsche Verlag Kiepenheuer & Witsch zog sich aus Angst zurück. Walter Jens weigerte sich, eine Lesung aus den "Versen" in der Akademie der Künste abzuhalten. Bitter musste Rushdie einen Angriff des linken Fotografietheoretikers John Berger im Guardian zur Kenntnis nehmen. Auch Konservative wie John Le Carré schrieben Sätze wie "Ich glaube nicht, dass es einem von uns gegeben ist, die großen Religionen ungestraft beleidigen zu dürfen".
Als "Joseph Anton" erschien, hatte sich Rushdie entschieden, sich wieder frei in der Öffentlichkeit zu zeigen. Das iranische Regime hatte erklärt, die Fatwa nicht zu unterstützen, ein wirklicher Widerruf war das nicht, aber es reichte Rushdie. Er wusste noch nicht, dass "Joseph Anton" eine Fortsetzung haben würde: "Knife", erschienen 2024 als Verarbeitung der Messerattacke auf ihn im August 2022. Die "Satanischen Verse" haben Rushdie ein Auge und den Gebrauch einer Hand gekostet. Viele andere waren vor ihm umgebracht worden.
"Die Satanischen Verse" sind der letzte Roman der europäischen Aufklärung und zugleich ein Roman, der versucht, diese Ideen in den muslimischen Kontext zu transferieren. Rushdies Idee war, westlichen Rassismus und muslimischen Obskurantismus als parallele Phänomene zu begreifen, deren Bekämpfung nicht zu trennen ist. Rushdie schrieb den Roman als dezidierter Linker und Thatcher-Feind. Trotzdem hatte er auch schon vor den "Satanischen Versen" Neider in der Linken, denn er schrieb im Idiom der Globalisierung - dem Englischen. Das wurde ihm als Verrat angekreidet. Man hatte die Inder gern in der folkloristischen Ecke, sie sollten sich nicht in die schöne englische Literatur einmischen. Aber Rushdie weigerte sich von Anfang an, als Talisman im Eine-Welt-Laden zu dienen. Und das Schlimmste war: Er war der Beste, mit Preisen überhäuft, vom Publikum angehimmelt, erfolgreich, reich: Die "Satanischen Verse" hatten ihm den bis dahin höchsten Vorschuss eines Verlags eingebracht.
Verrat ist ein gefährlicher Vorwurf. In allen Kirchen und allen Sekten, auch politischen, führt er zu Exkommunikation, zielt auf die symbolische und oft auch physische Vernichtung der "Verräter". Verrat - ich verrate dir ein Geheimnis - ist aber auch ein innerster Impuls der Aufklärung. Ich verrate dir ein Geheimnis, und das Geheimnis ist, dass da nichts ist: Es gibt wahrscheinlich keinen Gott, beiß nur in das Schinkenbrot, der Himmel stürzt nicht ein. Mohammed ist nur ein Mensch, auch Mahound genannt, nichts anderes behauptet ja auch der Koran. Die "Satanischen Verse" aber gab es tatsächlich, sie waren eine Art Kompromissformel mit vormaligen matriarchalischen Gottheiten, die dann wieder aus dem angeblich von Allah diktierten Koran entfernt wurden. Auch dies ein Geheimnis, das verraten gehört: Der Koran folgt politischen Konjunkturen, auch der Koran ist nicht das letzte Wort. Faszinierenderweise baut Rushdie seine aufklärerische Botschaft in eine postmoderne Meta- und Schachtel-Konstruktion ein. Er erzählt, dass eine Erzählung eine Erzählung ist, auch der Koran ist nur Menschenwerk. Der "großen Erzählung" - auch so ein Begriff der Postmoderne - hält er die weiße Magie der literarischen Fiktion entgegen. Literatur ist für Rushdie der Zauber der Entzauberung.
Der Ajatollah erhebt schon im Roman sein finsteres Haupt, wie ein böser Weihnachtsmann, der sich nicht scheuen wird, seine Rute zu gebrauchen. 35 Jahre danach können wir sagen: Die Fatwa war so etwas wie der zweite Gründungsakt einer Religion. Ein Tabu, das in den westlichen Gesellschaften mehr oder minder geschleift oder zumindest ramponiert schien, wurde in seiner ganzen starrenden Übergröße wieder errichtet.
Die durch die Fatwa seitdem ausgeübte Zensur hat nicht nur funktioniert, sie hat die westlichen Öffentlichkeiten von innen neu strukturiert. Die Fatwa markiert für sie einen paradigmatischen Bruch. Die Rushdie-Affäre, gab Rushdies Schriftstellerkollege Hanif Kureishi zu, habe ihn in seinem eigenen Schreiben getroffen. Ja, der Begriff des Schreibens selbst habe sich verändert. "Niemand hätte heute mehr die Eier, die 'Satanischen Verse' zu schreiben oder sie gar zu publizieren. Schreiben ist zaghaft geworden, die Schriftsteller haben Angst." Siebzehn Jahre nach der Fatwa zeigten die westlichen Länder in der Affäre um die dänischen Mohammed-Karikaturen, dass sie sich der Drohung fügten. Auf Anfrage der Tageszeitung Jyllands-Posten sollten zwölf Karikaturisten die Probe aufs Exempel machen und die Frage beantworten, ob es heute noch möglich sei, Mohammed zu karikieren. Der durch die Fatwa etablierte Mechanismus schnappte mit tödlicher Wucht zu. Interessierte Kreise versetzten die Karikaturen mit Fälschungen und Gerüchten. Es kam zu den üblichen Protesten und Flaggenverbrennungen, zu diplomatischen Spannungen sowie Angriffen auf europäische Einrichtungen in einigen Ländern.
Das Interessante war aber die Reaktion der Medien. Die Zeitungen berichteten zwar, aber sie zeigten nicht. Außer der Welt - auch der Perlentaucher brachte sie - druckte keine deutsche Zeitung die Karikaturen. Die Leser konnten sich also gar kein Bild davon machen, dass die Karikaturen völlig harmlos waren. Keine dieser Karikaturen war auch nur im Ansatz beleidigend oder gar rassistisch. Einzig die berühmte Zeichnung von Kurt Westergaard - die Bombe im Turban des Propheten - war ansatzweise blasphemisch, aber sie formulierte doch auch nichts anderes als die Kritik, dass sich Religion mit Terror verband. Und es ging weiter: Die dänische Politologin Jytte Klausen veröffentlichte ein wissenschaftliches Buch über die Karikaturenaffäre, "The Cartoons that Shook the World" - aber die Yale University weigerte sich, die Karikaturen in diesem Buch zu zeigen. Und Kenan Malik, Autor des grundlegenden Buchs "From Fatwa to Jihad", erzählt eine Geschichte, die zeigt, welche Absurditäten die Angst erzeugt: Die britische Zeitschrift Index on Censorship, deren vornehmste Mission es ist, die Meinungsfreiheit zu verteidigen, berichtete über das Klausen-Buch und die Weigerung des Verlags - und sie druckte die Karikaturen ebenfalls nicht!
Kenan Malik hat den Begriff des "Cultural Turn" geprägt, der sich in der Rushdie-Affäre erstmals kristallisiert habe. Die Frage "Wer sind wir?" hätte die Frage "In welcher Gesellschaft wollen wir leben?" verdrängt. Wie Rushdie oder Kureishi hat Malik pakistanischen beziehungsweise indischen Kontext und ist politisch in den Achtzigern sozialisiert worden. Damals grassierte in den britischen Städten ein wilder Rassismus. Malik und Rushdie betrachteten sich als linke Aktivisten gegen den Thatcherismus. Malik schreibt, er habe sich als "Schwarzer" begriffen, der religiöse Hintergrund spielte nicht die geringste Rolle. Aber in den Achtzigern etablierte sich auch eine konservative Politik des Multikulturalismus. Lokalpolitiker suchten Ansprechpartner in den unruhigen "Communities" und statteten oft gerade die konservativsten und frömmsten Repräsentanten mit Geldern und ein bisschen Macht aus. Wir hatten darum gekämpft, dass wir trotz unserer Andersheit als gleiche behandelt werden, schreibt Malik, nun etablierte sich ein Diskurs, der verlangte, dass andere als "andere" behandelt werden sollten.
Darum ist die Fatwa epochal: Der "Cultural Turn", in den sie einschlug und den sie entscheidend weitertrieb, hat innerhalb der westlichen Gesellschaften zu einer völlig neuen Organisation der politischen Magnetfelder geführt. Auch der heutige Clinch zwischen einer "leitkulturellen" populistischen oder extremen Rechten und der "woken" Linken entstand in dieser Konstellation: Sie halten die Mitte im Griff.
Meine Idee ist, dass der Ajatollah mit seiner Fatwa ein Handlungsmodell erfand, das die westlichen Gesellschaften inzwischen weit über den muslimischen Kontext hinaus prägt. Insbesondere die multikulturelle, später "woke" genannte Linke dürfte in diesem Modell bewusst oder unbewusst eine Inspiration gefunden haben - ob die Fatwa auch einen ähnlichen Einfluss in der Rechten ausübte, wäre zu untersuchen, Identitätspolitik betreiben sie ja beide. Nach dem Modell der Fatwa bekundet eine Community ihr Beleidigtsein und droht der Mehrheitsgesellschaft mit Unfrieden, bis diese ihr den gehörigen Respekt erweist und sie womöglich mit Geldern und Macht ausstattet. Identität wird nicht mehr als individuelle Eigenschaft, sondern als Funktion einer Gruppe gesehen: Malik betrachtete sich nicht als Muslim, aber durch den "Cultural Turn" wurde er dazu gemacht, ob er wollte oder nicht.
Die Fatwa fügte sich gerade mit ihrem terroristischen Anspruch bestens in die postmoderne Konjunktur, die sich in den späten Achtzigern an den Unis etablierte. Je absoluter der religiöse Anspruch, desto besser konnte sich daran der nunmehr an den Unis regierende Kulturrelativismus erweisen. Das Kopftuch wurde zum Signet einer aparten und unbedingt zuzulassenden Andersheit, die im Namen der Vielfalt zu verteidigen war: Auch damit ließen sich viele neue Uni-Stellen schaffen für Migrationsforscher oder Gleichstellungsbeauftragte. Je schärfer die Kriegserklärungen des Islamismus, desto eindringlicher die Mahnungen der Kulturwissenschaftler zur Toleranz. Der Begriff der "Islamophobie" begann sich noch in den Aschewolken des 11. September abzuzeichnen. Später wurde er zum "antimuslimischen Rassismus" geschärft.
Helen Pluckrose und James Lindsay erzählen in ihrem Buch "Cynical Theories", wie sich die ursprünglich ironischen, spielerischen und apolitischen Denkmodelle der Postmoderne im Zeichen der "Critical-Justice-Theorien" zu schlagkräftigen Programmen des Aktivismus wandelten. Was diese Theorien von Foucault und Derrida übernahmen, war deren Analytik der Macht: Die Macht geht durch uns durch, lehrte Foucault. Wir müssen das Zauberwort finden, um sie zu dekonstruieren, so Derrida. Die Urszene der Postmoderne ist die Schilderung einer grausamen Hinrichtung zu Beginn von Foucaults "Überwachen und Strafen", die in die Pointe mündet, dass die Gefängnisarchitekturen des 19. Jahrhunderts nur scheinbar humaner seien und die Gewalt nur internalisieren.
Macht und Wissen sind bei Foucault und Derrida Konstruktionen, die keine objektive Geltung beanspruchen können und stets durch Sprache und andere Zeichensysteme vermittelt werden. Aber den "Social Justice Warriors" reicht es nicht mehr aus, Macht zu analysieren - es kömmt darauf an, sie zu erlangen. Durch das Fatwa-Modell werden sie selbst zu Konstrukteuren von Macht. Am Anfang steht immer ein zensorischer Akt, der die Mehrheit zur Anpassung an neue Sprachregelungen drängt. Lindsay und Pluckrose erzählen, wie aus Gendertheorie, Queer Studies, Critical Race Theory, Intersektionalismus und Postkolonialismus lauter neue Felder politischer Betätigung wurden.
Gewiss verknüpft sich nicht jede Forderung nach einem Gendersternchen, jeder Protest gegen eine "Mikroaggression", jeder Kampf gegen einen kolonialen Straßennamen, jede Einladung zu Critical Whiteness gleich mit einer Gewaltandrohung. Was aber nie fehlt, ist eben diese zensorische Geste. So wie die Fatwa faktisch einen neuen Blasphemie-Straftatbestand schuf, so verlangt der identitätspolitische Protest stets Unterwerfung der Mehrheit unter ihre Sprachvorschriften. Wer nicht mitmacht, wird ausgeschlossen: Nur Terfs, "Trans-Exclusionary Radical Feminists", würden das Sternchen nicht setzen. Die "kleine verletzliche Minderheit" wird zum Kriterium der Politik.
Dass Verletzlichkeit zum Machtfaktor mutiert ist, zeigt sich an einer Politik, die sie zur Leitlinie macht. Kein Gesetz, das nicht von amtlichen "Sensitivity Readern" gegengelesen wird. Die Regierung ist umgeben von einem Heer von Beauftragten, die "regierungsunabhängig" jedes administrative Tun auf seine Kompatibilität mit den verschiedenen Opfergruppen überprüft. Und auch die Gesellschaft wird überwacht und in den Jahresberichten der Diskriminierungsbeauftragten sondiert. Der Befund ist stets alarmierend, der Stellenbedarf liegt auf der Hand, die Medien rezitieren brav, die zuständigen Minister versprechen neue Maßnahmen.
Faszinierend ist, dass eine Juristin wie Frauke Rostalski dieses Phänomen in ihrem Buch "Die vulnerable Gesellschaft" beschreiben kann, ohne sich um eine historische Herleitung besonders zu bemühen. Auch sie stellt fest, dass "Verletzlichkeit" zum leitenden Faktor von Politik geworden ist. Für sie ist die Corona-Episode der Gründungsfaktor: in diesem Moment, schreibt sie, kam der Begriff der "besonders vulnerablen Gruppen" in Umlauf, die die Rücksicht der Allgemeinheit verlangten. Aber auch ohne eine Herleitung beschreibt Rostalski die Mechanismen richtig: "Es zeigt sich, dass Vulnerabilität deutlich ernster genommen wird als noch vor einigen Jahrzehnten. Darüber hinaus werden Vulnerabilitäten in neuen Lebensbereichen ausgemacht, für die sodann ein rechtlicher Handlungsbedarf angemeldet wird. Dies hat zu einer spürbaren Reduzierung von individueller Freiheit geführt." Die "vulnerablen Gruppen" appellieren in der Beschreibung Rostalskis stets an den Staat, der eine Chance zur Ausdehnung seiner Kompetenzen wittert und immer neue Schutzinstanzen schafft: "Bei genauer Betrachtung geht es im Kern nicht darum, ob die Freiheit des einen zugunsten der Freiheit des anderen eingeschränkt wird. Immer dann, wenn staatliche Maßnahmen ergriffen werden, um Freiheit neu zu vermessen, geht dies nämlich auf Kosten der individuellen Freiheit aller. Die kulturkämpferische Linie verläuft also an der Grenze zwischen Freiheit und Sicherheit."
Und in der Tat wurden in vielen Demokratien neue zensorische Gesetze erlassen. "Das Verbrennen religiöser Bücher ist in Dänemark ab heute verboten", meldete der Tagesspiegel im letzten Dezember - die Proteste der Opposition fruchteten nicht. In Schottland trat im April 2024 ein neues Gesetz gegen "Hate Speech" in Kraft. Bei der Polizei wurden 400 Meldestellen für "Non Crime Hate Speech" eröffnet, bei denen man sich melden kann, wenn ein Mitbürger Missliches sagte. Die schottische Polizei überwacht. In Deutschland wurde noch unter der Regierung Merkel der Straftatbestand der "verhetzenden Beleidigung" neu ins Strafgesetzbuch aufgenommen: "Die Erweiterung des strafrechtlichen Ehrschutzes durch § 192a StGB beruht auf dem Gedanken, dass Merkmale wie die nationale oder religiöse Herkunft, die Behinderung oder die sexuelle Orientierung eine Person gegenüber verbalen Attacken besonders verletzlich machen können", erläutert Rostalski. Das Gesetz trage "die Handschrift der Vulnerabilität".
Dass Vulnerabilität und Aggressivität sich nicht ausschließen, bemerkt auch Rostalski. Verletzlichkeiten rufen Abwehrreaktionen hervor, schreibt sie. "Um so höher das eigene Interesse daran gewichtet wird, im Diskurs nicht verletzt zu werden, desto näher liegt es, selbst besonders abwehrend gegenüber potenziellen Verletzungen zu reagieren. Das Resultat ist dann eine deutliche Verschlechterung des Diskursklimas." Allerdings. Ajatollah Khomeini hatte sich bei der Begründung seiner Verletzlichkeit nicht mal große Mühe gegeben: "Ich informiere alle tapferen Muslime der Welt, dass der Autor der 'Satanischen Verse', eines Textes, der gegen den Islam, den Propheten des Islam und den Koran geschrieben, herausgegeben und veröffentlicht wurde, zusammen mit allen Herausgebern und Verlegern, die von seinem Inhalt wussten, zum Tode verurteilt wird." Es reicht, dass Rushdie angeblich einen Text gegen den Islam geschrieben hat.
"Der Viktimismus ist ein Bellizismus", schreibt darum zu Recht Pascal Bruckner, der sich in seinem neuen Buch "Je souffre donc je suis" mit dem gleichen Thema auseinandersetzt. "Je größer das Selbstmitleid, desto berechtigter fühlt man sich, jene zu bestrafen, die man zum Feind auserkoren hat. Groß sind die Tränen der Wut und der Feindseligkeit."
Den Viktimismus pflegen neben den Islamisten auch die beiden anderen Fraktionen, die die bürgerliche Mitte heute umstellen, die woke Linke und der Rechtsextremismus. Aber Linke und Rechte verhalten sich nicht einfach symmetrisch. Denn die Rechte agiert direkt und reklamiert den Opferstatus für die eigene "Kultur", die sie vom "großen Austausch" bedroht sieht. Diese Ideologie lässt sich prima verdünnen: Sie treibt Anders Breivik oder den Attentäter von Christchurch an und findet sich ein wenig abgemildert genauso in den Wahlprogrammen der AfD und anderer rechtspopulistischer Parteien.
Die Linke agiert ihren Viktimismus anders als die Rechten indirekt aus, indem sie immer neue gesellschaftliche Gruppen zu Opfern erklärt, derer man sich erbarmen müsse und zu deren Fürsprechern sie sich aufwirft. Zu diesen Gruppen gehören die Muslime, die etwa der Antisemitismusforscher Wolfgang Benz als kleine verfolgte Minderheit an die Stelle der Juden setzte. Was Rechte und Linke aber gemein haben, ist, dass sie in Allianzen stehen. Während die Rechten vor Putin und Xi in Ehrfurcht erstarren, finden die Linken seit Michel Foucaults Hymnen auf die iranische Revolution ihre heimlich bewunderte Projektionsfigur im Islamismus.
Khomeinis genialer Coup war es, den Westen nicht allein der Arroganz zu beschuldigen, sondern die westliche Linke dabei in einem Moment zu erwischen, als sie selbst nach Millionen Toten das universalistische Modell des Sozialismus ad acta legte und ein neues Subjekt der Geschichte suchte. Der totalitäre Schlag erfolgte, als die Linke ihren Kulturrelativismus in den Schriften der Postmoderne oder Edward Saids Orientalismus-Buch zwar schon formuliert hatte, aber noch nicht wieder ein Handlungsmodell besaß. Das Bündnis, das sich zwischen der Linken und dem Islamismus etablierte, bestand dann weniger in tatsächlichen Traktationen zwischen den weit entfernten Protagonisten als in einem Klammergriff zwischen islamistischer Herausforderung und kulturalistischer Relativierung, der sich wie von selbst etablierte. Die Linke stützte aktiv die Intentionen des Islamismus, indem sie von dessen Totalitarismus ablenkte und stattdessen vor "antimuslimischem Rassismus" warnte. Hier agierte sie übrigens in konfliktueller Komplizenschaft mit der extremen Rechten, denn beide, sowohl die Linke, als auch die Rechte, profitierten vom Islamismus, die Linke, indem sie Wegsehen und Beschwichtigen als einzig mögliche Politik verkaufte und sich damit Staatsgelder und moralische Autorität erarbeitete, die Rechte, indem sie behauptete, sie sei die einzige, die hinsieht und benennt.
Die eigentlichen Kollateralschäden dieses Clinches aber waren jene, die wirklich benennen, die "Dissidenten des Islam", Salman Rushdie als erster.
Selbstermächtigung als Opfer, Herausforderung einer vermeintlichen Übermacht, ultimative Forderungen an den "alten weißen Mann", der an allem schuld ist und für alles aufkommen soll - das ist das Modell der Fatwa. Es scheut den steinigen Weg der Emanzipation und geht lieber den der "kleinen Pubertät".
Ein Störfaktor wäre allerdings noch zu beseitigen, und in diesem Punkt zeigen sich Linke und Islamismus am innigsten verbunden: Es geht um die Juden. Pascal Bruckner spricht in seinem Buch das altbekannte Problem der Opferkonkurrenz an. Die Linke hatte die Singularität des Holocaust im Grunde ohnehin nur so lange verteidigt, wie es galt, den Kommunismus gegen den Vergleich mit dem Nationalsozialismus zu verteidigen. Im Grunde aber hatte sie schon immer ein Problem mit dem Holocaust. Die palästinensische Sache erlaubte es, dieses Problem zu rationalisieren. "Nach 1945 und dem Holocaust war die Figur des Juden auf ein Podest gehoben worden", schreibt Bruckner, "und wurde dann als Israeli wieder heruntergestürzt und aller Übel von Kolonialismus, Rassismus bis Imperialismus beschuldigt. Die Erwähltheit wurde zum Fluch, aus dem Modell wurde der Rivale, den man aus dem Weg räumen musste, um seinen Platz einzunehmen."
Die von der akademischen Linken angestoßenen Debatten der letzten Jahre wirken wie ein intellektuelles Training für das, was dann kam. Der Postkolonialist Dirk Moses beschuldigte die Deutschen, einem Katechismus der Schuld anzuhängen, der für ihn bizarrerweise das letzte Hindernis war, das vor der ersehnten Delegitimierung Israels stand - Argumentationen, wie man sie bis dahin nur von extrem Rechten kannte. In der "Jerusalemer Erklärung" exkulpierte man dann den Hass auf Israel als "nicht per se" antisemitisch.
Zur Kernreaktion zwischen den beiden getrennt agierenden, aber sich ergänzenden Strömungen der woken Linken und des Islamismus kam es am 7. Oktober 2023, als sich in obszöner Deutlichkeit der Antizionismus westlicher Linker mit dem eliminatorischen Antisemitismus der Hamas und des Iran verband. Auf die Reinszenierung israelischer Juden als absolute Opfer - egal ob Baby oder Holocaustüberlebender, jetzt und immer wieder -, antwortete die Linke zunächst mit Schweigen, dann mit "Kontextualisierung" bis hin zu aktiver Leugnung. Renommierteste Intellektuelle, vornehmste Medien gaben der Täter-Opfer-Umkehr ihr Cachet: Die New Yorker-Autorin Masha Gessen brachte es fertig, den Gaza-Streifen mit den Judenghettos in dem von den Nazis besetzten Polen gleichzusetzen - nein, es war kein Vergleich sondern eine Gleichsetzung -, während sie im selben Atemzug empfahl, den genozidalen Kern des Hamas-Verbrechens nicht zu benennen. Fortan war es Israel, das den Genozid beging. Besonders symbolisch waren die Äußerungen Judith Butlers, die die Hamas als Befreiungsbewegung betrachtete und ihr Agieren als "nicht per se" antisemitisch, während sie bezweifelte, dass israelische Frauen tatsächlich vergewaltigt worden seien. Eine Symbolfigur ist Butler als die bei weitem prominenteste Vertreterin jener zweiten Generation poststrukturalistischen Denkens. Sie hatte einen entscheidenden Anteil daran gehabt, aus diesem Denken eine Waffe zu formen.
Die Fatwa war ein Ereignis, einschneidender vielleicht als der Mauerfall, zu dem sie in unterirdischen Verbindungen steht. Aus dem Ereignis ist inzwischen längst eine Struktur geworden. Ungewiss, ob wir uns aus ihr befreien können.
Thierry Chervel
4 Kommentare