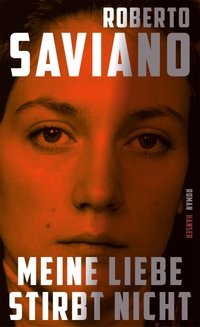Im Kino
Der Grundzustand ist Melancholie
Die Filmkolumne. Von Lukas Foerster, Michael Kienzl
12.12.2018. Alfonso Cuarón rekonstruiert in "Roma" die Welt seiner Kindheit; allerdings aus der Perspektive einer Hausangestellten. In Steve McLeans "Postcards from London" wird der Hauptdarsteller Harris Dickinson zu einer dankbaren Projektionsfläche.
Das räumliche Zentrum des Films ist eine gefließte Hauseinfahrt, die von einem mit Milchglas verkleideten Eisentor begrenzt wird, das auf eine belebte Strasse in einem recht wohlhabenden Viertel von Mexico City führt. Gleich zu Beginn sehen wir, wie sich im über die Fließen schwappenden Putzwasser ein Flugzeug spiegelt, das den Himmel überquert. In einer späteren Szene sind die Kinder der Familie, von der Alfonso Cuarón neuer Film "Roma" erzählt, regelrecht hingerissen vom Spektakel der hochspritzenden Hagelkörner, die auf den weißen Kacheln aufschlagen.
Die Einfahrt als ein Medium ästhetischer Erfahrung - für Borras, den Hund der Familie, der, sobald sich jemand dem Tor von außen nähert, freudig erregt und ungestüm in die Höhe springt, dient sie allerdings vor allem als Toilette. Deshalb das Putzwasser. Aber dennoch liegen in der Einfahrt fast jedes Mal, wenn sie im Bild ist, mindestens zwei, drei, oft deutlich mehr Haufen Hundekot. Zu Fuß kann man diesen Hindernissen recht gut ausweichen, mit dem Auto wird das deutlich schwieriger. Erst recht, weil die Einfahrt eigentlich ein wenig zu eng ist für die breit ausladende Limousine der Familie. Dem Vater gelingt es, mit viel kleinteiligem Herummanövrieren, den Wagen dennoch einigermaßen unbeschadet einzuparken. Cuarón nutzt die Szene für einen abrupten kinematografischen Tempowechsel: Die ansonsten dominierenden geduldigen, in die Tiefe hinein gestaffelten Plansequenzen werden unterbrochen von einem Schub konstruktivistischer, flächiger Maschinenmontage.
Später im Film verliert die inzwischen vom Vater sitzengelassene Mutter (Marina de Tavira) die Geduld und ramponiert bei ihrem Parkversuch Einfahrt und Wagen gleichermaßen; woraufhin sie sich einen anderen, kleineren Wagen kauft, ein Alleinerziehendenauto, das besser in die und zur Einfahrt passt. Die Einfahrt ist also in diesem überaus sorgfältig gebauten Film auch ein Medium der dramaturgischen Zuspitzung und der Figurenpsychologie: ein Transitraum, in dem die Konflikte, die sich in den anderen Räumen des Films anbahnen noch einmal metaphorisch nachgespielt werden, wie auf einer Bühne.
In gewisser Weise etabliert die Einfahrt sogar die Erzählperspektive, denn das einzige Zimmer mit direktem Blick auf die Fließen ist das von Cleo (Yalitza Aparicio), eine von zwei Hausangestellten. Nicht die Mitglieder der Kernfamilie stehen im Zentrum der Erzählung, sondern eben Cleo, die zwar von den Kindern geliebt und von den Erwachsenen im Allgemeinen respektvoll behandelt wird, die aber beim gemeinsamen Fernsehabend doch nur auf einem Kissen neben der Couch sitzt, auf Abruf bereit, und die den Telefonhörer, bevor sie ihn an ihre Chefin weitergibt, an ihrem Kleid abwischt, in der Furcht, sie könnte ihn irgendwie beschmutzt haben.

Solche oft herzzerreißende Details, beziehungsweise die Aufmerksamkeit, die Cuarón ihnen zuteil werden lässt, kennzeichnen "Roma" als einen Erinnerungsfilm. Die Handlung spielt in den 1970 Jahren, Cuarón wuchs damals selbst in Mexico City auf, in einem Haushalt, der dem im Film gezeigten wohl in vieler Hinsicht ähnlich war. Ausgangspunkt des Projekts dürfte das Verlangen gewesen sein, die eigene Jugend noch einmal zu rekonstruieren. Sichtbar wird das, wie erwähnt, in der Detailfülle und vor allem -dichte, in den beeindruckenden, kontrastarmen Schwarzweißtableaus von Dingen, Menschen, Gesten, aus denen "Roma" zu allererst besteht.
Die Militärkapellen, die regelmäßig durch die Straße vor dem Haus marschieren, das Geräusch der unter dem Autoreifen zerquetschten Hundescheiße, aber auch, wie Cleo dem ältesten Sohn (Cuarons alter ego?) aus dem Schlafanzug hilft, oder wie dessen jüngerer Bruder die Haushälterin umarmt, während die Mutter gehemmt, mit durchgedrücktem Kreuz danebensitzt. Dazwischen fantasmagorische und karnevaleske Miniaturen, oft mit einem militaristischen Beigeschmack: eine nackte Martial-Arts-Demonstration mit der Duschvorhangstange als Schwert, eine Landpartie, auf der die Damen und Herren der höheren Gesellschaft ihre Schusswaffen ausprobieren, ein Schausteller, der sich von einer riesigen Kanone durch die Gegend ballern lässt. Schließlich auch noch, eine weitere Schichtung, Zeitgeschichte: Zuerst rumort es nur in den Fernsehnachrichten, aber die sozialen Konflikte drängen immer massiver ins Bild, entladen sich schließlich in einer Straßenschlacht und in der komplexesten Einstellung des Films, in der ein Möbelhaus zum multidimensionalen dramaturgischen Dreh- und Angelpunkt des Films wird.
Das alles nicht nacheinander, sondern neben-, in, vor- und hintereinander. Am liebsten alles gleichzeitig in einem Bild: die intime Familienerzählung, die verzauberte Dingwelt der Kindheit, die materiellen Texturen der Vergangenheit. Die menschliche Kanonenkugel zum Beispiel ist nur im Hintergrund zu sehen, während vorne Cleo auf einer matschigen Slumstrasse auf Holzplanken balanciert. Cuaron scannt seine eigenen Erinnerungen, und bereitet sie auf in Gestalt von informationsgesättigten Plansquenzen, die außerdem in Bewegung versetzt werden; in Innenräumen dominieren Schwenks, außen Tracking-Shots, wobei sich die Kamera mit sehr wenigen Ausnahmen (wunderschön: ein überraschender Schwenk nach oben auf die Wäsche, die auf dem Dach des Hauses zum Trocknen aufgehängt ist) nur lateral bewegt, von links nach rechts und wieder zurück. Das Ergebnis ist ein Dioramaeffekt: Wir können die Welt aus verschiedenen Perspektiven betrachten, dabei das Verhältnis von Vorder- zu Hintergrund, vom Detail zum Ganzen immer wieder neu justieren, aber eindringen, erobern, besitzen können wir sie nicht. Der Grundzustand ist Melancholie, Unerreichbarkeit, eine private Musealisierung. Eine der kunstvollsten, aufwändigsten Plansequenzen zeigt Cleo, die Mutter und alle Geschwister im Meer, gerade haben sie eine gefährliche Situation glimpflich überstanden, jetzt vereinen sie sich zu einer einzigen Menschen-im-Affekt-Skulptur, die Wellen schäumen, die tiefstehende Sonne glitzert zwischen den Leibern. Ein geradezu transzendentales Erinnerungsbild, das aber eben doch dazu verdammt ist, in Schönheit zu erstarren.
Aber Cuarón bleibt bei diesem nostalgischen Impuls nicht stehen. Er leitet ihn um auf die Geschichte von Cleo und auch auf die Geschichte seiner Mutter. Beide werden im Verlauf des Films von Männern verlassen. Wenn die Mutter im Vordergrund zum letzten Mal ihren Mann umarmt, gierig und verzweifelt, drückt Cleo im Hintergrund einen der Söhne an sich. Ihr eigener Freund haut früher ab, gleich nachdem sie ihm (während eines Kinobesuchs) erzählt, dass sie schwanger ist. Es folgt eine doppelte Tragödie der Hilflosigkeit. Das ist die innere Paradoxie des Films und auch sein emotionaler Kern: Die Sehnsucht nach der Welt der Kindheit ist für Cuarón nicht zu trennen vom - unterschiedlich gearteten und auch unterschiedlich weitreichenden - Unglück jener zwei Frauen, die diese Welt maßgeblich hergestellt hatten. Auf Kosten ihrer eigenen Sehnsüchte.
Lukas Foerster
Roma - Mexiko 2018 - Regie: Alfonso Cuarón - Darsteller: Yalitza Aparicio, Marina de Tavira, Diego Cortina Autrey, Carlos Peralta, Marco Graf, Danela Demesa - Laufzeit: 135 Minuten.
"Roma" ist seit dem 6.12. in einigen (wenigen) Kinos zu sehen, ab dem 14.12. ist der Film auf netflix verfügbar. Wir empfehlen die große Leinwand.
---

Die Figuren in Steve McLeans neuem Film sind nicht einfach nur Stricher, sondern Raconteurs. Erstmal scheint das nur ein schickerer, weil französischer Begriff gleichen Inhalts zu sein. Aber "Postcards from London" stellt bald klar, dass der sexuelle Akt durch diese Bezeichnung nicht nur elegant verhüllt werden soll, sondern tatsächlich nebensächlich ist. Umso mehr widmet sich der Film dem Vor- und Nachspiel, das mit geistreichen Gesprächen über Kultur garniert wird. Was die Stricher eigentlich selbst begehren, steht dabei nie zur Debatte. Prositution ist hier ohnehin nur eine romantische Metapher dafür, selbst zum Kunstwerk zu werden. Dementsprechend geht es McLean dann auch vor allem um die Kunst an sich, oder vielleicht mehr noch darum, wieviel Arbeit sie macht.
"Postcards from London" handelt vom jungen, noch etwas naiven und ausgesprochen attraktiven Jim (Harris Dickinson), der von der Provinz in den Londoner Bezirk Soho zieht und aus Mangel an Alternativen bald in einer Bar für Escorts landet. Schnell weisen ihn seine unaufhörlich schnatternden Kollegen in den neuen Job ein, werfen mit Namen wie Fritz Lang und Fassbinder um sich und helfen ihm dabei, ein guter Raconteur zu werden. Was im Prinzip nichts anderes ist als ein etwas streberhafter Kunstvermittler mit hübschem Gesicht und großem Schwanz, der seine älteren Kunden zum Dahinschmelzen bringt, weil er ihnen den Unterschied zwischen dem frühen und dem späten Caravaggio erklären kann.
McLean erzählt von der Schönheit, ohne ihr Geheimnis ergründen zu wollen. Er bewahrt ihren Zauber, indem er sich auf ihre überwältigende Wirkung konzentriert - und die kann von einem barocken Gemälde ebenso ausgehen wie von einem hübschen Mann. Überhaupt dreht sich der Film immer wieder darum, dass Menschen zu Objekten werden; auf besonders zugespitzte Weise, wenn es um Jims Erkrankung am Stendhal-Syndrom geht, durch die er bei besonders wahrhaftigen Kunstwerken nicht nur einen Schwächeanfall bekommt, sondern sich auch plötzlich selbst im Bild sieht. Jim ist hauptberuflich Objekt der Begierde. Er scheint immer geil zu sein, niemanden abstoßend zu finden und nur für seine Arbeit zu leben. Und doch kommt ihm seine Subjektivität - die hier, ganz dem Kunstgedanken folgend, gleichzusetzen ist, mit: gestalterisch sein - immer wieder in die Quere. Etwa wenn er einen Kunden, der eigentlich nur ein bisschen kinky Action aus der Römischen Antike will, mit historischen Fakten über den heiligen Sebastian belehrt.

Auch außerhalb des Schlafzimmers muss Jim alles in einen größeren Kontext setzen. Sich selbst sieht er mal wie Warhols Pin-Up-Boy Joe Dallesandro, dann wieder wie Francis Bacons Muse George Dyer ("without the tragic ending"). Er will Leute inspirieren, Rohmaterial für ihre Kunst sein und muss dabei doch feststellen, wie eng die eigenen Grenzen gesteckt sind, wenn man immer nur anderen gefallen muss. Hauptdarsteller Harris Dickinson, der zuletzt in Eliza Hitmans "Beach Rats" zu sehen war, ist für diese Rolle genau der Richtige. Mit seinem gleichermaßen markanten und ebenen Gesicht wirkt er auf so unwirkliche Weise gutaussehend, dass man ihn auch für die gesamte Dauer des Films einfach nur ankucken könnte. Seine Rolle macht ihn endgültig zur dankbaren Projektionsfläche; zu jemandem, der sich nur öffnet und nie verschließt, der immer nur Ja und nie Nein sagt, der sich jederzeit nach eigenen Wünschen formen lässt.
Während aber Dickinsons Schönheit sinnlich erfahrbar ist, zeigt sich der Film nur wenig daran interessiert, die Faszination, die angeblich von der Kunst ausgeht, nachzuvollziehen. Überhaupt ist "Postcards from London" ein Film, der vermeintlich stylish ist, sich aber recht wenig für Ästhetik interessiert. Während die Parallelen zu ähnlich artifiziellen Filmen wie James Bidgoods "Pink Narcissus" oder Fassbinders "Querelle" vermutlich kein Zufall sind, gelingt es McLean nur selten, aus seinem stilisierten, entschieden nostalgischen Neonröhren-Soho einen eigenen Reiz zu entwickeln. Es bleibt ein abstrakter und etwas steriler Raum, dessen Leere nicht zum Denken oder Träumen einlädt, sondern mit künstlerischen Referenzen gefüllt wird, die zwar oft irgendwie zur dargestellten Welt des Films passen, aber selten mehr sind als reines Namedropping.
Ebenso wie McLeans 1994 entstandener Debütfilm "Post Cards from America" basiert auch sein Nachfolger lose auf Schriften des Künstlers David Wojnarowicz. Leicht fällt es nicht, den vor allem durch seine radikalen Performances bekannten, fest in der New Yorker Gegenkultur verwurzelten Wojnarowicz mit der etwas altbackenen Vorstellung von Kunst zusammenzubringen, die der Film besonders gegen Ende transportiert. Da wird fein säuberlich die echte von der falschen Kunst getrennt und das Leiden zur fundamentalen Erfahrung für einen schöpferischen Akt erklärt. Für den Protagonisten mögen diese Erkenntnisse Teil einer Selbstermächtigung sein, aber als Jim noch lediglich Objekt war, sich nicht mit Autorenschaft oder der Gier des Kunstmarkts auseinandersetzen musste, war der Film um einiges interessanter.
Michael Kienzl
Postcards from London - GB 2018 - Regie: Steve McLean - Darsteller: Harris Dickinson, Jonah Hauer-King, Alessandro Cimadamore, Leonardo Salerin, Raphael Desprez - Laufzeit: 90 Minuten.
Kommentieren