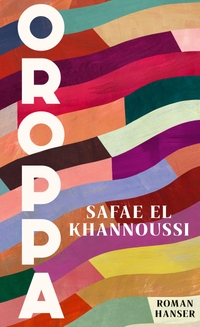Im Kino
Flucht nach Disney World
Die Filmkolumne. Von Nicolai Bühnemann, Lukas Foerster
13.03.2018. Einen undidaktischen Film in glamourösem Cinemascope über das amerikanische Prekariat hat Sean Baker mit "The Florida Project" gedreht. Roar Uthaugs entfetischisierte "Tomb Raider"-Neuauflage kultiviert klassische Tugenden, stellt sich dabei aber leider nicht geschickt genug an.
Einen wie Sean Baker kann das amerikanische Kino derzeit gut gebrauchen. Zum einen ist er ein großer Chronist des US-amerikanischen Prekariats der Gegenwart, dessen im einzelnen sehr unterschiedlichen Facetten er sich in seinen letzten drei Filmen gewidmet hat. Zum anderen ist er ein großer Humanist.
Das bedeutet, dass seine Filme ganz von den Figuren her gedacht sind. In "The Florida Project" geht es unter anderem um Kinder, die sich sehr bemühen, in kürzester Zeit so viel Chaos wie möglich zu verbreiten. Das beginnt damit, dass sie gemeinsam die Scheibe eines Autos bespucken und die Erwachsenen, die sie dazu anhalten, das zu unterlassen, aus vollem Hals beschimpfen. Das geht bis zur Brandstiftung in einem leerstehenden Haus. Der Film zeigt, dass sie aus einem Milieu kommen, in dem ihnen niemand irgendwelche Grenzen setzt. Genauer gesagt leben sie in zwei Motels im Süden Floridas, die für einige Menschen, die sehr wenig Geld haben, zu einem festen, aber gefährdeten Wohnsitz geworden sind. Sie heißen Magic Kingdom und Futureland, sind in knalligen Rosa- und Lila-Tönen gestrichen und befinden sich in unmittelbarer Nachbarschaft von Disney World. Eines der Mädchen heißt Moonee (Brooklynn Prince). Ihre Mutter Halley (Bria Vinaite) ist ziemlich jung, hat türkis gefärbte Haare und große Tattoos auf den Brüsten. Mit den Anforderungen des Lebens geht sie rotzfrech und sehr impulsiv um. Ständig fehlt ihr das Geld für die Miete. Und das, obwohl sie sich gelegentlich prostituiert, um sich ihren Lebensunterhalt zu verdienen.
Natürlich lässt sich aus dem Leben, in das Halley, Mooneey und viele andere getrieben werden, eine vehemente Kapitalismuskritik herauslesen. Die Zuschauenden dürfen gerne auf größere Zusammenhänge abstrahieren. Aber Baker ist kein Didakt. Sein Film bleibt einfach weiter an den Figuren kleben. Einmal sitzt Halley beim Sozialamt, bekommt nicht, was sie will (es geht um ein paar Busfahrscheine), wird laut. Natürlich kann man sich darüber empören, wenn sehr arme Menschen beim Amt um Dinge betteln müssen, die sie brauchen, um ihren Alltag zu bestreiten. Aber die Empörung ist dann die des Publikums, nicht die des Films. Anders ausgedrückt: Der Film bietet den Zuschauenden, die wohl in aller Regel in anderen Verhältnissen leben als Halley, die Empörung nicht unmittelbar als dann wiederum distanzierendes Moment an. Sondern es bleibt stets klar: Das hier ist Halleys Alltag. Halleys Leben. Mitten im Streitgespräch gibt es einen abrupten Schnitt, es folgt die nächste Szene.

Aber da ist noch etwas: Bakers Figuren sind auf eine eigensinnige, schwer greifbare Art larger than life. Die Tatsache, dass seine Filme in Scope gedreht sind, lässt mich irgendwie immer daran denken, was dieses Bildformat bedeutete, als es in den 1950ern erstmals eingeführt wurde. Die breiten Bildern wollen den Figuren ein Stück von jenem Glamour zurückgeben, den ihr Dasein ihnen ansonsten so grundsätzlich verwehrt.
So klar es ist, dass das, was das Leben seiner Figuren so prekär macht, letztlich der Kapitalismus ist, so wenig interessiert sich Baker für seine Figuren als Opfer oder als Täter. Das zeigt sich etwa darin, dass Halley oft das Smartphone in der einen Hand hat und wahlweise eine Kippe oder einen Joint in der anderen. Man merkt schnell, dass das Wort "asozial" keinen Sinn ergibt, wenn es darum geht, eine Baker-Figur zu beschreiben. Dass "The Florida Project" auch immer wieder ein sehr lustiger Film ist, liegt daran, dass seine Figuren eben keine "Opfer" sind (die als solche ja viel zu oft im Kino dazu verdammt sind, einfach nur lieb zu sein, die deshalb gehörig an ihrer bösen, ausbeuterischen Umwelt leiden und schließlich zugrunde gehen) und sich deshalb auch immer wieder nach Leibeskräften daneben benehmen dürfen. In einer der schönsten Szenen des Films flüchtet Halley, impulsiv wie sie ist, aus einer Situation, die ihr nicht passt, bleibt draußen stehen, holt sich ihre blutige Binde aus dem Slip, klebt sie an eine Scheibe, streckt die Zunge raus, zeigt den Mittelfinger und schnauft von dannen.
Halleys Vermieter Bobby wird gespielt von Willem Dafoe. Ein ums andere Mal droht er ihr damit, sie samt Kind aus der Wohnung zu schmeißen. Er tut es nicht, aber er weiß, dass er die schwer erreichbare Frau damit erreicht. In "The Florida Project" geht es immer auch um die mehr oder weniger kleinen oder großen Handlungsspielräume, die der Kapitalismus den Menschen in den Positionen, die sie auszufüllen haben, lässt.
Das Ende ist besonders gebrochen und ambivalent. Zunächst holen die Verhältnisse unsere kleine Familie endgültig ein. Dann gibt es einen sehr buchstäblichen Eskapismus: die Flucht nach Disney World. Moonee, ich gönne dir das!
Nicolai Bühnemann
The Florida Project - USA 2017 - Regie: Sean Baker - Darsteller: Brooklynn Prince, Bria Vinaite, Willem Dafoe, Christopher Rivera, Aiden Malik, Valeria Cotto - Laufzeit: 111 Minuten.
---

Vermutlich war Lara Croft, die Hauptfigur der 1996 aus der Taufe gehobenen Computerspielreihe "Tomb Raider", das erste digital animierte Wesen, dessen Design in der Öffentlichkeit breit und ausführlich diskutiert wurde; und zwar so, als handele es sich nicht um eine Pixelwolke, sondern um einen realen Menschen. Das betraf vor allem Laras Figur (Atombusen, Wespentaille) sowie ihre knappen Shorts und das enge Oberteil, jedoch auch die Pistolen, die die agile Archäologin durch grob gerenderte 3D-Welten trug und mit Vorliebe beidhändig in Richtung Monster aller Art abfeuerte. Die 2001, beziehungsweise 2003 erschienenen ersten beiden Kinofilme legten die nun von Angelina Jolie verkörperte Hauptfigur noch in genau diesem Spannungsfeld an: Als eine Männer-, beziehungsweise vielleicht eher: Teeniejungs-Fantasie, die sich gleichzeitig an popfeministische Girl-Power-Erzählungen anschmiegte. (Und in ihrer Insistenz, dass das beides in einer einzigen Figur zusammengeht, und zwar ohne allzu großen diskursiven Aufwand, waren das letztlich noch verspätete 90er-Jahre-Filme.)
In der dritten Verfilmung, die dieses Woche ins Kino kommt, präsentiert sich Alicia Vikander - wohl auf einer Linie mit den aktuellen Tomb-Raider-Spielen - als eine runderneuerte Lara Croft: keine glamour-pornöse, weibliche Indiana Jones mehr, sondern eines jener schlanken, sportlichen, auf vergleichsweise alltagsnahe Weise hübschen Mädchen, die sich in den letzten Jahren bereits durch diverse Blockbuster gekämpft haben - wie etwa durch die "Die Tribute von Panem"- und auch die neuen "Star Wars"-Filme. Ein Kickboxing-Match, das Vikander gleich zu Beginn bestreitet, gibt die Richtung vor: Wendig und zäh ist die neue Lara Croft, aber auch verletzlich und nicht bedingungslos wagemutig - sie wird ziemlich gründlich vermöbelt; und wenn sie anschließend mit dem Fahrrad nach hause fährt, setzt sie sich einen Helm auf den Kopf. Von Feuerwaffen lässt sie gleich ganz die Finger, dafür greift sie einmal - auch das kennt man aus "Die Tribute von Panem" - zu Pfeil und Bogen.
Man kann das als Pragmatisierung beschreiben: Die Filmfigur Lara Croft lässt zwar nach wie vor sowohl begehrende als auch identifikatorische Blicke zu; was hingegen wegfällt, sind die jeweiligen exzessiven Überschreitungen dieser Blicke. Lara Croft 2018 taugt weder zum Fetischobjekt, noch als Ermächtigungsfantasie. Zumindest in diesem speziellen Fall könnte das die richtige Entscheidung sein - mit der exaltierteren, aggressiveren Sexualität der Jolie-Lara konnte das PG13-Blockbusterkino eh nicht viel anfangen, weshalb sich die beiden älteren Filmen in eher müden, und gleichzeitig fürchterlich aufgeplusterten Camp-Spielereien ergingen.

Das vom norwegischen Regisseur Roar Uthaug inszenierte "Tomb Raider"-Comeback schaltet hingegen ein paar Gänge zurück und will erst einmal nicht mehr sein als ein netter, altmodischer Abenteuerfilm. Wo die alte Lara in hektischer Beliebigkeit um die Welt jettete, unternimmt die neue eine geradlinige Heldinnenreise: Vom heimatlichen Hipsterlondon aus geht es, nach einem Schatzkartenfund, zunächst nach Hongkong, dann auf eine geheimnisvolle Insel vor der japanischen Küste, unter deren Oberfläche sich wiederum eines jener unterirdischen Verliese befindet, in denen die Pulp-Archäologen des Kinos schon so manche weltbewegende Entdeckung gemacht haben. Für die emotionale Verankerung sorgt eine Vater-Tochter-Geschichte, und einen eindrücklichen Antagonisten gibt es auch: Walton Goggins, schon seit einer Weile ein Spezialist für psychotische bad-guy-Rollen, legt mit stets weit aufgerissenen, irren Augen einen nicht allzu originellen, aber effektiven Klaus-Kinski-Gedächtnisauftritt hin.
Dass es Goggins mühelos gelingt, mit seiner one-note-Performance den Film an sich zu reißen, ist leider auch ein Zeichen dafür, dass sonst nicht viel los ist. Wenn man sich für die klassische Form entscheidet, kommt es nun einmal in erster Linie auf klassische Tugenden an, auf die Feinheiten der Inszenierung; da das Ziel der Reise von Anfang an fest steht, müssen deren einzelne Stationen umso spektakulärer in Szene gesetzt werden. Und im neuen "Tomb Raider" gibt es zwar ein paar Highlights, aber die sind few and far between: Eine Fahrradverfolgungsjagd zu Beginn ist angemessen rasant (den Helm hat Lara nicht umsonst aufgezogen), und später, in der filmisch dichtesten Szene des Films, verwandelt das auf Wasser und Muskeln reflektierende Mondlicht einen nächtlichen Nahkampf in ein düster glitzerndes Bewegungsinferno. Ansonsten hat man jedoch den Eindruck, jedes einzelne Set-Piece schon mehrmals in anderen Filmen gesehen zu haben - zumeist deutlich besser. Nur zum Beispiel ist eine ausführliche Nummer um ein rostiges Flugzeug, das über einem Wasserfall balanciert, kaum mehr als ein billiger Abklatsch einer sehr ähnlichen Nummer in Spielbergs "Jurassic Park - The Lost World".
Vor allem die eng an der Computerspielvorlage klebenden Verlies-Szenen sind denkbar uninspiriert aufgelöst. Wenn Lara einen farbigen Stein nach dem anderen in eine Maueröffnung stopft, um einen Fallen-Mechanismus zu überlisten, der ohnehin keine filmische Darstellung findet, dann weckt das höchstens Erinnerungen an eigene Gaming-Frustrationen; und man sehnt sich nach einem Regisseur wie Paul W.S. Anderson, der in Filmen wie "Alien vs Predator" oder "Resident Evil: Retribution" aus ähnlichem Material Kleinode des operationalistischen Pulp-Kinos gebastelt hat.
Lukas Foerster
Tomb Raider - USA 2018 - Regie: Roar Uthaug - Darsteller: Alicia Vikander, Dominic West, Wlaton Goggins, Daniel Wu, Kristin Scott Thomas - Laufzeit: 118 Minuten.
Kommentieren