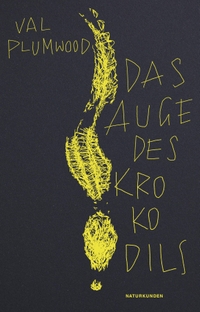Im Kino
2 x Oscar
Die Filmkolumne. Von Lukas Foerster, Ekkehard Knörer
04.02.2009. Der wohl beste aller Oscar-nominierten Filme läuft erst nächste Woche an: Wir empfehlen Götz Spielmanns "Revanche" schon heute. Was dabei herauskommt, wenn ein Film wirklich gar nichts anderes will als die kleine goldene Statue, kann man dagegen exemplarisch bei John Patrick Shanleys Meryl-Streep- und Philip-Seymour- Hoffman-Vehikel "Glaubensfrage" bewundern.Es ist Oscar-Saison und unter sich machen die beiden heute anlaufenden Filme "Glaubensfrage" und "Frost/Nixon" nicht weniger als zehn Oscar-Nominierungen aus. Wie sehr man das Oscar-Kalkül einem Film ansehen kann und wie sehr es ihm schadet, erklärt Lukas Foerster exemplarisch an John Patrick Shanleys Meryl-Streep-Vehikel "Glaubensfrage". Da in der nächsten Woche diese Kolumne berlinalebedingt ausfällt und da Ron Howards "Frost/Nixon" nichts weiter ist, als der sich liberal gebende, in Wahrheit reaktionäre Versuch, Politisches auf Persönliches zu reduzieren und die dabei anfallende Mythisierung Richard Nixons als Entmythisierung zu verkaufen, hier lieber der Hinweis auf Götz Spielmanns in der nächsten Woche anlaufenden, meisterhaften Film "Revanche". Auch er ist übrigens - und im Gegensatz zu "Doubt" und "Frost/Nixon" durchaus überraschenderweise - für den Oscar nominiert, in der Auslands-Kategorie.
***

"Revanche" beginnt mit dem Blick auf einen See im Wald. Der See ruht still. Dann wird etwas ins Wasser geworfen, von irgendwo, Wellen breiten sich aus. Das ist der Vorspann, der auch eine Vordeutung ist auf das, was sehr viel später, gegen Ende des Films, geschehen wird. Was nach dem Vorspann geschieht, schließt daran erst einmal nicht an. Wir sind in der Stadt, im Rotlichtmilieu. Da sind Alex (Johannes Krisch) und Tamara (Irina Potapenko). Sie ist Prostituierte, er ist einem schmierigen Zuhälter zu Diensten. Die beiden lieben einander und wollen raus aus dem Milieu. Die Klischees, die in dieser Konstellation stecken, komprimiert Götz Spielmann in weder zu künstliche noch zu naturalistische Dialoge und in millimetergenau komponierte Bilder. Man spürt von Anfang an die Kontrolle, die er über seine Geschichte hat.
Zweimal tut im ersten Drittel des Films die Kamera etwas gänzlich Unerwartetes: Einmal folgt sie Alex in seinem Auto auf einer Waldstraße. Wo er aber abbiegt, fährt sie geradeaus weiter und verharrt dann auf einem Kruzifix am Wegesrand. Das andere Mal beobachtet sie Alex beim Ausbaldowern einer Bank, folgt ihm auf die Straße und hält dann inne. Alex verschwindet nach rechts aus dem Bild, was man sieht, ist eine unscheinbare, hohle Gasse, in der nichts geschieht. Es sind Momente der Irritation. Man weiß, wie beim See des Beginns, nicht, was es zu bedeuten hat, aber man begreift: Hier ist was im Gange.
Man könnte sagen: Götz Spielmann spielt mit seinen Figuren und er spielt mit uns als Betrachter. Man könnte denken: Die Kontrolle, die er als Drehbuchautor und Regisseur hat, spielt er gekonnt aus. Die Irriationen - der See, das Kreuz, die Gasse - werden sich als Prophezeiungen erweisen, die Geschichte kommt auf diese Orte zurück. Und zwar so: Alex und Tamara wollen sich aus dem Milieu befreien. Alex überfällt eine Bank, Tamara wartet im Auto. Der Plan ist gut, nichts kann schiefgehen. Natürlich geht etwas schief. Die Gasse, die zuvor leer war, ohne Bedeutung schien, wird nun zum Schauplatz eines Dramas, das am Kruzifix ein vorläufiges Ende nimmt. Die Prophezeihung, die sich im Rückblick erst als solche erweist, hat sich erfüllt.
Dramaturgisch ist das ein Verfahren, das nicht nur Irriatation, sondern auch Spannung erzeugt. Rhetorisch gesprochen handelt es sich beim Spiel, das der Regisseur mit seinen Figuren treibt, um dramatische Ironie. Sie wissen weniger als der Erzähler der Geschichte weiß - und er stellt diesen Wissensvorsprung so aus, dass auch der Zuschauer an den Punkt kommt, an dem er zum einen diesen Wissensvorsprung einholt und zum anderen begreift, welche Signale der Film ihm zuvor schon gegeben hat. Deshalb hat die rhetorische Figur der dramatischen Ironie ihre sozusagen tragödientheoretische Pointe: Götz Spielmann inszeniert eine Tragödie, lässt aber an Stelle des unsichtbar bleibenden blinden Schicksals eine andere, spürbare Instanz walten: die des Erzählers, des Regisseurs, der die Zufälle und Wendepunkte des Dramas von Anfang an kennt.
Bliebe es dabei, wäre "Revanche" in erster Linie eines: raffiniert und brillant kalkuliert, eine Experimentalanordnung, die aufgeht. Noch lange aber ist der Film hier nicht aus. Alex verlässt die Stadt, zieht aufs Dorf zu seinem Großvater. Dort lernt er eine Frau kennen, mit der er sich in eine komplexe Beziehung verstrickt. Der Film nimmt also einen neuen Anlauf, oder vielmehr: gerade nicht. Die Geschichte, die gerade dramatisch kulminiert ist, gewinnt keinen neuen Schwung, sondern trudelt aufs Interessanteste aus. Und nimmt doch einen neuen Anfang, auf niedrigerem Energieniveau, nimmt eine unerwartete Richtung, dem See des Vorspanns entgegen, und doch wie von der Vorausdeutung befreit. Vom Titel her spannt sich auch darüber noch der große Bogen der dramatischen Ironie als offene Frage: Wird Alex, wie er sich's vornimmt, Rache nehmen an dem Mann, der am Scheitern seines Traums Schuld trägt? Wird, auf der Meta-Ebene gefragt, der Titel des Films wörtlich zu begreifen sein - oder selbst ironisch? Oder kann es gar gelingen, zwischen beidem die Balance zu halten?

In der hoch interessanten und von derartigen Spannungen brillant durchzogenen Auflösung seiner Geschichte zeigt sich Götz Spielman als Meister. Keineswegs verliert er die Kontrolle über die Fäden, die er von Anfang an zieht. Je länger der Film dauert, desto mehr Bewegungsfreiheit gewährt er jedoch seinen Figuren. Er erzählt nicht mehr über ihre Köpfe hinweg, begibt sich auf Augenhöhe mit ihnen, lässt ihnen ihren Willen. Ihr Treiben wird unabsehbar, Abzweigungen tun sich auf. "Revanche" beginnt sich, im zweiten, vom ersten so ganz unterschiedenen Teil, einzulassen: auf den Ort, die idyllische Landschaft und die Charaktere, die viel Zeit bekommen, sich einander zu näheren, und sei es gegen den eigenen Willen. Wenn am Ende der See ruht und dann aufgerührt wird und dann wieder ruht, wird das Drama, das der Film zwischen Aufruhr und Aufruhr erzählt, keineswegs vorauszusehen gewesen sein.
Ekkehard Knörer
***

"Oscar bait" heißen solche Filme in den USA. Sie definieren sich über die Gravitas ihres Sujets und die Gesichtsverrenkungen (sprich: "method acting") ihrer Hauptdarsteller. Primärziel ist kulturelles Kapital in Gestalt einer vergoldeten, 34,3 cm hohen Statue, die erst hinterher, im zweiten Schritt, via DVD-Auswertung etc., in traditionell ökonomisches Kapital umgewandelt wird. Die meisten dieser Filme sind schrecklich öde. Im Fall von "Glaubensfrage" beschert der Themenkomplex Kindesmißbrauch / Katholizismus die Gravitas, für die Gesichtsverrenkungen sind Meryl Streep und Philip Seymour Hoffman zuständig, die auch just beide Oscarnomminierungen einheimsen konnten. Und das Ergebnis ist diesmal ganz besonders öde.
Einige Probleme des Films mögen damit zusammenhängen, dass es sich bei "Glaubensfrage" um die Verfilmung eines Theaterstücks handelt und dass dann auch noch ausgerechnet der Autor dieses Stücks für die Adaption verantwortlich ist. In der Tat bestätigt John Patrick Shanleys hölzerner Streifen alle Vorurteile, die gegen Theaterverfilmungen noch im Umlauf sein mögen. Das Problem ist dabei nicht, dass die Bühnenvorlage in den Film als mediale Differenz hinein ragt. Sondern, dass sie dies auf so uninteressante Art und Weise tut, nämlich in Form uninspirierter Schauspielerduelle an den ewig gleichen Schauplätzen und einer plumpen Zeichenlogik, die auf die natürliche Beschränkungen der Bühnenkulisse verweist. Auf der Bühne kann ein ökonomischer Einsatz von Requisiten produktiv sein, wenn im Film aber immer wieder während emotionaler Streitgespräche dieselbe Glühbirne durchbrennt (und wenn sich der Film dabei voll und ganz ernst nimmt), wird es schnell lächerlich.
Meryl Streep gibt Aloysius Beauvier, eine sittenstrenge Nonne vom Typus Hausmütterchen. Die Haube, die sie auf dem Kopf trägt, betont, im Verbund mit der passenden Beleuchtung, die wahrscheinlich bald wieder oscarreifen Gesichtszüge. Philip Seymour Hoffman gibt, weniger bemüht und darum angenehmer, Pater Flynn, einen nicht sonderlich sittenstrengen Priester, der auch mal mit seinen Priesterkumpels einen über den Durst trinkt und die Schule, an der beide unterrichten, modernisieren möchte. Beauvier kann Flynn nicht leiden. Schwester James teilt ihr eines Tages mit, dass Flynn sich für ihren Geschmack etwas zu sehr um Donald Miller, den ersten afroamerikanischen Schüler an der Institution, kümmert. Aber: stimmt das? Der Film beantwortet diese Frage nicht und ist mächtig stolz darauf, dass er es nicht tut.

Der einen narrativen Schließung verweigert sich der Film programmatisch, ostentativ und plump. Dafür rächt er sich, indem er alles andere so überdeutlich ausformuliert, wie man es auch im deutschen Vorabendfernsehprogramm nicht platter hinbekommt. Das betrifft vor allem sein Thema: "Glaubensfrage" will ein Film über den Zweifel sein, genau so lautet bereits der vom Bühnenstück übernommene Originaltitel: "Doubt". Damit der Zuschauer diesen Titel nicht vergisst, beginnt der Film dann gleich mit einer Predigt Flynns über den Zweifel. Und weil der Film beim Zuschauer kein Kurzzeitgedächtnis und auch sonst wenig voraussetzt, reden die Figuren auch danach wenigstens alle fünf Minuten von ihren Zweifeln.
Freilich fängt der Film mit seinem Thema nicht mehr an, als es immer und immer wieder zu behaupten. Die Ambiguität, die ihm eigentlich schon begrifflich anhaftet, wird dem Zweifel in diesen Behauptungen gründlich ausgetrieben. Gnadenlos wird er vergegenständlicht und literalisiert: Schon im Gitarrentremolo über der ersten Einstellung, später gerne durch Herbstblätter, die der Wind den Zweiflern zwischen die Füße pustet. Wird der Zweifel dann akuter, kippt die Kamera und das Bild steht plötzlich schief. Und wenn es ganz schlimm kommt, fängt es an zu blitzen und zu donnern. Kein Zweifel: Es herrscht Zweifel.
Auch mit Ort und Zeit springt der Film nicht viel sorgsamer um. Ort ist die Bronx. Dem Film ist die Bronx der rotbraune Backstein ihrer Häuser, sonst nichts. Zeit ist 1964. Dem Film sind die 1960er "Kennedy" und "civil rights". Freilich nur in Anführungszeichen, als Schlagworte, die immer mal wieder in den Raum gestellt werden und dafür entschädigen sollen, dass "Glaubensfrage" nicht einmal handwerklich ordentliches Pastiche abliefert.
Lukas Foerster
Revanche. Österreich 2008 - Regie: Götz Spielmann - Darsteller: Johannes Krisch, Irina Potapenko, Ursula Strauss, Andreas Lust, Hannes Thanheiser, Hanno Pöschl, Toni Slama, Magdalena Kropiunig, Rainer Gradischnig
Glaubensfrage. USA 2008 - Originaltitel: Doubt - Regie: John Patrick Shanley - Darsteller: Meryl Streep, Philip Seymour Hoffman, Amy Adams, Viola Davis, Joseph Foster II, Alice Drummond, Audrie J. Neenan, Susan Blommaert
***

"Revanche" beginnt mit dem Blick auf einen See im Wald. Der See ruht still. Dann wird etwas ins Wasser geworfen, von irgendwo, Wellen breiten sich aus. Das ist der Vorspann, der auch eine Vordeutung ist auf das, was sehr viel später, gegen Ende des Films, geschehen wird. Was nach dem Vorspann geschieht, schließt daran erst einmal nicht an. Wir sind in der Stadt, im Rotlichtmilieu. Da sind Alex (Johannes Krisch) und Tamara (Irina Potapenko). Sie ist Prostituierte, er ist einem schmierigen Zuhälter zu Diensten. Die beiden lieben einander und wollen raus aus dem Milieu. Die Klischees, die in dieser Konstellation stecken, komprimiert Götz Spielmann in weder zu künstliche noch zu naturalistische Dialoge und in millimetergenau komponierte Bilder. Man spürt von Anfang an die Kontrolle, die er über seine Geschichte hat.
Zweimal tut im ersten Drittel des Films die Kamera etwas gänzlich Unerwartetes: Einmal folgt sie Alex in seinem Auto auf einer Waldstraße. Wo er aber abbiegt, fährt sie geradeaus weiter und verharrt dann auf einem Kruzifix am Wegesrand. Das andere Mal beobachtet sie Alex beim Ausbaldowern einer Bank, folgt ihm auf die Straße und hält dann inne. Alex verschwindet nach rechts aus dem Bild, was man sieht, ist eine unscheinbare, hohle Gasse, in der nichts geschieht. Es sind Momente der Irritation. Man weiß, wie beim See des Beginns, nicht, was es zu bedeuten hat, aber man begreift: Hier ist was im Gange.
Man könnte sagen: Götz Spielmann spielt mit seinen Figuren und er spielt mit uns als Betrachter. Man könnte denken: Die Kontrolle, die er als Drehbuchautor und Regisseur hat, spielt er gekonnt aus. Die Irriationen - der See, das Kreuz, die Gasse - werden sich als Prophezeiungen erweisen, die Geschichte kommt auf diese Orte zurück. Und zwar so: Alex und Tamara wollen sich aus dem Milieu befreien. Alex überfällt eine Bank, Tamara wartet im Auto. Der Plan ist gut, nichts kann schiefgehen. Natürlich geht etwas schief. Die Gasse, die zuvor leer war, ohne Bedeutung schien, wird nun zum Schauplatz eines Dramas, das am Kruzifix ein vorläufiges Ende nimmt. Die Prophezeihung, die sich im Rückblick erst als solche erweist, hat sich erfüllt.
Dramaturgisch ist das ein Verfahren, das nicht nur Irriatation, sondern auch Spannung erzeugt. Rhetorisch gesprochen handelt es sich beim Spiel, das der Regisseur mit seinen Figuren treibt, um dramatische Ironie. Sie wissen weniger als der Erzähler der Geschichte weiß - und er stellt diesen Wissensvorsprung so aus, dass auch der Zuschauer an den Punkt kommt, an dem er zum einen diesen Wissensvorsprung einholt und zum anderen begreift, welche Signale der Film ihm zuvor schon gegeben hat. Deshalb hat die rhetorische Figur der dramatischen Ironie ihre sozusagen tragödientheoretische Pointe: Götz Spielmann inszeniert eine Tragödie, lässt aber an Stelle des unsichtbar bleibenden blinden Schicksals eine andere, spürbare Instanz walten: die des Erzählers, des Regisseurs, der die Zufälle und Wendepunkte des Dramas von Anfang an kennt.
Bliebe es dabei, wäre "Revanche" in erster Linie eines: raffiniert und brillant kalkuliert, eine Experimentalanordnung, die aufgeht. Noch lange aber ist der Film hier nicht aus. Alex verlässt die Stadt, zieht aufs Dorf zu seinem Großvater. Dort lernt er eine Frau kennen, mit der er sich in eine komplexe Beziehung verstrickt. Der Film nimmt also einen neuen Anlauf, oder vielmehr: gerade nicht. Die Geschichte, die gerade dramatisch kulminiert ist, gewinnt keinen neuen Schwung, sondern trudelt aufs Interessanteste aus. Und nimmt doch einen neuen Anfang, auf niedrigerem Energieniveau, nimmt eine unerwartete Richtung, dem See des Vorspanns entgegen, und doch wie von der Vorausdeutung befreit. Vom Titel her spannt sich auch darüber noch der große Bogen der dramatischen Ironie als offene Frage: Wird Alex, wie er sich's vornimmt, Rache nehmen an dem Mann, der am Scheitern seines Traums Schuld trägt? Wird, auf der Meta-Ebene gefragt, der Titel des Films wörtlich zu begreifen sein - oder selbst ironisch? Oder kann es gar gelingen, zwischen beidem die Balance zu halten?

In der hoch interessanten und von derartigen Spannungen brillant durchzogenen Auflösung seiner Geschichte zeigt sich Götz Spielman als Meister. Keineswegs verliert er die Kontrolle über die Fäden, die er von Anfang an zieht. Je länger der Film dauert, desto mehr Bewegungsfreiheit gewährt er jedoch seinen Figuren. Er erzählt nicht mehr über ihre Köpfe hinweg, begibt sich auf Augenhöhe mit ihnen, lässt ihnen ihren Willen. Ihr Treiben wird unabsehbar, Abzweigungen tun sich auf. "Revanche" beginnt sich, im zweiten, vom ersten so ganz unterschiedenen Teil, einzulassen: auf den Ort, die idyllische Landschaft und die Charaktere, die viel Zeit bekommen, sich einander zu näheren, und sei es gegen den eigenen Willen. Wenn am Ende der See ruht und dann aufgerührt wird und dann wieder ruht, wird das Drama, das der Film zwischen Aufruhr und Aufruhr erzählt, keineswegs vorauszusehen gewesen sein.
Ekkehard Knörer
***

"Oscar bait" heißen solche Filme in den USA. Sie definieren sich über die Gravitas ihres Sujets und die Gesichtsverrenkungen (sprich: "method acting") ihrer Hauptdarsteller. Primärziel ist kulturelles Kapital in Gestalt einer vergoldeten, 34,3 cm hohen Statue, die erst hinterher, im zweiten Schritt, via DVD-Auswertung etc., in traditionell ökonomisches Kapital umgewandelt wird. Die meisten dieser Filme sind schrecklich öde. Im Fall von "Glaubensfrage" beschert der Themenkomplex Kindesmißbrauch / Katholizismus die Gravitas, für die Gesichtsverrenkungen sind Meryl Streep und Philip Seymour Hoffman zuständig, die auch just beide Oscarnomminierungen einheimsen konnten. Und das Ergebnis ist diesmal ganz besonders öde.
Einige Probleme des Films mögen damit zusammenhängen, dass es sich bei "Glaubensfrage" um die Verfilmung eines Theaterstücks handelt und dass dann auch noch ausgerechnet der Autor dieses Stücks für die Adaption verantwortlich ist. In der Tat bestätigt John Patrick Shanleys hölzerner Streifen alle Vorurteile, die gegen Theaterverfilmungen noch im Umlauf sein mögen. Das Problem ist dabei nicht, dass die Bühnenvorlage in den Film als mediale Differenz hinein ragt. Sondern, dass sie dies auf so uninteressante Art und Weise tut, nämlich in Form uninspirierter Schauspielerduelle an den ewig gleichen Schauplätzen und einer plumpen Zeichenlogik, die auf die natürliche Beschränkungen der Bühnenkulisse verweist. Auf der Bühne kann ein ökonomischer Einsatz von Requisiten produktiv sein, wenn im Film aber immer wieder während emotionaler Streitgespräche dieselbe Glühbirne durchbrennt (und wenn sich der Film dabei voll und ganz ernst nimmt), wird es schnell lächerlich.
Meryl Streep gibt Aloysius Beauvier, eine sittenstrenge Nonne vom Typus Hausmütterchen. Die Haube, die sie auf dem Kopf trägt, betont, im Verbund mit der passenden Beleuchtung, die wahrscheinlich bald wieder oscarreifen Gesichtszüge. Philip Seymour Hoffman gibt, weniger bemüht und darum angenehmer, Pater Flynn, einen nicht sonderlich sittenstrengen Priester, der auch mal mit seinen Priesterkumpels einen über den Durst trinkt und die Schule, an der beide unterrichten, modernisieren möchte. Beauvier kann Flynn nicht leiden. Schwester James teilt ihr eines Tages mit, dass Flynn sich für ihren Geschmack etwas zu sehr um Donald Miller, den ersten afroamerikanischen Schüler an der Institution, kümmert. Aber: stimmt das? Der Film beantwortet diese Frage nicht und ist mächtig stolz darauf, dass er es nicht tut.

Der einen narrativen Schließung verweigert sich der Film programmatisch, ostentativ und plump. Dafür rächt er sich, indem er alles andere so überdeutlich ausformuliert, wie man es auch im deutschen Vorabendfernsehprogramm nicht platter hinbekommt. Das betrifft vor allem sein Thema: "Glaubensfrage" will ein Film über den Zweifel sein, genau so lautet bereits der vom Bühnenstück übernommene Originaltitel: "Doubt". Damit der Zuschauer diesen Titel nicht vergisst, beginnt der Film dann gleich mit einer Predigt Flynns über den Zweifel. Und weil der Film beim Zuschauer kein Kurzzeitgedächtnis und auch sonst wenig voraussetzt, reden die Figuren auch danach wenigstens alle fünf Minuten von ihren Zweifeln.
Freilich fängt der Film mit seinem Thema nicht mehr an, als es immer und immer wieder zu behaupten. Die Ambiguität, die ihm eigentlich schon begrifflich anhaftet, wird dem Zweifel in diesen Behauptungen gründlich ausgetrieben. Gnadenlos wird er vergegenständlicht und literalisiert: Schon im Gitarrentremolo über der ersten Einstellung, später gerne durch Herbstblätter, die der Wind den Zweiflern zwischen die Füße pustet. Wird der Zweifel dann akuter, kippt die Kamera und das Bild steht plötzlich schief. Und wenn es ganz schlimm kommt, fängt es an zu blitzen und zu donnern. Kein Zweifel: Es herrscht Zweifel.
Auch mit Ort und Zeit springt der Film nicht viel sorgsamer um. Ort ist die Bronx. Dem Film ist die Bronx der rotbraune Backstein ihrer Häuser, sonst nichts. Zeit ist 1964. Dem Film sind die 1960er "Kennedy" und "civil rights". Freilich nur in Anführungszeichen, als Schlagworte, die immer mal wieder in den Raum gestellt werden und dafür entschädigen sollen, dass "Glaubensfrage" nicht einmal handwerklich ordentliches Pastiche abliefert.
Lukas Foerster
Revanche. Österreich 2008 - Regie: Götz Spielmann - Darsteller: Johannes Krisch, Irina Potapenko, Ursula Strauss, Andreas Lust, Hannes Thanheiser, Hanno Pöschl, Toni Slama, Magdalena Kropiunig, Rainer Gradischnig
Glaubensfrage. USA 2008 - Originaltitel: Doubt - Regie: John Patrick Shanley - Darsteller: Meryl Streep, Philip Seymour Hoffman, Amy Adams, Viola Davis, Joseph Foster II, Alice Drummond, Audrie J. Neenan, Susan Blommaert
Kommentieren