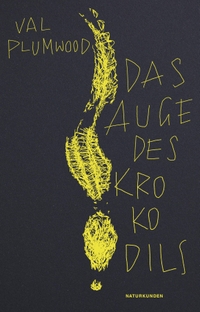Im Kino
Protein-Athener
Die Filmkolumne. Von Lukas Foerster, Thomas Groh
06.03.2014. Das P.T.-Travers-Biopic "Saving Mr. Banks" von John Lee Hancock mit Emma Thompson als "Mary Poppins"-Autorin ist eine faszinierende Selbstbeschreibung der Traumfabriken Hollywoods. Einen Fetischfilm schwärzesten Wassers hat Noam Murro mit "300: Rise of an Empire" abgeliefert.
Es beginnt, schon da ganz klassisch, mit zwei parallel geschalteten Reisen. Zum einen wird die Schriftstellerin P.L. Travers (Emma Thompson, der man die verhärmte Professionalität zu Beginn weitaus eher abkauft als den finalen emotionalen payoff), Autorin der weltweit bestsellenden "Mary Poppins"-Romane, von ihrem Londoner Wohnsitz weg nach Los Angeles gelockt, wo sich Walt Disney schon seit Jahrzehnten um die Filmrechte für ihre Schöpfung bemüht. Zum anderen unternimmt dieselbe Frau fast sechzig Jahre früher, im Jahr 1906, eine Reise ins australische Outback. Sieben Jahre ist sie da erst alt (und wird in diesen von Sonnenfluten und Graswogen dominierten Rückblenden von Annie Rose Buckley gespielt, deren stille Präsenz durchaus eine Wohltat ist in diesem manchmal etwas aufdringlich ausverbalisierten Film), ihre Familie zieht hinaus in die Einsamkeit; dort, in Allora, Queensland, verfällt der Vater (Colin Farrell mit adrett ungebändigten Stirnlocken) mehr und mehr dem Alkohol, aber die Tochter entfremdet sich nicht von ihm, sondern von ihrer hilflosen, überforderten Mutter.
Nicht mehr allzu oft gelangen Filme in die Kinos, die so unbedingt von ihrer Erzählung her gedacht sind wie "Saving Mr. Banks" es ist; genauer gesagt ist der Film von seinen Erzählbögen her gedacht, von den beiden großen Bögen hauptsächlich, die natürlich nur zu Beginn voneinander streng sich abheben, die dann immer enger miteinander verknüpft werden, bis die ältere, australische Vergangenheit irgendwann zu einem integralen Teil der jüngeren, amerikanischen Vergangenheit geworden ist: als deren Interpretant, als ein jederzeit problemlos zur Verfügung stehendes Bilder-, Erfahrungs- und Innerlichkeitsreservoir, das die sorgfältig gestreuten Irritationen dieses gerade in Details fein gewebten Films nach und nach auflöst; denn "Saving Mr. Banks" ist auch in dem Sinne ein hypernarrativer Film, als dass er die Alltagswelt nicht als neutralen background, als Kulisse nimmt, sondern (auf fast aggressive Weise) in die Erzählmaschinerie hineinholt: Birnen, Sonnenschein, die Farbe Rot, Taxifahrer, aus allem sprechen Traumata, Erinnerungen, Verstrickungen.
Und schließlich stellt der Film neben seine beiden in der Realgeschichte verankerte Zeitebenen zwei fiktionale Weltschöpfungen: Travers' Romane um die nanny from heaven, sowie deren berühmteste Adaption, die im Jahr 1964 in den Disney-Studios entstand und gegen deren musikalisch-humoristische Schlagseite (hier, zur Erinnerung, die berühmte Pinguinszene) sich die Autorin erst zur Wehr zu setzen versucht hatte. Die Parallelisierungen bleiben meist implizit, nicht jedoch im Titel: Der zu rettende Mr. Banks ist zunächst eine Roman- und Filmfigur; er wird dann überblendet mit Travers' australischem Alkoholiker-und-Träumer-Vater - und schließlich sogar noch mit Walt Disneys Vater Elias.

"Mr. Banks" ist dabei kein postmoderner Film; er stellt die diversen biografischen und popkulturellen Fragmente, die er verhandelt, nicht als Oberflächeneffekte nebeneinander, sondern er ordnet und hierarchisiert sie. Und zwar hierarchisiert er sie, wenig überraschend, aus der Perspektive des Konzerns: Der Disney-"Mary Poppins"-Film überschreibt erfolgreich die literarische Vorlage, und erst in ihm wird auch das biografische Trauma der Autorin aufgehoben (die, das ist eine weitere Ebene, die Australierin in sich zugunsten eines überkultivierten europäischen alter ego verdrängt). Der Konzernchef schließlich wird zu jener Vaterfigur, die Travers' leiblicher Vater nie sein konnte: Auch Walt Disney ist ein Träumer, allerdings einer, der seine Träume zu einem kulturindustriellen Imperium verfestigen konnte (toll die symmetrisch gebauten Einstellungen, die den wundervoll stoischen Hanks vor regelrechten Arsenalen von Plastik-Merchandise zeigen; schwer zu entscheiden, ob man da einen grenzpsychotischen Melancholiker vor sich hat, oder einen Feldherrn) - und der sich trotzdem noch von einem einzigen, gelungenen Musikstück gefangen nehmen lassen kann.
Und eine Theorie des eigenen Erfolges liefert der Film gleich auch noch mit. Die Welten zumindest der klassischen Disney-Ära haben, legt "Saving Mr. Banks" nahe, und ganz falsch ist das wahrscheinlich nicht, wenig gemeinsam mit jenen fiktionalen Großprojekten, die in den letzten zwei Jahrzehnten die Kino-Leinwände in Beschlag genommen haben, wenig mit den synthetischen Epen Tolkiens oder mit den synthetischen Märchen J.K. Rowlings, noch weniger mit dem "Marvel-Universum"oder auch mit der demnächst wieder aktivierten "Star Wars"-Saga. Wo diese narrativen Mammutprojekte zur Selbstabschließung tendieren, zur nur noch internen Ausdifferenzierung in immer neue sequels, spinoffs und reboots, war die Welt des klassischen Disney-Kinos architektonisch simpel gebaut - aber dafür maximal durchlässig auf biografische Erfahrungsdimensionen. Der neue Marvel-Film hat seine primäre Referenz im Marvel-Universum, die klassischen Disney-Cartoons hatten die ihren in den nur auf den ersten Blick schlichten Annahmen der Disney-Autoren und -Produzenten über die menschliche Psyche.
Andererseits: Marvel und "Star Wars" sind inzwischen ebenfalls von Disney aufgekauft worden. Überhaupt muss man darauf hinweisen, dass "Saving Mr. Banks" zwar eine faszinierende Selbstbeschreibung der Traumfabrik Hollywood darstellt (eine weitaus interessantere Selbstbeschreibung auch als zuletzt in "The Artist" und "Argo", beide im Gegensatz zu "Saving Mr. Banks" oscarprämiert); dass aber selbstverständlich auch in dieser Selbstbeschreibung die blinden Flecken nicht nur akzidentiell sind. Und zwar lügt John Lee Hancocks Film vor allem da, wo er einen Konzern, der in den 1960ern längst im Weltmaßstab operierte, als ein überschaubar dimensioniertes, familiär organisiertes Familienunternehmen darstellt - man kommt sich vor wie in einer provinzielleren Filliale der Sterling Cooper-Agentur aus "Mad Men". Das ist umso perfider, als "Saving Mr. Banks" schon qua eigener Existenz beweist, dass sich Disney auch bald fünf Dekaden nach dem Tod seines Gründers wunderbar auf das versteht, was von Anfang an das zentrale Geschäftsmodell war: auf repurposing content, also auf das Neu-, Um- und Weiterschreiben eigentlich längst sattsam bekannter Geschichten. Der finale Clou: Am Ende hat der Konzern nicht nur Travers' literarische Erfindung, sondern noch gleich ihre höchstpersönliche Biografie in Firmenkapital umgewandelt.
Lukas Foerster
Saving Mr. Banks - USA, Australien 2013 - Regie: John Lee Hancock - Darsteller: Emma Thompson, Tom Hanks, Annie Rose Buckley, Colin Farrell, Ruth Wilson, Paul Giamatti, Bradley Whitford, B.J. Novak, Jason Schwartzman - Laufzeit: 125 Minuten.
---

Zack Snyders "300", die Verfilmung der gleichnamigen Comicvorlage des um so politisch unkorrekte, wie nervige Kernigkeiten nie verlegenen Rechtsaußen Frank Miller, war eine groß angelegte Peinlichkeit des Kinojahres 2007: Markig im Ton, künstlich im Bild, virtuell das Geschlachte, Geschwafel und Gebrülle. Ein bleiernes Filmerlebnis, das sich zudem noch vom Vorwurf, gleichermaßen xeno- wie homophob zu sein, trotz allen mit übergroßen Strichen gepinselten Überzeichnungen und Verschiebungen ins Camp-hafte, nie so wirklich reinzuwaschen vermochte. Schlimmer noch: In der Zuspitzung seines Kriegspathos, seiner eisernen Reden, seiner digital verplompten Welt wirkte der Film so lustfeindlich, gehemmt in seinen Vektoren des Begehrens, dass der Rezeptionsvorschlag des Films selbst, seine ausgebreiteten Transgressionen wenigstens als Tabubruch lustvoll mitzugehen, abperlte. Ein Lust vergrätzendes Ärgernis, eine gülden-bronzene Albernheit.
Ob es nun also am neuen Regisseur liegt, dass "300: Rise of an Empire" seinen Vorgänger zwar nicht verleugnen kann, aber doch ein wuchtiger Blockbuster im besten Sinn geworden ist? Zack Snyder jedenfalls produzierte das nun vorliegende Sequel "300: Rise of an Empire" lediglich als einer von vielen mit, auch Frank Millers Vorlage "Xerxes" ist noch gar nicht abgeschlossen, geschweige denn veröffentlicht (und alles, was darüber zu lesen ist, klingt nicht so, als hätte es viel mit dem Film zu tun). Stattdessen sitzt mit Noam Murro ein ziemlich unbeschriebenes Blatt auf dem Regiestuhl. Lediglich eine Romantic Comedy, "Smart People", hat er vorzuweisen. Oder liegt es nur an der zwischenzeitlich nochmal deutlich avancierteren Technik, dass dem schon jetzt jämmerlich veralteten, texturarmen Vorläufer nun ein Sequel zur Seite steht, das den bei Snyder ins digital-unverbindliche geschobenen Körper wieder in seiner ganzen Kraft, Agilität und vor allem Verletztlichkeit ins Bild setzt?
Vielleicht liegt es auch einfach nur daran, dass "300: Rise of an Empire" mit einer im Blockbusterkino selten geahnten, enthemmten Lust seinen Erregungs- und Affektpotenzialen freien Lauf lässt. Zum Vorteil gereicht es, dass die golden schimmernde Patina aus Teil 1 einer profunden, weihevollen Schwärze weicht, dass der Film über weite Strecken auf einem toll stürmischen Meer spielt und der alberne Monstertand aus Snyders "300" beinahe konsequent ignoriert wird: "300: Rise of an Empire" ist ein Fetischfilm reinsten - oder besser: schwärzesten - Wassers, der eine Lust an allem entwickelt, was körperlich ist und was auf den Körper einwirkt, was ihn fesselt, freisetzt, verstümmelt, zum Bluten und zum Beben bringt; nicht zuletzt den Körper des Zuschauers, der sich - eine entsprechende Soundanlage im Saal vorausgesetzt - inmitten einer stählern dröhnenden Höllenwelt hoch zu Wasser wiederfindet.

War "300" noch der Versuch, eine Geschichte von Soldatenmut zu erzählen, erzählt "300: Rise of an Empire" nur noch nebenbei. Seiner ästhetischen Programmatik ordnet er alles unter: Alles ist Exzess, alles Spielmaterial - Raum, Zeit, Körper, Ding und Wucht, Bewegung. Was in "300" an erotischem Begehren noch albern übergepfropft wirkte, erfährt Konkretion: In jedes Bild schießt ein ekstatischer Überschuss, geradezu gefräßig ist dieser Film, wie er alles einer sehr dunklen Form des Begehrens unterordnet. "Die Ekstase von Stahl und Fleisch" benennt ein Dialog es einmal konkret. Dem folgt eine schön ruppige Sexszene, die zugleich den Nukleus des Films bildet, seinen Mittelpunkt und seine Achse, in der das erotische Spiel nur eine Waffe innerhalb einer militärischen Auseinandersetzung mit schwerstem Gerät darstellt. Und Eva Green, die selten so schön war wie in diesem Film, führt das Regiment in dieser Auseinandersetzung noch dort, wo sie sich dem Schein nach unterwirft. Aus Königen macht sie Götter und Könige bringt sie zu Fall. Den Phallus hält am Ende dieser Sexszene eindeutig sie in der Hand.
"300: Rise of an Empire" ist im Grunde kein Kinofilm, keine Sache der Öffentlichkeit. Eigentlich ist er der Halböffentlichkeit ästhetischer Produktionen zuzurechnen, die konkret und ungefiltert dem körperlichen Begehren entspringen: Eine intimistische Fetisch-Séance in aller Öffentlichkeit, die überwältigen, einen mit ihrer eigenen Logik des Genusses infizieren will. Entsprechend gelten eigene Regeln, die mit denen des Kinos nicht wirklich übereinstimmen. Wie sollte etwa einem Sado-Maso-Porno, in dem erwachsene Beteiligte und Zuschauer die Sache unter sich ausmachen, mit allegemeinen Kategorien und Auflagen moralischen Handelns zu begegnen sein, ohne der Gesamtanordnung im höchsten Maße Gewalt anzutun? Ähnlich verhält es sich mit "300: Rise of an Empire", der durch und durch Fantasie und Wonne am Fetisch ist: Politisch ist dieser Film rundheraus abzulehnen. Aber als überwältigender Fetischfilm macht er verdammt viel Spaß.
Das Uninteressanteste zum Schluss: Gewiss gibt es auch eine Geschichte. "300: Rise of an Empire" wird teils als Prequel, teils als Parallelhandlung des Vorgängers, teils als dessen Fortsetzung erzählt. Quasi: Die nachgelieferte Parallelmontage mit Überhang. Waren es im ersten Teil Computerspiele-Spartaner, die ihr Pixelblut ließen, geht es nun um Protein-Athener, die sich auf hoher See mit der Flotte des Xerxes aus dem fernen Persien herumschlagen müssen. Der Armada voran steht - kalblütig, sardonisch, breitbeinig, ein lüsternes Amalgam aus Eros und Thanatos - Artemisia, die den Griechen und ihren eigenen Männern ordentlich was mit auf den Weg gibt. Gespielt, wie gesagt, von Eva Green, einem dem Cine-Olymp entsprungenen Geschenk der Götter.
Thomas Groh
300: Rise of an Empire - USA 2014 - Regie: Noam Murro - Darsteller: Lena Headey, Eva Green, Rodrigo Santoro, Sullivan Stapleton, Jack O'Connell, David Wenham - Laufzeit: 102 Minuten.
1 Kommentar