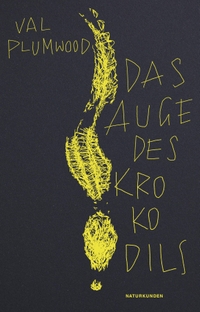Im Kino
Schuss/Gegenschuss
Die Filmkolumne. Von Ekkehard Knörer, Nikolaus Perneczky
06.10.2010. Ein stylishes Sittenbild, das um die nicht sehr ergiebige Frage kreist, ob Facebook-Gründer Mark Zuckerberg nun ein Arschloch ist oder nicht; außerdem ein Dialogfeuerwerk a la Aaron Sorkin: das ist David Finchers "The Social Network". John Hillcoat malt die Welt in seiner Cormac-McCarthy-Verfilmung "The Road" als einen Ort aus, mit dem es wirklich besser aus und vorbei wäre.
Von Null auf Hundert beschleunigt "The Social Network" in Millisekunden. Selten hatte man die Beschreibung Schuss/Gegenschuss als filmische Auflösung eines Dialogs im Schnitt von Gesicht zu Gegengesicht so wörtlich zu nehmen wie in der Szene, mit der David Finchers Film seine Beschreibung eines Kampfes eröffnet. Rede und Gegenrede peitschen über den Tisch vor dem Hintergrundlärm einer Kneipe in Cambridge, Massachusetts. Einander gegenüber sitzen hier Mark Zuckerberg und seine von hier an Ex-Freundin, die ihm am Ende des Gefechts die Worte entgegenschleudert, die mancher als moralische Summe, mancher als Ausgangspunkt für Erwägungen zur Charakterbewertung des Protagonisten nimmt: "Du wirst reich und erfolgreich sein. Aber du wirst durchs Leben gehen und glauben, die Mädchen mögen dich nicht, weil du ein Geek bist. Ich will dir von ganzem Herzen sagen, dass das nicht wahr ist. Es wird deshalb sein, weil du ein Arschloch bist."
99 Takes, war zu lesen, hat David Fincher von dieser Szene gedreht. Das ist nicht Kino, sondern Dressur. Der Dialog ist kein Dialog, sondern hochgespannte Wortakrobatik. Aaron Sorkin, der Autor, kommt vom Theater, mit dem später verfilmten "Eine Frage der Ehre" gelang ihm der Durchbruch. Dann schuf er "West Wing", die Serie um den Mitarbeiterstab, der die Entscheidungsfähigkeit des US-Präsidenten sichert und organisiert. Die Serie hatte für die zugespitzten Dialogszenen Sorkins ihre eigene Form gefunden. Die dialogisch strukturierten Debatten um die Durchsetzung der richtigen Politik und die richtige Politik der Durchsetzung wurden im "Walking and Talking" als kamerabegleitete rasende Peripatetik in den Innenräumen der Macht vor Augen geführt. (Hier als Parodie.)
Fincher verfährt anders. Man durfte sich im vorhinein wundern, was einer wie er, ein Stilist vor dem Herrn, mit den zugespitzten und jede Sekunde nach Aufmerksamkeit verlangenden Sorkin-Dialog-Textmassen anfangen würde. Der Prolog führt vor: Fincher sucht die Unterordnung auf höchstem Niveau. Er hat, ganz anders noch als zuletzt in "Zodiac" (vom Totalausfall "Benjamin Button" auf immer zu schweigen), nicht die Zeichensuche nach Spuren historischer Wirklichkeit in Szenen und Bildern im Sinn. "The Social Network" ist zunächst einmal eines: filmische Erarbeitung von Text. Bei Sorkin ist jeder Satz stets Verdichtung. Fincher ist bemüht, den Grad der Verdichtung des Sorkin-Texts durch hoch konzentrierte und allerdings nach Möglichkeit elegante Inszenierung nicht zu unterschreiten. Auf eigene inszenatorische Mätzchen verzichtet er, setzt nur gelegentlich einen dann wortlosen eigenen Höhepunkt, etwa mit einer Ruderregatta in England. Der Widerspruch zwischen David Finchers Willen zum Stil und Sorkins Willen zur totalen Domination jeden Bilds durch das Wort verschwindet nicht, kann nicht verschwinden, bleibt aber unterschwellig, als weitgehend verleugneter. Der Endeffekt dieses Widerspruchs ergibt sich erst in der Summe des Films: Er findet zu dem, was er zeigt, keine Haltung.

So recht zu sich kommt Aaron Sorkins Dialogschlachtkunst in der Prozessform: Er braucht zwei Parteien, die verbale Auseinandersetzung als Fight Club, das Hin und Her der Positionen, die aggressive Zuspitzung in Dialogen, bis die Funken zu sprühen beginnen. Im Fall von "The Social Network" spielt ihm die Wirklichkeit sehr in die Hände. Zwei juristische Verhandlungen um Geldforderungen angeblich von Mark Zuckerberg ausgebooteter einstiger Mitstreiter strukturieren den Film. Sorkin setzt eine Gegenwart und blickt von dieser aus auf die Vorgänge der Facebook-Gründungsjahre zurück. Nicht im Ernst mit dem Blick des Juristen, sondern mit dem absichtlich diffus bleibenden Blick des Moralisten, der in rechtliche Fragen solche nach der Moral menschlichen Handelns stets so einzupflegen versteht, dass er am Ende nicht als Moralprediger dasteht.
Diese Arbeit an der eigenen Selbstvercleverung ist in der Regel erfolgreich, trägt aber einen weiteren Widerspruch in sich: Sorkin stellt Moral-Fragen, deren Relevanz er unterstellt, drückt sich aber um die Antwort. Er ist - und das gilt eigentlich grundsätzlich für seine Bücher - ein Manipulator, der die Lage der Dinge so hinzudrehen versucht, dass seine häufige Windelweichheit den Anschein des Verzichts auf Zuschauerbevormundung bekommt. Die Frage, die "The Social Network" auf diese Weise stellt und zugleich nicht stellt: Ist Mark Zuckerberg wirklich ein Arschloch? Gibt ihm der Erfolg, gibt ihm die eigene Brillanz recht? Die Reaktion der Betrachter auf diese Frage fällt, man muss nur die Kritiken lesen, extrem unterschiedlich aus. Die an sich nahe liegende Antwort "Wen kümmert’s?" verweigern Buch und Film unausdrücklich, aber entschieden. Über Facebook selbst, das Netz, die Schaffung virtueller Sozialwirklichkeiten hat der Film, und ist auch noch stolz darauf, nichts zu sagen. Er will, durchaus altmodisch und eigentlich durchaus uninteressant, das Sittenbild.
"The Social Network" ist aber, man muss es so sagen, ein Stück filmischer Alchemie: ein haltungsloser, unsympathischer, uninteressanter Film, der riesigen Spaß macht. Das hat mehr mit David Finchers als mit Aaron Sorkins Herangehensweise zu tun. Fincher nämlich ist offenkundig von dem, was er zeigt, fasziniert. Zuallererst vom Sorkinschen Textkunstwerk, a fortiori aber auch von seinen Figuren und unter diesen dann doch am allermeisten von Mark Zuckerberg. Der geht im Film wie wohl im Leben ohne jede Dämonie und stets geheimnislos über Leichen. Nur führt er im Film - und Jesse Eisenberg ist grandios darin, wie er das umsetzt - anders als im Leben die bewährte Sorkin-Schnellfeuerwaffe im Mund. Fincher stilisiert so mit Sorkins Hilfe die Streitereien einer Handvoll außerordentlich geistloser, aber natürlich schlauer Harvard-Jungs zum Königsdrama und setzt dabei intelligenterweise mit dem ihm eigenen Pathos des Stylischen (und mit der Hilfe des atemberaubend alles vor sich hertreibenden Soundtracks von Trent Reznor) immer wieder das einzige in Szene, was daran wirklich Größe besitzt: die Zahlen. In die Höhe schnellende Nutzerzahlen, immense Geldforderungen, sich überschlagende Aussichten auf Gewinn: Abermillionen, Abermilliarden.

Am nacktesten spricht dies Pathos der Zahlen der Schurke aus, den das Königsdrama natürlich braucht: Sean Parker (ebenfalls toll: Justin Timberlake), der als komplett skrupellos entworfene Napster-Gründer, der den redlichen Eduardo Saverino verdrängt. Der, ein Harvard-Kommilitone, stand Zuckerberg anfangs als Kreditgeber zur Seite, wurde dann aber auf Parkers Betreiben sehr unsanft aus dem Unternehmen befördert und ist nun einer der Kläger gegen Zuckerberg. Für ihn allerdings kann sich der Film kaum erwärmen. Nicht grundsätzlich anders sieht das mit den anderen Zuckerberg-Widersachern aus: einem geschniegelten Zwillingsbrüderpaar namens Winklevoss (2 x Arnie Hammer) aus bestem Haus, mit besten Manieren und besten Verbindungen. Auf ihrer Idee, behaupten sie, beruht eigentlich Facebook.
Sorkin und Fincher zeichnen die beiden als Streber und Witzfiguren, die aufgrund ihrer Upper-Class-Herkunft und -Privilegien gegen den Underdog Zuckerberg nur schlecht aussehen können. Das ist die Königsdrama-Falle, in die der Film wieder und wieder sehr lustvoll tappt. Er braucht die Klischees und findet über eine historische Wirklichkeit mit Fleiß nichts wirklich Aufschlussreiches heraus. Alles in allem ist "The Social Network" darum nicht mehr und nicht weniger als eine große Mythisierungs- und Aufbauschaktion, die dem Zeitgeist am ehesten in der eigenen Haltungslosigkeit nahesteht. Mark Zuckerberg hat den Film mit dem engeren Facebook-Mitarbeiter-Kreis inzwischen, ließ er verlauten, gesehen. Man darf davon ausgehen, dass er sich ausgesprochen sympathisch war. Und über den Jubel der Film-Produzenten angesichts der in Filmkreisen stolzen Summe von 23 Millionen Dollar Einspiel am Startwochenende hat er sicher gelacht und gelacht.
Ekkehard Knörer
***

Da der gebürtige Australier und Regisseur John Hillcoat nicht gern kleckert, tragen seine Filme so monolithische Titel wie "The Proposition" oder, ab dieser Woche im Kino, "The Road". Auch Hillcoats Figuren haben - bei allem Naturalismus, der ihre fettigen Haare und dreckstarrende Bekleidung aushärtet - einen Zug ins Statuarische, beinah Mythische. Da macht das Personal von "The Road", im Abspann wie in der Romanvorlage von Cormac McCarthy namenlos, nur als "Man" und "Boy" ausgewiesen, keine Ausnahme: Ein Vater (Viggo Mortensen) und sein Sohn (Kodi Smit-McPhee), die nach einer im Vagen belassenen globalen Katastrophe durch die Trümmerlandschaften der zerstörten Welt staken; wenn es sich hierbei überhaupt noch, in irgendeinem relevanten Sinn, um so etwas wie eine Welt handelt.
Hillcoat geht wirklich an die Grenzen des postapokalyptischen Genres: Die Erdoberfläche ist von Asche überzogen, nichts gedeiht, nichts wächst mehr. Sogar die Atmosphäre hat in der grauschlierigen Nicht-Welt von "The Road" ihre Lebendigkeit eingebüßt und weicht einem unheimlichen, anorganischen Knarzen und Dröhnen. Die einzige Bewegung ist die des Zerfalls, entwurzelte Bäume, die mit ohrenbetäubendem Lärm zu Boden stürzen. Auch die Menschheit hat aufgehört zu existieren, an ihre Stelle treten marodierende Horden von Kannibalen mit Redneck-Physiognomien, moderne Monster aus dem Fundus des "Texas Chainsaw Massacre", und vereinzelte Flüchtlinge, deren Lebenswillen sich dem Ende zuneigt.
Um die Originalität dieses Szenarios zu ermessen, möge man sich vergegenwärtigen, wie das Kino, von "Dawn of the Dead" über "Mad Max" bis zu "28 Days Later", das Ende der Welt herkömmlich ausmalt. Sie alle eint die Hoffnung auf etwas, das bleibt; auf den Fortbestand einer gleichgültigen und ewigen Natur, die sich nach der Katastrophe wieder aufrichtet, auf Rudimente sozialer Organisation, auf Selbstlosigkeit im Angesicht schlimmster Entbehrung. "It’s the end of the world as we know it": Selten hat jemand diese Prophezeiung so ernst genommen wie John Hillcoat oder - Ehre, wem Ehre gebührt - sein production designer Chris Kennedy. Gemeinsam haben sie einen Ort geschaffen, für den zu kämpfen sich vielleicht nicht mehr lohnt.

Ständig wird der Vater von Träumen und Erinnerungen an seine Frau (Charlize Theron) heimgesucht, die sich das Leben nahm, weil sie den Willen dazu verloren hatte. In diesen Träumen, so erklärt er selbst, manifestiert sich die Verlockung, endlich loszulassen. Wäre da nur nicht sein Sohn... Wäre da nur nicht die Figur des Sohnes (so wird es auch aus den Zuschauerrängen raunen), diese süßlich verklärte Heilsgestalt, die der radikalen Prämisse des Films den Schneid abkauft. Nach dem Tag X geboren und doch von einer Milde und Güte, die aus besseren Zeiten rührt, steht das Kind für jenen unerschütterlichen Glauben an die Kontinuität des Menschen in und mit seiner Natur, den der Film als Weltentwurf so effektiv auszutreiben vermochte.
"The Road" ist eine zweischneidige Angelegenheit: Zugleich polierter, mit konservativer Sorgfalt ausgeführter Hollywoodfilm und Kampfplatz widerstrebender Gestaltungsebenen, auf dem Ausstattung und Schauspiel, Welt und Narration, Bilder und Töne einander als unversöhnliche Feinde gegenüberstehen - da kann Hillcoats Hofmusiker Nick Cave so viele Streicher drüberschmieren, wie er will.
Nikolaus Perneczky
The Social Network. USA 2010 - Regie: David Fincher - Buch: Aaron Sorkin - Darsteller: Jesse Eisenberg, Andrew Garfield, Justin Timberlake, Brenda Song, Rashida Jones, Joseph Mazzello, Rooney Mara, Malese Jow, Armie Hammer, Max Minghella
The Road. USA 2009 - Regie: John Hillcoat - Darsteller: Viggo Mortensen, Kodi Smit-McPhee, Robert Duvall, Charlize Theron, Guy Pearce, Michael Kenneth Williams, Buddy Sosthand, Garret Dillahunt, Bob Jennings
Kommentieren