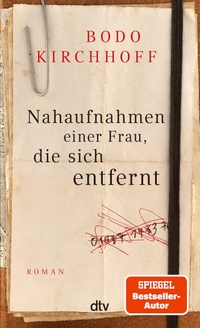Im Kino
Schwer allegorisch
Die Filmkolumne. Von Ekkehard Knörer
06.05.2009. J.J. Abrams gräbt in seinem "Star Trek"-Neustart- Versuch ein Wurmloch in die Zeit und jagt eine neue Enterprise-Rasselbande durch die unendlichen Weiten des Alls. Der Dokumentarfilm "Das Herz von Jenin" folgt der erstaunlichen wahren Geschichte einer Organspende, die viele heikle Punkte des Israel-Palästina-Konflikts berührt.
Einmal verschlägt es James T. Kirk (Chris Pine), den allzu Unbändigen, der gleich zu Beginn mit einem entwendeten Auto durch die ferne Zukunft rast, auf einen vereisten Planeten. Er wird, genauer gesagt, von Spock (Zachary Quinto), mit dem er hier noch gar nicht befreundet ist, strafversetzt. Kaum öffnet er die Kapseltür und kraxelt er hinaus in die Kälte, ist aus dem Nichts Action. Er wird vom Monster gejagt, das in rascher Bewegung vom Zuschauerauge kaum dingfest zu machen ist. Dingfest gemacht, nämlich verspeist, wird das Monster von einem anderen, roten, riesenschlündigen, größeren Monster, das nun seinerseits nach der Verspeisung Kirk weiterjagt. Abrupt kommt in einer Höhle unter dem Eis die Action zum Stoppen, als Kirk auf jemanden trifft, auf den er, ginge es in diesem Paralleluniversum unsres Vertrauens mit rechten Dingen zu, wirklich nicht treffen dürfte.
Diese Szene ist, wenngleich in mancher Hinsicht ein Abweg des Films, exemplarisch: J.J. Abrams' "Star Trek"-Neuerfindung, macht nicht nur, indem sie zeitlich hinters Vertraute zurückgeht, manches neu (nur Spock, auch: Leonard Nimoy, macht sie zugleich sehr alt). Sie hat auch ihren ganz eigenen Action-Erzählrhythmus, an den sich zu gewöhnen nicht ganz leicht fällt. Urplötzlich, aus dem Nichts eben, rast der Film immer mal wieder einfach los und kommt dann, ab-,wenn nicht interrupt, wieder zum Halten und wird entweder komisch oder romantisch oder explikativ. Letzteres vor allem, um die Abweichungen des Neustarts von den dem Fan bekannten Tatsachen plausibel zu machen. So plausibel jedenfalls, wie Zeitreise-Verschlingungen eben zu machen sind.
Mit anderen Worten: J.J. Abrams und die Drehbuchautoren schlagen ein Wurmloch in die Zeit und legen einen eigenwilligen Gründungsmythos hinein: "Star Trek" erzählt sich zurück hinter den Beginn der bekannten Enterprise-Jahre, tut dies aber mit Variationen zu dem, was bisher bekannt war. Er erfindet dabei das Rad, den Mythos, die Figuren nicht neu. Aber mehr als nur die regressive Neugier der erbsenzählenden Trekkies befriedigen will er doch; er will Treue und Freiraum zugleich. Er gibt dem Affen Zucker mit vertrauten Griffen und Gruß-Gesten, aber er mutet den analeren der Fans, die gern alles genau so hätten, wie sie es kennen, doch mancherlei zu. Durchs Wurmloch fädelt der so nicht nur einen toten Kirk-Vater, sondern auch einen Spock, der das Verhältnis mit Leutnant Uhura (Zoe Saldana) hat, das Kirk hier gern hätte: Nun gibt es also zärtliche Abschiedsküsse unter Eifersuchtsblick vorm Wegbeamen der Helden in die Fährnisse fremder Räume und ihrer Schiffe.

Das Erzählen kann ja vielerlei Wünsche erfüllen. Dem Ur-Wunsch des Lesenden/Hörenden, nämlich vom jeweils nächsten "und dann" zu erfahren, ging J.J. Abrams als Autor in der TV-Serie "Lost" so virtuos wie mit dem klaren Meta-Bewusstsein der Beliebigkeit eines jeden "und dann" nach. Der anderen Lust, zu erfahren, was vorher war und wie die, die man bereits erzählt bekommen hat, waren, bevor man sie "kannte", der nachzugeben drängt in der Sorte Erzählung, die "Prequel" heißt, alles. Stocksteif malte etwa George Lucas als zu Geld und in die Jahre gekommener Verwalter des eigenen Schatzes die Vorgeschichte seiner "Star Wars"-Weltraumoper nach Zahlen.
In diesen Dingen grundstürzend zu verfahren, kann sich "Star Trek" als möglicher Beginn eines neuen Franchise, nun zwar auch wieder nicht leisten. Dennoch zieht der Film die Linien der Figuren und Mythen in Details jedenfalls anders und neu. Vom hinzugewonnenen Unterleib von Spock und Uhura war schon die Rede. Spock, der ohnehin fraglos die Zentralfigur ist, bekommt den breitesten Raum, auch für eine Neubestimmung seiner Vulkanier-Psyche: was es heißt, halb Mensch, halb Vulkanier zu sein, wird hier ebenso beleuchtet wie das Trauma, den Untergang des eigenen Planeten mitansehen zu müssen.
Zu finster freilich wird es in diesem Film nie. Was buchstäblich an den auf die Dauer doch schwer irritierenden "Lens Flares", also eigentlich technisch fehlerhaften, hier aber mit Absicht omnipräsenten Lichtreflexen im Bild, liegt. Wie alles technisch nicht perfekte in sauteuren Filmen ist das der billige Versuch, ein Doku-Feeling zu faken. Besser vielleicht als die Wackel-Handkamera, die Abrams im von ihm produzierten "Cloverfield"-Film an diese Stelle setzte. Aber Fake ist Fake und solange es keinen experimentellen Überschuss ergibt (und das tut's hier eher nicht), ist es etwas, das, merkt man die Absicht, eher verstimmt.
Aber weniger buchstäblich liegt die trotz Planetenzerstörung, Tattoo-Bösewicht Nero (Eric Bana), Monsterjagd, Spock-Vergreisung etc. heitere Stimmung auch und vor allem am Pop-Bewusstsein des Films. Sehr unbekümmert baut er Scherz und Ernst, Neuerungslust und Bewahrungsfreude, Erwartungserfüllung und Erwartungsenttäuschung zu einem mal fröhlich, mal eher langweilig, mal spannend, mal originell, mal allzu vertraut, mal dämlich, mal schlau durcheinanderrumpelnden Weltraumzirkus zusammen. Das macht oft Krach eher als Sinn, ist hübsch eher als toll und gerät irgendwann auch ganz aus dem Takt. Aber böse sein kann man der Veranstaltung nicht.
***
Drei Brüder werden in früher Kindheit getrennt und von ihren Pflegeeltern als Christ, Muslim, Hindu erzogen. Eines Tages landen sie, als Erwachsene und ohne einander zu erkennen, im selben Krankenhaus, um dort einer verunfallten Frau, die zufällig - was sie auch nicht wissen - ihre Mutter ist, gemeinsam Blut zu spenden. Diese Szenerie ist so abstrus wie schwer allegorisch und zu bewundern ist sie als nach mehr als zwanzig Minuten erst erscheinende Vorspann-Sequenz in Manmohan Desais durchgeknallter Bollywood-Komödie "Amar Akbar Anthony". Hier zu bewundern, ab 2:33.
Daran musste ich denken angesichts des wahren und ganz gewiss kein bisschen komischen, aber auf ähnliche Weise allegorisch zu nehmenden Falls, von dem Marcus Vetters und Leon Gellers Dokumentarfilm "Das Herz von Jenin" erzählt. Zwölf Jahre alt ist Ahmed Khatib, als er im palästinensischen Flüchtlingslager in Jenin im Westjordanland von einem israelischen Soldaten erschossen wird. Ahmed hat mit einem Plastikgewehr gespielt, der Soldat hat das missverstanden und geschossen. Ahmed ist nicht auf der Stelle tot, sondern wird über die Grenze ins Krankenhaus nach Haifa gebracht und dort für hirntot erklärt. Der Vater wird vor die Frage gestellt, ob er einer Organentnahme zustimmen will. Nach kurzem Bedenken und der Besprechung mit religiösen Beratern und Freunden sagt er ja.
Fünf Menschen werden dank der gespendeten Organe weiterleben können. Und zwar in Israel. Drei von ihnen stellt der Dokumentarfilm "Das Herz von Jenin" vor, zwei wollten anonym bleiben. Zur politischen Allegorie taugt das Ganze eben deshalb, weil Ismael, der Vater, eine Vergangenheit als militanter Kämpfer gegen die israelische Politik hat. Dennoch stimmt er der Freigabe der Organe ohne Einschränkung zu. Der Fall sorgt in den Medien für Aufsehen, die Kameras des Fernsehens sind frühzeitig dabei. Die Fernsehbilder sind nun auch in den Dokumentarfilm integriert, der die Vorgeschichte noch einmal ausführlich erzählt und die Schicksale der Beteiligten weiter verfolgt.
Zum zentralen Erzählstrang des Films wird eine zwei Jahre nach dem Tod Ahmeds stattfindende Reise Ismael Khatibs zu den drei Empfängerfamilien in Israel. Zu einem Beduinen in der Negev-Wüste im Süden, zu einer Drusen-Familie im Norden - und, das ist natürlich der eigentlich spektakuläre Fall: einem orthodoxen Juden in Jerusalem. Der hatte, noch im Krankenhaus befragt, unverblümt zu erkennen gegeben, dass ihm das Organ eines Juden für seine Tochter allemal lieber wäre. Später ruderte er, wenig überzeugend, zurück. Aus seinen Vorurteilen gegen Araber und Palästinenser macht er freilich nach wie vor keinen Hehl.

"Das Herz von Jenin" ist ein sehr ambivalenter Film, der vor allem durch seinen gitarresken Musikeinsatz immer wieder völlig unnötig emotionalisieren will, was ohne dies Zutun schon interessant genug wäre. Allein für die schwer erträgliche Szene aber, in der Ismael - inzwischen Leiter eines Kinderzentrums in Jenin - bei Familie Levinson auf dem Sofa sitzt, lohnt der Kinobesuch. Der reaktionäre Orthodoxe und der generöse Palästinenser haben sich buchstäblich nichts zu sagen, was nicht nur daran liegt, dass Ismaels auf der anderen Seite der Grenze lebender arabisch-israelischer Verwandter dolmetschen muss. Levinson schlägt vor, Ismael solle doch nach Europa gehen, in die Türkei zum Beispiel, Arbeit zu suchen. In der Tat hat Ismael immer wieder seine Arbeit verloren, vor allem jedoch deshalb, weil Israel in Angriffen auf Jenin, ein Zentrum des bewaffneten Widerstands, die Häuser zerstörte, in denen sich seine Geschäfte befanden.
Ismael antwortet auf diesen unverschämten Rat nicht. Nur an seinen Verwandten gerichtet ist seine resigniert-wütende Antwort: Warum geht Levinson nicht selbst nach Europa? Ansonsten: Schweigen. Herumsitzen. Ein Dialog scheint nicht möglich. Zaghafte Übergabe eines Geschenks von Levinson an Ismael Khatib. Er wird es im Film niemals auspacken. Was bezeichnend ist, nicht für Ismael, sondern den Film. Der schlägt sich ganz auf die Seite Khatibs und macht einen gerade wegen der von der Musik untermalten Einseitigkeit, mit der er das tut, seiner eigenen Position gegenüber reichlich skeptisch.
Star Trek. USA 2008 - Regie: J.J. Abrams - Darsteller: Chris Pine, Zachary Quinto, Simon Pegg, Karl Urban, John Cho, Zoe Saldana, Eric Bana, Anton Yelchin, Leonard Nimoy, Winona Ryder, Bruce Greenwood, Ben Cross, Greg Ellis
Das Herz von Jenin. Israel / Deutschland 2008 - Originaltitel: The Heart of Jenin - Regie: Marcus Vetter, Leon Geller - Darsteller: (Mitwirkende) Ismael Khatib
Kommentieren