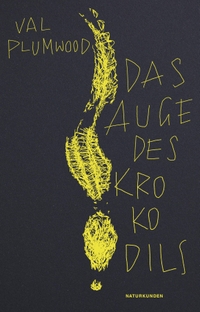Im Kino
Von Gefühl auf Welle
Die Filmkolumne. Von Lukas Foerster, Jochen Werner
28.11.2013. Rotwein, Meer und Sex mit dem Sohn der besten Freundin: Anne Fontaine erkundet unheimliche Gefühle in "Tage am Strand", nach einer Vorlage von Doris Lessing. Überraschend liebevoll und überhaupt nicht postmodern hat Pablo Berger in "Blancanieves" einen Stummfilm nachgebaut.
Das sonderbarste an diesem sonderbaren Film ist, dass man bis zum Schluss nicht sagen kann, wie er sich zu all den Sonderbarkeiten verhält, die er vor einem ausbreitet - in sehr souveräner Manier ausbreitet, soweit kann man das schon spezifizieren: Zu den beiden mittelalten Blondinen Lil und Roz (Naomi Watts und Robin Wright) vor allem, die in einem kleinen australischen Ort irgendwo an einem Traumstrand - nach Maßgaben einschlägiger Werbeclips und Urlaubsbroschüren - wohnen, in einer ausladenden Villa hoch über dem Meer sitzen und Rotwein trinken, im azurblauen Meer schwimmen und zwischendurch wechselseitig ihre kaum 20-jährigen Söhne Tom und Ian ficken. Zu diesen Söhnen (James Frecheville und Xavier Samuel, letzterer hatte eine kleine Rolle in einer der "Twilight"-Fortsetzungen) dann auch, die ihrerseits aussehen, das meinen nicht zuletzt ihre Mütter und Geliebten, "wie junge Götter", mit ihren durchtrainierten Oberkörpern und markanten Kinnpartien, wenn sie auf Surfbretter über die Wellen gleiten oder die Mütter ihrer besten Freunde anhimmeln.
Eine ziemlich verquere Konstellation; die nur vorübergehend entschärft wird, wenn sich erst Tom, dann Ian mit anderen, ihnen alterstechnisch angemesseneren Partnerinnen zusammentun. Eine Storyline ist das, die sich zwischendurch wie ein Groschenheftreißer ausnimmt, wofür sie dann aber doch wieder zu reflektiert anmutet. "Tage am Strand" basiert, immerhin, auf einer Novelle der unlängst verstorbenen Doris Lessing. Ich habe die Vorlage nicht gelesen, insofern bleibt alles Spekulation, aber ich könnte mir vorstellen, dass das auch insgesamt System hat: Eine Nobelpreisträgerin versucht, einen abstrakten Porno zu schreiben; und eine Arthausregisseurin macht daraus einen abstrakten Exploitationfilm.
"Tage am Strand" hält sich an der Oberfläche an die Regeln des guten Geschmacks; gelackt aussehen tut sowieso alles, die Sexszenen gehen nicht allzu weit, Watts und Wright überspielen auch die durchgeknalltesten Volten nicht. Anne Fontaine schneidet immer wieder effektiv von Gefühl auf Welle; aber die Wellen, auch das Mondäne und Rotweinige der Sets, dämpfen die Exzesse insgesamt eher, als dass sie sie verstärken. Gleichzeitig ist jede Handlung, jeder Blick unendlich überdeterminiert, vor allem über die Dialoge. Wenn gezeigt werden soll, dass der Freundschaft der beiden Hauptfiguren möglicherweise ein lesbisches Begehren zugrunde liegt, sagt Lil zu Roz: "He thinks, we are lesbians! We're no lezzos! Or Are we?" In solchen Momenten hat der Film durchaus ein Bewusstsein, wenn nicht für die Absurdität, so zumindest für die Konstruiertheit seiner Erzählung.

Es gibt zum Beispiel auch ein Bild, das die groteske Symmetrie der asymmetrischen Begierden, um die es die ganze Zeit geht, auf den Punkt bringt: Ein gemeinsamer Ausflug des gesamten Personals - es gibt zunächst noch zwei Männer im fortgeschrittenen Alter, die werden vom Film schnell entsorgt -, das, in Reih und Glied angeordnet (beziehungsweise in Zweiergruppen hintereinander, wie im Kindergarten), zum Strand schlendert: Drei Generationen sind unterwegs, eigentlich ein übertypischer Familienausflug, nur dass die Geschlechterverhältnisse ein wenig verschoben sind, hin zum Weiblichen. Offensichtlich beißt sich die Harmonie dieses Bilds mit den "illegitimen" und so gar nicht klassisch familiären Begehrensstrukturen. Nahe läge da die satirische Lesart, die aufs Rumoren unter der falschen Harmonie zielt, in der der Film aber kein bisschen aufgeht: Denn in der Artikulation des Films sind die "illegitimen" Begehrensstrukturen eben gerade nicht untergründig, sondern ganz im Gegenteil immer direkt an der Oberfläche, direkt greifbar sowohl für alle (unmittelbar) Beteiligten, als auch für die Regie.
"Tage am Strand" ist ein schwer lesbares, faszinierendes Kleinod, das dem Arthauskino dieser Tage wie untergejubelt wirkt. Wo Filme wie Frauke Finsterwalders "Finsterworld" und David Wnendts "Feuchtgebiete" zuletzt mit einigem Aufwand so verzweifelt versucht hatten, die Grenzen der Permissivität moderner Gesellschaften im Symbolischen auszuloten, nur um dann doch wieder bei den ewiggleichen Tabubrüchen (Finsterwalder) und Utopisierungen (Wnendt) zu landen, begnügt sich Anne Fontaine damit, eine einzige soziale Überschreitung mithilfe der nüchternen Eleganz des Starkinos auszubuchstabieren und entlang ihrer psychologischen Eigenlogik (das ist vielleicht der Kern der Irritation, und vielleicht auch das eigentlich radikale am Film: die konsequente und rückstandslose Verschiebung vom Sozialen ins Psychologische) durchzudeklinieren. Herausgekommen sind einige der unheimlichsten Gefühle, denen man im diesjährigen Kinojahr begegnen konnte.
Lukas Foerster
Tage am Strand - Australien 2013 - Originaltitel: Adore - Regie: Anne Fontaine - Darsteller: Naomi Watts, Robin Wright, Xavier Samuel, James Frecheville, Ben Mendelsohn, Sophie Lowe, Jessica Tovey - Laufzeit: 112 Minuten.
---

Die Geschichte ist wohlbekannt: Nach dem Tod ihrer Mutter während der Geburt fällt die junge Carmencita in die Hände einer bösen Stiefmutter, die ihren invaliden und in Depression versunkenen Vater, den bis zu einer bösen Verletzung berühmten Stierkämpfer Antonio Villalta, unter Kontrolle hält. Nach der Ermordung des Vaters und einem gescheiterten Mordanschlag auf Carmencita wird diese von einer fahrenden Gauklertruppe, den "sechs (!) stierkämpfenden Zwergen", aufgenommen und gesund gepflegt. Die unter Amnesie leidende Carmencita erweist sich in einer Notsituation als begnadete Torera und wird alsbald, unter dem Namen Blancanieves, als "siebter Zwerg" in die Gruppe aufgenommen. Als sich ihr Ruf im Lande verbreitet, wird die böse Stiefmutter Encarna auf die Totgeglaubte aufmerksam - und lässt sie mittels eines vergifteten Apfels in einen tiefen Schlaf fallen…
Der spanische Regisseur Pablo Berger hat das Märchen von Schneewittchen für seinen zweiten Film in das Sevilla der 1920er Jahre und in das dortige Stierkämpfermilieu verlegt - eine Entscheidung, die weitreichende ästhetische Konsequenzen zeitigt, ist doch "Blancanieves" ohne größere Bruchstellen als Stummfilm inszeniert. Im 1,33:1-Format, unter konsequentem Verzicht auf gesprochene Sprache und mit Zwischentiteln. Lediglich die innerdiegetisch gespielte Musik drängt auch an die Oberfläche der Tonspur und verrät damit deren grundsätzliche Ankopplung an das Filmbild, ansonsten bleibt Berger entschieden dem Dispositiv des Stummfilms der 1920er Jahre verpflichtet. Damit stellt er sich zwar in die nicht unbedingt neue, aber seit einigen Jahren doch auffällig präsente Traditionslinie des Neo-Stummfilms, bezieht aber in deren Rahmen eine einigermaßen singuläre Position.

Das Schönste an "Blancanieves" nämlich ist die schlichte Tatsache, dass Bergers Film kein bisschen postmodern ist. Während Guy Maddin, der wohl interessanteste Filmemacher des Neo-Stummfilms, in seinen frenetischen Filmen eine ziemlich idiosynkratische Ästhetik kreiert, die mitunter wirkt, als habe sich der Stummfilm, statt in den 1930er Jahren zu sterben, über Jahrzehnte weiterentwickelt und noch einmal rapide beschleunigt; und während Michel Hazanavicius' ziemlich langweiliger, aber Oskar-prämierter und ungemein populärer "The Artist" ein fast schon zwanghaftes, meistens ahistorisches und gelegentlich nachgerade respektloses Augenzwinkern über ein flaches Remake von "Singin' in the Rain" legte, ruht "Blancanieves" in sich selbst und in seiner Form. Die Entscheidung für diese Form hat nichts mit selbstreflexiver Ironie und vielleicht auch nicht einmal in erster Linie mit nostalgischen Reflexen zu tun - vielmehr scheint es, als habe Berger die Entscheidung für die Form des schwarz-weißen Stummfilms schlicht im vollen Vertrauen auf deren ästhetisches wie narratives Potenzial getroffen.
Somit ist, und das tut ihm sehr gut, "Blancanieves" gerade nicht von ausgestellten stilistischen Extravaganzen oder selbstironischen formalen Sperenzchen geprägt, sondern strebt einer Eleganz in der Formgebung zu - bis hin zum Ende, das von einer überraschend intensiven Melodramatik geprägt ist. Das heißt nicht, dass Berger das Tempo der Inszenierung nicht an neuralgischen Stellen auch rasant erhöht, aber wenn er, stets pointiert, zu diesem Mittel greift, dann reizt er eher die Möglichkeiten der gewählten Form aus, statt diese mit dem Handwerkszeug des kontemporären Kinos aufzusprengen.
Zurück bleibt der Eindruck eines Films, der die eigene Form ebenso wie seine märchenhafte Erzählung (und somit auch, gar nicht zuletzt, sein Publikum) erfreulich ernst nimmt - und der mit selbstverständlicher Eleganz eine wohlbekannte Geschichte exakt so weit neu interpretiert, dass sie interessant wird, ohne ihren Stoff zu verraten. "Blancanieves" ist ein durch und durch bezaubernder Film - und insbesondere für einen vorweihnachtlichen Kinoabend die perfekte Wahl.
Jochen Werner
Blancanieves - Spanien 2012 - Regie: Pablo Berger - Darsteller: Daniel Giménez Cacho, Ramón Barea, Inma Cuesta, Ángela Molina, Ignacio Mateos, Maribel Verdú, Carmen Belloch
Kommentieren