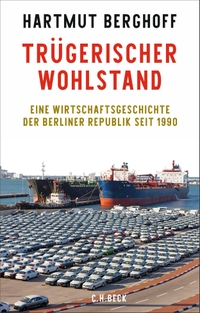Im Kino
Benzin, Wasser, Muttermilch
Die Filmkolumne. Von Rajko Burchardt, Lukas Foerster
14.05.2015. In "Mad Max: Fury Road" verlässt sich George Miller ganz auf die frenetische Bewegungslust aller Beteiligten. Thomas McCarthy lässt seinen unberechenbaren Adam-Sandler-Film "The Cobbler" in Richtung Macht- und Vergewaltigungsfantasien ausarten.
Den Kern der durchweg vom australischen Regisseur George Miller inszenierten und geschriebenen "Mad Max"-Filme bildet keine Figur, keine Geschichte, keine Mythologie, sondern ein einziges Bewegtbild, eine Art Urszene, die seit dem zweiten Film (der erste erzählte noch eine halbwegs realistische, nicht unbedingt blockbustertaugliche Rachegeschichte) wieder und wieder variiert wird: Auf einer endlos weiten, flachen, staubigen Ebene - der Schauplatz der Filme nennt sich einfach nur: Wasteland - jagen dutzende fantasievoll aufgemotzte Autos und Motorräder, Drei- und Vielräder einem anderen, ebenfalls fantasievoll aufgemotzten Wagen hinterher. Aus der Vogelperspektive erinnert die Fahrzeuge eher an eine Tierherde als an motorisierte, von Menschen gesteuerte Maschinen. Den Verfolgern geht es offensichtlich darum, das Gefährt an der Spitze zu zerstören oder zu kapern; sicher nicht geht es ihnen darum, es zu bremsen. Die erste Regel der "Mad Max"-Filme ist, dass es immer weiter und vor allem immer schneller vorwärts gehen muss, und zwar umso unerbittlicher, je unklarer ist, wohin die Reise eigentlich geht, oder wenigstens gehen könnte.
So gesehen ist "Fury Road", die lang erwartete Wiederaufnahme nach 30 Jahren "Mad Max"-Pause, der konsequenteste Beitrag zur Serie: Diesmal besteht der Film nur noch aus einer einzigen langen, zerdehnten Verfolgungsjagd. Genauer (und das ist wohl ein kleiner, aber sicher nicht entscheidender Spoiler): Erst rasen alle in die eine Richtung, dann beschließt die Besetzung des Wagens an der Spitze, umzukehren - und also rasen alle wieder zurück. Es geht, anders gesagt, darum, sich mit Volldampf und unter größtmöglichem Ressourceneinsatz (Benzin, Munition, Menschenleben, emotionale Gesundheit) kein bisschen von der Stelle zu bewegen. Zumindest darin ist "Fury Road" ein prototypischer Blockbuster. Weniger typisch: Das Ganze macht unglaublich viel Spaß.
Das hat zunächst technische Gründe: Die "Mad Max"-Filme sind Autoren-Blockbuster, man spürt stets, dass es jemanden gibt, der alle Fäden in der Hand behält, der das Chaos, das er entfesselt, zwar nicht zwanghaft kontrollieren will, aber doch zu orchestrieren und zu variieren in der Lage ist: Miller versteht es zum Beispiel glänzend, physikalische Phänomene wie Sandstürme, Canyons, Sumpfgebiete nicht einfach nur narrativ als Hindernisse, sondern als audiovisuelle Attraktionen zu inszenieren, die jeweils einzigartige Farbwelten und Soundscapes hervorbringen. Außerdem bleibt trotz des dem gesamten Film zugrunde liegenden Geschwindigkeitsrauschs das Gaspedal nicht immer durchgedrückt, die Atempausen ergeben sich organisch aus der Gesamtsituation, und selbst inmitten der wildesten Gefechte stellt sich gelegentlich für ein, zwei Minuten eine tranceartige Balance aller Fliehkräfte her - bevor es im Anschluss umso wütender kracht.

Mittendrin im technifizierten, millionenteuren Spektakel agieren nach wie vor Menschen aus Fleisch und Blut - und auch das klappt besser als in so ziemlich allen anderen Blockbuster-Extravaganzen der letzten Jahre. Da es in einem solchen Film nicht auf stabile Figurenidentitäten, sondern auf Körper-als-Attraktionen ankommt, hatte Miller kein Problem damit, den Star der ersten drei Filme zu ersetzen. Mel Gibson hat sich zumindest für die Blockbusterliga nachhaltig disqualifiziert, an seine Stelle tritt, mit demselben Rollennamen, Tom Hardy. Der neue Mad Max hat freilich einiges an Souveränität und Machismo oder einfach nur an Handlungsmacht eingebüßt. Hardys Max Rockatansky bekommt gleich im Prolog von einer Horde Zombies einen Dämpfer verpasst, die gesamte erste große Actionszene erlebt er, hilflos an eine der Maschinen gefesselt, als passiver Zuschauer; das Gitter, das ihm seine Peiniger vors Gesicht montiert hatten, wird er sogar erst noch ein wenig später los (und seine raspelig bellende, wenig elegante Stimme scheint sich den ganzen Film über nicht so recht an ihre Freiheit gewöhnen zu wollen).
Damit fügt sich Hardys Figur perfekt ein in einen Film, in dem alles und jeder vernarbt, verschweißt, verstümmelt ist. Und insbesondere macht es ihn zum natürlichen Verbündeten der heimlichen Hauptfigur des Films, der besonders spektakulär vernarbten, verschweißten und verstümmelten - genauer: arrmamputierten - Furiosa (Charlize Theron). Da ist schon fast der ganze Film: Theron und Hardy brettern in einem gigantischen Tanklaster durch die Gegend; auf der Rückbank sitzen fünf junge Frauen, die einer Vergangenheit als Sexsklavinnen entronnen sind (wenn die das erste Mal auftauchen, halbnackt im Wüstensand duschend, ist das ein grandios absurder B-Movie-Moment); und hinter ihnen rotten sich immer neue Horden von Bösewichtern zusammen, die selbst nicht immer so genau zu wissen scheinen, ob sie es jetzt auf Benzin, auf die Frauen, oder einfach nur auf einen blutigen Geschwindigkeitsrausch abgesehen haben.

Was nicht heißen soll, dass das world building in "Mad Max: Fury Road" simpel gestrickt wäre. In den wenigen Passagen, in denen nicht alles dem Bewegungsdrang untergeordnet ist, entfaltet sich ein breites, barockes Panorama: Offensichtlich herrscht in der postapokalyptischen Welt des Films ein allseitiges Hauen und Stechen, aber es hat sich doch eine technisch verhältnismäßig hochgerüstete Elite von Warlords herausgebildet, die sich eine Zombiearmee herangezüchtet hat und die Plebs mit gelegentlichen Wasserfontänen ruhigstellt (was leise Erinnerungen an die "Hunger Games"-Filme weckt - glücklicherweise sind die Macht- und Begehrensstrukturen im "Mad Max"-Universum um einiges instabiler als in Panem). Die einzige echte Opposition scheint in einem naturverbundenen Matriarchat zu bestehen, das sich weit außerhalb des Machtzentrums in der Salzwüste etabliert hat. Für Blockbusterverhältnisse erstaunlich ernst nimmt der (ohenhin angenehm ironiefreie) Film sein feministisches Programm; es gibt drei Flüssigkeiten, deren Verteilung das Leben im Wasteland regelt: Benzin, Wasser - und Muttermilch.
(Nebenbei: Das Geschlechterverhältnis ist, darauf verweisen neben vielem anderen die über der Scham verzahnten, an vaginale Fangeisen erinnernden Hüftgitter der geflüchteten Frauen, dermaßen kaputt, dass man sich fragt, wie in einer Welt, in der das Patriarchat derart totale Verwüstungen angerichtet hat, überhaupt noch einmal lustvoller Sex möglich sein könnte. Wird zukünftig mehr drin sein als keusches Händchenhalten mit dem linkischen Emo-Zombie? Oder als die nicht einmal so recht schmachtenden Blicke, die Theron und Hardy sich gelegentlich zuwerfen dürfen? Immerhin geben die Frauen, und wenigstens diese Wendung ist Max" Verdienst, die Suche nach dem eh unerreichbaren "ewigen Grün" der reinen Weiblichkeit auf - die Zukunft, und vielleicht auch die Zukunft der Liebe, liegt nicht in autarker Esoterik, sondern im Innern der chaotischen Maschinenwelt.)
Aber der eigentliche Reiz des Films ist der Bewegungsdrang. Beziehungsweise eine frenetische Bewegungslust, an der wirklich alle teilhaben, egal auf welcher Seite sie stehen: Die Zombies, die sich aus irgendeinem Grund immer wieder die Fresse silbern lackieren, was ihnen neue Kraft zu geben scheint, und die sich noch mehr als alle anderen zur Maschine machen, wenn sie das Benzin direkt mit dem Mund in die Autos befördern; die Autos selbst, in denen sich immer noch ein weiterer, versteckter Turboboost-Knopf zu befinden scheint; ganz besonders jener spektakulärste aller Freaks, der, angetan in knallroter Montur, auf einer der Höllenmaschinen eine Boxenwand aufgebaut hat, vor der er sich dann während der Verfolgungsjagd selbst aufstellt, um mithilfe einer feuerspuckenden (!) E-Gitarre seinen kleinen Beitrag zum glücklicherweise auch sonst auf jeden guten Geschmack pfeifenden Tohuwabohu zu leisten; oder auch jene hochschwangere entflohene Sklavin, die, während sie sich herausfordernd aus der Tür eines mit Höchstgeschwindigkeit an Felswänden entlang rasenden, von wild um sich ballernden bad guys verfolgten Lastwagens lehnt, Hardy einen geradezu ekstatischen Blick zuwirft. Einen Moment später fällt sie aus dem Wagen und kommt unter die Räder.
Lukas Foerster
Mad Max: Fury Road - Australien, USA 2015 - Regie: George Miller - Darsteller: Tom Hardy, Charlize Theron, Nicholas Hoult, Hugh Keays-Byrne, Zoë Kravitz, Rosey Huntington-Whiteley, Riley Keough - Laufzeit: 120 Minuten.
---

Adam Sandler ist Max Simkin, New Yorker Schuster in vierter Generation, ewiger Junggeselle. Der deutsche Untertitel von "The Cobbler" nennt diesen Max einen "Schuhmagier", weil er die äußere Gestalt seiner ahnungslosen Kunden annehmen kann, sobald er in deren neu gesohlte Treter schlüpft. Eine steinalte Durchnähmaschine ermöglicht die Verwandlungen, ganz zufällig hat Max sie und ihren einladenden Zauber entdeckt. Den weltverlorenen, einsam vor sich hin schusternden Mann haut seine besondere Fähigkeit buchstäblich aus den Socken: Was sich in fremden Körpern alles anstellen, in welche Leben sich heimlich eintauchen lässt! Die Probe aufs Exempel macht Max noch am gleichen Abend. Er mimt einen schönen Gigolo von nebenan (und sieht deshalb - absolut nachvollziehbar - aus wie Dan Stevens), prellt in bürgerlicher Montur Schickimickirestaurants um die Zeche, atmet das ihm sonst versagte Flair der Upper East Side.
Die Zuschauer haben einen entscheidenden Wissensvorsprung. Im schummrig-schönen Prolog des Films warnt Max" Urgroßvater auf Jiddisch, man dürfe die Maschine "nur in speziellen Zeiten" nutzen. Der Hinweis erinnert an einen Grundsatz der Spider-Man-Comics von Stan Lee, demzufolge aus großer Kraft auch große Verantwortung erwachsen müsse. Tatsächlich erzählt "The Cobbler", der zunächst als eine höchst sonderbare Mischung aus Indie-Befindlichkeitsfilm, Familienmelodram und Großstadtmärchen daher kommt, im Kern eine Superheldengeschichte: Max stellt seine Fähigkeit zum Identitätswechsel bald nicht mehr in den Dienst seiner hedonistischen Vergnügungssucht, sondern in den eines lokalpolitischen und nachbarschaftliche Interessen vertretenden Aktionskomitees, das gegen skrupellose Immobilienhaie vorgeht (und damit Ellen Barkin auf den Plan ruft, die als Gentrifizierungsmonster eine der vielen hinreißenden Nebenrollen spielt).

Der Film schlägt einige reichlich absurde Haken, die Regisseur Thomas McCarthy ("Station Agent") inszeniert, als handele es sich bei ihnen um den normalen Lauf der Dinge. Er begreift die übernatürliche Idee nicht als Gimmick, er gleicht sie einfach den soziokulturellen Gegebenheiten seines Helden an. "The Cobbler" wird dadurch zu einem unberechenbaren, vor allem aber widerstandsfähigen Spaß, der Adam Sandlers übliches Komödienmuster sanft durchbricht - weil er gar keine Komödie ist (und man eigentlich auch nicht recht weiß, was dieser Film in Genrebegriffen gedacht überhaupt sein soll), ganz besonders aber, weil er sich weigert, die Idee auf eine Zielgerade zu bringen. Nutzten Sandlers bisherige Fantasyfilme, wie etwa "Klick" oder "Bedtime Stories", ihre phantastischen Einfälle für harmlose Gags, die über ein angerichtetes Chaos hinweg- und schließlich zurück in die häusliche Familienordnung helfen müssen, zieht "The Cobbler" aus der Prämisse logische Schlussfolgerungen: Er artet aus.
Entsprechend unklar bleibt, ob man es rührend oder hochbefremdlich finden soll, wenn Max in die Schuhe seines seit vielen Jahren abwesenden Vaters schlüpft, damit seine demenzkranke Mutter ihren entschwundenen Ehemann wieder sehen kann. Und ob es ein brillanter oder doch eher behämmerter Einfall ist, Max auch einmal als Trans*mann auftreten zu lassen, der mit seinen High Heels einen Gangster umlegt. Nicht weniger irritierend - und die konsequent unmoralische Ausschöpfung der Idee - ist eine andere Szene, in der Max in Gestalt des attraktiven Ladennachbarn beinahe mit dessen ahnungsloser Freundin schläft. Dass McCarthy die wohlfühlkinotauglichen Implikationen seiner Geschichte ganz konkret gegen Macht- und sogar Vergewaltigungsfantasien seiner Figur abzuwägen bereit ist, macht "The Cobbler" zu einem besonderen, ambivalenten Seherlebnis. Weshalb es umso bedauerlicher ist, dass er nach einem desaströsen US-Einspielergebnis nicht in den deutschen Kinos zu sehen sein wird - als bislang erster Sandler-Film überhaupt.
Rajko Burchardt
The Cobbler - USA 2014 - Regie: Thomas McCarthy - Darsteller: Adam Sandler, Dan Stevens, Steve Buscemi, Dustin Hoffman, Ellen Barkin, Dascha Polanco - Laufzeit: 99 Minuten.
1 Kommentar