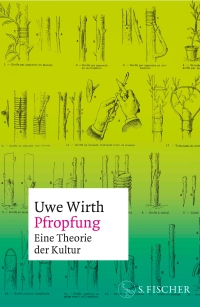Im Kino
Echts
Die Filmkolumne. Von Ekkehard Knörer
06.01.2010. In ihrem umwerfenden SciFi-Videospiel-Actioner "Gamer" zeigen Mark Neveldine und Brian Taylor etwas wie Live-Bilder aus der Höhle des Löwen der zeitgenössischen Unterhaltungsindustrie. Als Mann von gestern erweist sich dagegen Terry Gilliam mit seiner aufwendigen Fantasieapparatur "Das Kabinett des Dr. Parnassus", in der Heath Ledger seinen letzten Auftritt hat.
Mit den ersten Bildern schon sind wir im Spiel. Mann mit Knarre schießt wild um sich. Die Kamera wechselt von der Egoshooter-Perspektive rasant anderswohin, schnelle Schnitte, laute Schüsse, zerfetzte Körper, der Videospiel-Alptraum wird wahr, im Kino: Was man hier sieht, für KingogängerInnen (großes I trotzig: eigentlich Inbegriff eines Jungsfilms) ab 18, ginge im Videospiel nicht. Denn dort wird nur virtuell geschossen und lebensecht explodiert da, weil nur entschärfte Darstellungen erlaubt sind, legalerweise kein einziger Mensch. Ganz anders in "Gamer" bzw. in "Slayer" (was wie eine Metal-Band klingt und viel Metal-Musik gibt es durchweg zu hören) - in diesem vom Film ausgedachten Spiel nämlich ist alles echt. Der Clou besteht darin, dass in den Sessel gefläzte Spieler die Bewegungen anderer Menschen kontrollieren. Möglich wird es durch mutierte, ins Hirn der Gespielten gepflanzte Zellen. Die Gespielten tun als Spieler dann, willenlos oder gegen ihren Willen, was ihnen der sie Spielende befiehlt. Rennen und Schießen zum Beispiel. Aber auch in Sachen Sex bleibt kein Wunsch offen.
Zwei Spiele hat der darüber zum Mulitmilliardär gewordene Ken Kastle (Michael C. Hall) erfunden: Vor "Slayer" bereits "Society", das ist etwas wie "Sims", nur in echt. Nicht-Sims, Echt-Sims: "Echts". Die Spielewelt ist - anders als im düsteren "Slayer" - bonbonbunt und wie in alten allegorischen und neuen brauchbarkeitsfixierten Bilddarstellungen hängen überall Fähnchen, die zu den Figuren Näheres anzeigen. Alles ist nicht-virtuell auch in diesem Environment, jeder darf sein, wer er will. Exemplarisch vorgeführt wird das an einem namenlos fetten Kerl, der eine schöne schlanke Blondine sein eigen nennt und sich im Spiel, einzig Sex und Schmutz im Sinn, von ihr verkörpern lässt. Die "Darstellerin" - die nichts selbst darstellt, sondern vom Fettwanst gespielt wird wie von einem kontrollfanatischen Filmregisseur - braucht das Geld und wird außerhalb der Spielumgebung (und "Umgebung" ist hier sehr wörtlich lokal zu verstehen) wegen ihres Berufs als eine Art Prostituierte betrachtet. Daran hängt ein dünnster Plot aus ganz alten Zeiten. Man muss über ihn, weil er nichts als fadenscheinigster Vorwand für ganz anderes ist, kein Wort weiter verlieren.

"Gamer" tut videospielkritisch. Niemand nimmt dem Film und seinen Machern, dem Regie- und Autorenteam Mark Neveldine und Brian Taylor das ab; was keine Kritik sein soll, denn das Manöver ist für jeden durchschaubar. Neveldine / Taylor sind Freibeuter einer - unserer - spätkapitalistischen Entertainmentkultur, zu der sie nur eine Haltung kennen: die schiere Steigerungs- und Übersteigerungswut. Die Lust, die sie am Metzeln haben, spritzt blutrot aus jedem ihrer hochbeschleunigten Bilder. Ebenso wie der Spaß, den sie am Spritzen haben, an der Hochbeschleunigung, am Druck des schnellen Drehs, an der jeden Übergang, jede Pause wegpustenden Montage, dem unverbundenen Ineinander von Bildtypen, der umstandslosen Wiederverwendung von Genreversatzstücken. Das Kino ist ihnen ein optisch-akustisches Maschinengewehr.
"Gamer" ist ein Spitzenerzeugnis der US-Filmindustrie. Als Teil und Produkt dieser Industrie denkt der Film nicht kritisch, sondern fiebert affirmativ. (Fast: Es gibt, wie erwähnt, humanistische Reste im Plot, die die Erzählung immerzu höchst beeindruckend wieder vergisst. Ein überflüssiger Old-Hollywood-Anstandswauwau wie einer, der neben einem im Kino-Sitz Popcorn frisst. Gelegentlich hört man es mampfen.) Bei allem Tempo, das der Film vorliegt, sollte man nicht übersehen: Die Bilder, die Neveldine / Taylor finden, sind unterschiedlicher Art und zwar meist ganz schön hässlich (im Sinn hergebrachter Vorstellungen von Schönheit), daber aber immer auch supersmart. Wie sie die Ego-Shooter-Action-Szenarien filmen, ist schlicht genial. Weil sie nämlich gerade nicht wie im Videospiel in der Ich-Perspektive verharren, sondern diese Ich-Perspektive in rasant hin- und herspringende Actionfilmbilder "übersetzen". Die beiden haben, nicht nur hier, mehr Formbewusstsein im kleinen Finger als der - fatale Wahl! - nächste Bond-Regisseur Sam Mendes je besaß. Nein, Formbewusstsein ist falsch. Es ist ein Formunterbewusstes, das ihnen die Kamera führt. Was man, wie so vieles hier, buchstäblich verstehen darf, denn die beiden, man glaubt es sofort, rasen als ausführende Kameramänner auf Skates durch die von ihnen angerichtete Szenerie. Wo die Kamera hin soll, steht, erfährt man in Interviews, steht schon im Drehbuch. Aufgelöst wird der Film ins Bewegtbild dann aber vollends spontan vor Ort. Das Drehbuch schreiben Neveldine / Taylor selbst: postauktoriale Auteurs mit Rädern unten dran.
Und gar nicht so selten kommt ihnen dann eine ganz und gar durchgeschossene Idee. Kurz vorm Showdown auf dem Basketballfeld beginnt es auf der Tonspur zu schnippen, das Licht wird umgeschaltet auf Silhouetteneffekte und der alles kontrollierende Oberschurke tanzt zur Musik von Cole Porter wie eine frisch von ihren Fäden losgeschnittene Marionette. Daraus entsteht gleitend eine Action-Choreografie, bevor es dann ganz anders wiederum weiter geht. Neveldine / Taylor pfeifen aus Prinzip auf jede Einheitlichkeit und bringen gerade in der ihnen eigenen meta-hybriden, abwechslungssüchtigen und eben selbst superunterhaltsamen Form das Entertainment unserer Gegenwart auf den Punkt. (Das eben im besten Fall nicht dumm, sondern schlau ist, nicht öd, sondern aufregend, nicht langsam, sondern schnell, nicht kritisch oder affirmativ, sondern die Zeit aufs angenehmste verkürzend.) In der Konsequenz, mit der sie nehmen, was sie aus der Entertainmentkultur nur kriegen, schlägt ihre aus manchen Scheußlichkeiten zusammengemengte Exploitation um in eine postillusionistische Echtheit. Es ist gerade so, als besäßen Neveldine / Taylor einen Körper-Port zu den Produktionszentren der Entertainment-Industrie. "Gamer" zeigt quasi live Bilder aus der Höhle des Löwen.
P.S.: Für weitergehend Interessierte gibt es hier eine sehr ausführliche, eher akademische und gelegentlich etwas übereifrige Analyse des Films von Steven Shaviro (in englischer Sprache).
***

Dagegen ist Terry Gilliams "Kabinett des Dr. Parnassus" eine Rumpelkammer von einem Film und lässt sich geradezu als das Punkt für Punkt, Bild für Bild und Idee für Idee uninteressantere Gegenstück zu "Gamer" begreifen. Wo "Gamer" das Videospiel mit den Mitteln des Industrie-Kinos - kontrollierte Rasanz-Montage als Beschuss mit rasch wechselnden Reaktionszumutungen für den Betrachter - noch einmal überholt, hat Gilliam nicht nur die Zukunft ("some years from this exact moment", wie es brillanterweise bei Neveldine / Taylor heißt), sondern auch die Gegenwart längst aufgegeben. Sein "Imaginarium" ist pure Nostalgie für etwas, das früher einmal Fantasie hieß, fast immer schon ein vornehmeres Wort für Wirklichkeitsflucht war und in der Regel eine Form von Second-Hand-Bildern hervorgebracht hat, die von der ganz und gar zeitgenössischen Vernutztheit des "Gamer"-Bildmaterials kategorial unterschieden ist. Wo "Gamer" mit lustvoll erarbeiteter Exploitation die Wahrheit sagt, produziert Gilliam mit digital aufgemöbelten altbekannten-neutuenden Fantasievignetten nichts als Kitsch, mithin Lüge.
Bedenkenlos bedienen sich Gilliam und sein Drehbuch-Koautor Charles McKeown aus dem Fundus Alteuropas. Dr. Parnassus (Christopher Plummer) verpfändet seine Tochter zu deren 16. Geburtstag dem Teufel (sieht alt aus: Tom Waits) und erhält dafür, was generell überschätzt wird, das ewige Leben. Der Tochter-Geburtstag steht zu Filmbeginn in wenigen Tagen bevor und Parnassus sucht recht verzweifelt einen Ausweg. Die Nicht-Gegenwart, in der das "Imaginarium" spielt, hat manche Züge des Steampunk, der die Vergangenheit vor allem des technologischen Aufbruchs mit virtuellen Geschichten und Alternativrealitäten umschreibt. So sieht man hier Kutschen und Techno-Clubs durcheinander, aber stets so, dass kein Zweifel besteht, dass der Film selbst die Kutsche dem Techno-Club vorzieht. Alles Gegenwärtige ist bei Gilliam Alibi und sein Drängen geht sehr konsequent und sehr buchstäblich weg aus dieser Gegenwart durch eine Tür in einen ganz anderen Raum.
Dr. Parnassus, der sehr alte Mann, vertreibt sich in der Film-Gegenwart die endlose Zeit als Jahrmarktsattraktion. Er bietet dem Publikum eine Art interaktives Videospiel mit einem Besuch ("Alice in Wonderland" steht nicht fern) hinter dem Spiegel. Im Imaginarium werden die Spieler/Besucher mit ihren eigenen Wunschfantasien konfrontiert. Eine luxussüchtige ältere Frau etwa landet in einer Welt aus riesigen Schuhen und sieht sich im Spiegel schlank und jung. (So abgeschmackt ist das? Ja.) Mit viel Mühe, viel Not, viel zu vielen Worten und hässlich dazwischentrötender Musik macht der Film aus dem Faustpakt, der Spiegeltür und seiner Figurenkonstellation die Geschichte der Suche nach einem Ausweg aus dem Parnassus-Dilemma. Dafür hängt er Heath Ledger, der während der Dreharbeiten starb, am Strick von der Brücke, pflückt ihn, der sich an nichts erinnert, hinunter und schickt ihn erst als Rattenfänger auf die Imaginarium-Bühne, dann - als Johnny Depp, Jude Law und Colin Farrell - wieder und wieder in die Fantasiewelt hinter der Spiegeltür. Ledger/Depp/Law/Farrell sollen fünf Seelen fangen, dafür gibt Tom Waits dann die Seele der Tochter (Lily Cole) frei.
Ein großer Aufwand zergeht in dieser Konstruktion in nichts, ohne Witz. Mit vielen Worten hat "Das Kabinett des Dr. Parnassus" wenig zu sagen. Heterogen ist das Material, das Gilliam zusammenbringt, aber die Heterogenität hat keine Methode, sondern ist nur Ausweis eines fehlenden Bands, das die auseinanderfallenden Einzelteile zu einem sinnvollen Ganzen vereinte. Allegorische Lesarten - Parnassus als Seelenfänger aus der Traumfabrik? - enden sehr schnell im uninterssanten Selbstwiderspruch. Und die aus Computern heraufbeschworenen Fantasien sind entweder fader Aufguss bekannter Gilliam-Bilder, elektronisch aufgedonnerte dünne Satire oder Reminiszenz an bessere Monty-Python-Zeiten (ein aus dem Boden brechender Polizistenkopf, der ein Musicalmoment entbindet). Es kommt hinzu, dass nicht nur die Darsteller, sondern auch die Kamera und die Musik von der Regie zum ständigen Overacting und Zappeln genötigt werden. Wo "Gamer" durch einfallsreiche Hyperkinetik Affekt und Denken befeuert, betäubt Gilliams wirklichkeitsflüchtig-nichtiges "Imaginarium" Sinne und Verstand.
Gamer - Play Or Be Played. USA 2008 - Originaltitel: Gamer - Regie: Mark Neveldine, Brian Taylor - Darsteller: Gerard Butler, Amber Valletta, Michael C. Hall, Kyra Sedgwick, Chris "Ludacris" Bridges, Alison Lohman
Das Kabinett des Dr. Parnassus. Frankreich / Kanada / Großbritannien 2009 - Originaltitel: The Imaginarium of Doctor Parnassus - Regie: Terry Gilliam - Darsteller: Johnny Depp, Heath Ledger, Jude Law, Colin Farrell, Christopher Plummer, Tom Waits
Kommentieren