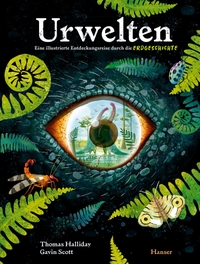Im Kino
Farmer John in seinem Widerspruch
Die Filmkolumne. Von Ekkehard Knörer
12.09.2007. Taggart Siegels Dokumentarfilm "Mit Mistgabel und Federboa - Farmer John" porträtiert einen wahrhaft bizarren Öko-Bauern aus dem Mittleren Westen der USA, und der renommierte Drehbuchautor Scott Frank überzeugt mit seinem sorgfältig kalibrierten Regiedebüt "Die Regeln der Gewalt". John Peterson ist wohl das, was man aus der Art geschlagen nennt. Seit Jahrzehnten arbeitet seine Familie in der Landwirtschaft, tief im konservativen Mittleren Westen, im Bundesstaat Illinois, Welten entfernt aber von dessen größter Stadt Chicago. Zwar übernimmt John nach dem frühen Tod seines Vaters die Farm. Vom nahe gelegenen College, das er nebenbei besucht, bringt er aber Hippies und jede Menge aus der Sicht seiner Nachbarn und Verwandten übergeschnappter Ideen mit auf die Farm. Die Studenten drehen durchgeknallte Filme, betreiben dilettantisch Landwirtschaft, singen und leben das Leben einer Landkommune. Natürlich verbreiten sich in der umliegenden Gegend bald wie Lauffeuer Gerüchte, hier seien drogensüchtige Satanisten dabei, kleine Kinder zu schlachten.
John Peterson ist wohl das, was man aus der Art geschlagen nennt. Seit Jahrzehnten arbeitet seine Familie in der Landwirtschaft, tief im konservativen Mittleren Westen, im Bundesstaat Illinois, Welten entfernt aber von dessen größter Stadt Chicago. Zwar übernimmt John nach dem frühen Tod seines Vaters die Farm. Vom nahe gelegenen College, das er nebenbei besucht, bringt er aber Hippies und jede Menge aus der Sicht seiner Nachbarn und Verwandten übergeschnappter Ideen mit auf die Farm. Die Studenten drehen durchgeknallte Filme, betreiben dilettantisch Landwirtschaft, singen und leben das Leben einer Landkommune. Natürlich verbreiten sich in der umliegenden Gegend bald wie Lauffeuer Gerüchte, hier seien drogensüchtige Satanisten dabei, kleine Kinder zu schlachten.Die Idylle als Oase der Freiheit inmitten der Reaktion ist nicht von Dauer. Es sind schwere Zeiten für die Landwirtschaft, John Peterson muss einen großen Teil des weitläufigen Farmgeländes verkaufen. Er durchleidet eine mehrjährige Depression, er geht nach Mexiko, er schreibt ein Theaterstück über die Widrigkeiten des Handwerks, das vor Farmern mit Tränen in den Augen aufgeführt wird. Dann hat er die eine oder andere Erleuchtung und beginnt, auf den Feldern eigenhändig Bio-Gemüse anzubauen. Von homöopathischen Düngemethoden über den aufrecht chemiefreien Kampf gegen Ungezieferhorden geht alles ökologisch über die Maßen korrekt zu. Als die Bio-Mode von den Großstädten her in den USA Fuß zu fassen beginnt, wird seine Farm zum Öko-Kollektiv "Angelic Organics" (hier die sehr besuchenswerte Website), dessen Produkte mehr und mehr Kunden sich etwas kosten lassen. Kurzum: Eine Erfolgsgeschichte mit viel aspera und wenig astra, aber doch einem Happy End.
John Peterson ist um einiges seltsamer, als schon diese Aufzählung ihn erscheinen lassen dürfte. Zum Beispiel liebt er es, im Fummel auf dem Traktor zu sitzen oder im Bienenkostüm mit seiner Freundin Leslie über die Felder zu springen. Wenn er spricht, klingt er tuntig, er ist aber, wie eine Serie von Freundinnen demonstriert, kein bisschen schwul. Er liebt, sagt er im von ihm selbst geschriebenen Erzähltext aus dem Off, Stahl, der sich in die Erde gräbt, er liebt die Verkleidung, die Natur und entdeckt irgendwann Rudolf Steiner. Er ist, mit einem Wort, von einer auch für US-Verhältnisse wirklich bizarren Individualität, in der zusammenkommt, was nach landläufigen Vorstellung von Normalität nicht zusammenpasst.
Der Film und sein Protagonist werden alle Fans des esoterisch-ökologischen Landbaus fraglos hellauf begeistern. Aber auch für jene, die - wie der Rezensent - das ganze
 einschlägige geistige Rüstzeug für, wenn auch ziemlich harmlosen, Unfug halten, ist das alles keineswegs uninteressant. Es beginnt schon damit, dass das Leben des John Peterson seit den fünfziger Jahren bestens auf Film dokumentiert ist. Johns Mutter Anna, ein Fan von Jim Morrison, auch wenn er sich wirklich schlecht gekleidet hat, wie sie findet, brachte eine Farbfilm-Super-8-Kamera auf die Farm. John und seine Familie haben sich durch die Jahrzehnte hindurch ständig gefilmt, das Material ergänzt die Bilder des Dokumentarfilmers Taggert Siegel auf faszinierende Weise. Es ist ein bisschen wie die um alle Avantgardismen bereinigte Eso-Version von Jonathan Caouettes am Apple zusammengebastelter Videoschnipsel-Autobiografie "Tarnation".
einschlägige geistige Rüstzeug für, wenn auch ziemlich harmlosen, Unfug halten, ist das alles keineswegs uninteressant. Es beginnt schon damit, dass das Leben des John Peterson seit den fünfziger Jahren bestens auf Film dokumentiert ist. Johns Mutter Anna, ein Fan von Jim Morrison, auch wenn er sich wirklich schlecht gekleidet hat, wie sie findet, brachte eine Farbfilm-Super-8-Kamera auf die Farm. John und seine Familie haben sich durch die Jahrzehnte hindurch ständig gefilmt, das Material ergänzt die Bilder des Dokumentarfilmers Taggert Siegel auf faszinierende Weise. Es ist ein bisschen wie die um alle Avantgardismen bereinigte Eso-Version von Jonathan Caouettes am Apple zusammengebastelter Videoschnipsel-Autobiografie "Tarnation".Zur Medien- kommt die Zeitgeschichte. So scheckig bunt die Persönlichkeit John Petersons zusammengesetzt ist: gerade darin wird sie zum Spiegel der gesellschaftlichen Veränderungen, die die USA in den letzten Jahrzehnten bei aller sozialen Segmentierung als ganzes durchgemacht haben. Friedens- und freiheitsbewegte Hippies treffen in den sechzigern auf amerikanische Heartland-Tradition - und John Peterson vereint beides in seiner Person. Der ökonomische Niedergang der Landwirtschaft ist am Schicksal seiner Farm ebenso ablesbar wie die postmaterialistische Lust am Qualitätsprodukt - untermischt freilich (auch das ist zu sehen) mit von neokolonialen Zügen nicht ganz freier Beschäftigung mexikanischer Billigarbeiter. Dass es dem Film völlig an Distanz zu seinem Gegenstand mangelt, macht ihn zwar gelegentlich etwas nervtötend, schadet aber seinem Status als Dokument US-amerikanischer Widersprüchlichkeiten kein bisschen. Wer darüber etwas wissen will, sollte sich "Mit Mistgabel und Federboa - Farmer John" ansehen.
***
 Vier angetrunkene Jugendliche in rasender Fahrt im Roadster. Die Nacht ist so finster, dass tausende Glühwürmchen wie Lichtstaub rund um das Auto wirbeln. Der Fahrer beschleunigt, die Mitfahrer schreien, und er schaltet, um das Glühwürmchen-Schauspiel zu genießen, die Scheinwerfer aus. Die Nacht, die leere Landstraße, das Licht: es sind großartige Bilder, denen doch zugleich anzusehen ist, dass diese Fahrt abrupt enden wird.
Vier angetrunkene Jugendliche in rasender Fahrt im Roadster. Die Nacht ist so finster, dass tausende Glühwürmchen wie Lichtstaub rund um das Auto wirbeln. Der Fahrer beschleunigt, die Mitfahrer schreien, und er schaltet, um das Glühwürmchen-Schauspiel zu genießen, die Scheinwerfer aus. Die Nacht, die leere Landstraße, das Licht: es sind großartige Bilder, denen doch zugleich anzusehen ist, dass diese Fahrt abrupt enden wird.Der Fahrer des Wagens ist Chris Pratt (Joseph Gordon-Levitt), Star des Eishockeyteams, Frauenschwarm und überhaupt ein junger Mann, der zu Hoffnungen Anlass gibt. Die Fahrt über Land aber endet mit dem Zusammenstoß mit einem landwirtschaftlichen Gerät auf der Fahrbahn; einen Schnitt später sehen wir Chris wieder. Er erwacht, er erzählt, er buchstabiert sich selbst seinen Tagesablauf, als könnte er jeden Moment wieder vergessen, wie das geht: Aufstehen, Frühstück machen, überhaupt: alltäglichstes Leben.
Chris, wir verstehen, was zu ahnen war, hat den Unfall auf der Straße zwar überlebt, aber mit schweren Hirnschäden. Alle Hoffnung, nicht zuletzt der Familie, auf ein erfolgreiches Leben ist dahin. Jeden Tag geht er in ein Therapiezentrum, in dem er lernt, die einfachsten Dinge wieder auf die Reihe zu kriegen. Er lebt nicht allein, sondern mit einem sarkastischen Blinden (eindrucksvoll: Jeff Daniels) zusammen. Er arbeitet nachts als Reinigungskraft in einer Bankfiliale in einer Kleinstadt in Missouri, unweit von Kansas City. Dieses neue Leben zeichnet der Film geduldig und mit viel Liebe zum Detail.
Es dauert deshalb eine ganze Weile, bis die Dinge, unvermerkt erst, auf einen Genre-Plot zuzulaufen beginnen. Langsam nur wird das Porträt eines Mannes, der zu leben erst wieder lernen muss, zur Geschichte eines geplanten Banküberfalls, in den er sich verwickelt sieht. Die Geduld, die "Die Regeln der Gewalt" in der Entfaltung seines kleinen, aber differenzierten Weltausschnitts an den Tag legt, zahlt sich freilich aus: Nicht nur in der Sympathie, die man für die Figuren empfindet, sondern auch in der Glaubwürdigkeit des sich entfaltenden Szenarios.
Es ist kein Wunder, dass der Drehbuchautor und Regisseur weiß, was er tut. Scott Frank kannte man bisher - oder kannte ihn eben nicht - als Autor von Erfolgsfilmen wie Steven Soderberghs "Out of Sight" oder Steven Spielbergs "Minority Report". Für sein Regiedebüt hat er natürlich selbst das Drehbuch geschrieben, als alter Profi dabei aber auf alle bei Debütanten sonst so zu beobachtenden Angebereien in Buch und Inszenierung erfreulicherweise prima verzichten können. Große Überraschungen hält die Geschichte nicht bereit, eher kommt alles so, wie es kommen muss. Es ist ein Zeichen seiner Klasse, dass er einen trotzdem vom ersten Moment an packt und bis zum dann doch überraschenden Ende nicht mehr loslässt.
Mit Mistgabel und Federboa - Farmer John. Regie: Taggart Siegel. Mit John Peterson. USA 2006, 83 Minuten.
Die Regeln der Gewalt. Regie: Scott Frank. Mit Joseph Gordon-Levitt, Jeff Daniels, Matthew Goode, Isla Fisher, Carla Gugino und anderen . USA 2006, 99 Minuten.