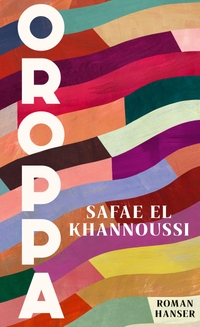Im Kino
Kein Name, sondern ein Gesicht
Die Filmkolumne. Von Nicolai Bühnemann, Thomas Groh
07.03.2018. In John Carroll Lynchs schöner Offbeat-Americana "Lucky" ist der legendäre - und kurz nach der Premiere des Films verstorbene - Nebendarsteller Harry Dean Stanton endlich einmal in einer Hauptrolle zu sehen. Eli Roth widmet sich in seinem Remake des 1970er-Jahre Films "Death Wish" in subversiver Manier dem Thema Selbstjustiz.
Harry Dean Stanton, das ist kein Name, sondern ein Gesicht. Vielleicht auch eine physiognomische Landschaft. Eine Landschaft, der man im Laufe der Filmgeschichte dabei zusehen kann, wie sie sich findet und sich definiert, wie in sie Gräben geschlagen und Falten aufgeworfen werden. Jemand sagte mal, Filme schauen, das heißt dem Tod bei der Arbeit zuzusehen. Filme schauen, das heißt aber auch: Harry Dean Stanton beim Werden zuzuschauen.
Er ist der Mann, den alle kennen. Zumindest dem Gesicht nach - beim Namen, wie gesagt, sieht es anders aus: Der im vergangenen Jahr im Alter von 91 Jahren fast schon unerwartet von uns gegangenen Schauspielers (wenn sich jemand als unsterblich entpuppen sollte, dann ja wohl Stanton!) war fast stets in der zweiten Reihe platziert. Von diesem Ort aus bildet er so etwas wie eine heimliche Signatur des Kinos der letzten, sagen wir, 60 Jahre. Wer Stantons Filmografie durchgeht, staunt, mit welchem Spürsinn der ewige Nebendarsteller dort aufzuschlagen vermochte, wo es interessant zu werden versprach (und wo es schlussendlich doch nicht interessant wurde, stimmte, so hoffen wir, wenigstens die Kasse). Er war überall: Vom Western des klassischen Hollywoods aus fand er über Hitchcock seinen Weg zu New Hollywood, drehte dort mit Paul Newman, war bei Sam Peckinpah, Francis Ford Coppola und Monte Hellman dabei, ließ sich dann, als der Blockbuster sein Haupt erhob, für Ridley Scott vom Alien fressen, wurde in den 80ern der Vater von Molly Ringwald und stand vor John Carpenters Kamera, bis ihn schließlich David Lynch für sich entdeckte, der ihn sich als geheime Muse hielt. Und ja, natürlich, auch der unvermeidliche Wim Wenders hatte Wind davon bekommen, dass Harry Dean Stantons Antlitz jeder Leinwand gut ansteht.
Kurz: Eine Art Elder Statesman des Kinos, wie es sie kaum noch gibt, vergleichbar dem späten Johnny Cash vielleicht - beide immerhin Gods of Choice jenes geschmackssicheren Indie-Milieus, das seit den 90ern für Pflege und Politur der Restbestände der alten Bohème-Kultur zuständig ist. Mit seinem rustikalen Charme, seiner renitenten Lebemann-Art hatte Harry Dean Stanton hier seine Fans gefunden. Nur Hauptrollen gab es eben kaum - was den heiligen Bedürfnissen eines alten Schauspielers, der seine Tage lieber mit Alkohol, Rauchen, Ungekämmt-Sein und Pflege seiner rostigen Stimmbänder verbringt, statt dem Jet-Set hektischer In-Crowds anzuhängen, vielleicht auch entgegen kommt.
Umso mehr muss man John Carroll Lynch dafür danken, dass er mit "Lucky" Harry Dean Stanton nun buchstäblich in letzter Sekunde - Stanton starb wenige Wochen nach der Weltpremiere - noch rasch ein filmisches Denkmal gesetzt hat. Lynch, nicht verwandt mit dem berühmteren David selben Familiennamens (der in "Lucky" im übrigen eine schöne Nebenrolle hat), entspringt dabei selbst jener Indie-Saviness, von der Stanton seit den 90ern zehrte: Am ehesten kennt man ihn wahrscheinlich als den leicht tumben Bullen Norm, den Ehemann der Polizistin Marge, gespielt von Frances McDormand, die gerade mit dem Oscar ausgezeichnet wurde und ihn im nächsten Jahr für ihre allseits gefeierte Dankesrede wahrscheinlich gleich noch einmal erhält.

Gut, "Lucky" also. Schon wieder kein Name, sondern ein Zustand: Harry Dean Stanton ist tatsächlich Lucky, nämlich sowohl vom Leben geküsst als auch der rüstige Rentner, der auf diesen Rufnamen hört. Sein Leben besteht aus liebgewonnenen Routinen, mit denen die mechanische Montage zu Beginn vertraut macht: Aufstehen, Radio, Morgenhygiene, Gymnastik, karges Kaffee-Frühstück, kleine Einkäufe, Fernsehen am Nachmittag, abends in die Kneipe zu den Anderen, die das Leben dort als Strandgut angespült hat. Und das Ganze irgendwo im Nirgendwo einer us-amerikanischen Kleinstadt-Einöde, in der die Wüste ringsum frisst, was an Landschaft sonst zu sehen wäre.
Es geht also: um die schildkrötenartig-runzlig-faltige Renitenz eines knorrig-alten Körpers - von Stanton mit selbstverständlicher Selbstsicherheit präsentiert -, der schlicht das Sterben vergessen hat. Bis ihm ein Sturz aus der Routine holt, was Lucky schlagartig bewusst macht, dass es keineswegs selbstverständlich ist, dass auf jeden Tag einfach nur ein weiterer folgt. Ein existenzieller Schock, der eine Krise auslöst - soweit sich bei so einer alten Eiche, die bis dahin verschmitzt-lakonisch durchs Leben ging, von Schock und Krise sprechen lässt. Für ein geflüstertes "I'm afraid" immerhin reicht es.
"Realism is a thing", diese Erkenntnis haut Fernsehquiz-Obsessionist Lucky relativ früh im Film viel mehr aus den Socken. John Caroll Lynchs Sache ist lakonischer Realismus, zum Glück, hingegen nicht: Immer wieder verkriecht sich der Film ins Verschrobene oder öffnet allegorische Räume, die nur in Luckys Vorstellung existieren. Dazu gibt es absurde Dialoge über Roosevelt, bei dem es sich allerdings nicht um einen Präsidenten handelt, sondern um eine Schildkröte. Die Lynch, diesmal nun aber wirklich David, zu Beginn ausgerissen ist und im Zuge des Film in absentia (weitgehend jedenfalls) zu so etwas wie einem heimlichen Seelenpartner Luckys wird.
Riecht alles ziemlich, wie Stanton ja auch selbst, nach jener von Americana durchzogenen Form des Offbeat-Kinos, das in den 90ern eine Weile lang das interessantere US-Filmschaffen darstellte (welches sich damals, wir erinnern uns mit Grausen, viel zu oft in wenig interessante Blockbuster oder dümmlichem Arthaus-Oscar-Fare kunstgewerblich aufstellte) und heute eigentlich kaum noch existiert. Was vielleicht auch besser so ist, da alles seine Zeit hat - schön ist diese Reprise dennoch: Weil sie Harry Dean Stanton eben tatsächlich nochmal die Bühne bietet, die er vor dem letzten Vorhang ganz für sich allein verdient hat.
Lebensphilosophie-Schmalz aus dem Kalendersinnspruch-Gewerbe bietet "Lucky" gottlob nicht. Vielmehr bleibt der Film, was das betrifft, aufs Erfreulichste erkenntnis- und zweckarm. Nicht der Sinnspruch, der die Widersprüche des Lebens einebnet, steht hier als Fazit, sondern die Absurdität des Lebens, des Geworfen-Seins in die Welt selbst. Und Stanton, ganz Lucky, nutzt diese Bühne des Absurden auf umwerfend unverschämte Weise für sich selbst. Am Ende blickt er zurück und dabei uns an, grinst auf seine unnnachahmliche Art in die Kamera, wendet sich um und stiefelt in aller Seelenruhe zum Horizont, ein lonesome Cowboy ohne Pferd - aus dem Bild und aus dem Leben mit ihm. Was für ein Schauspieler, was für ein Abgang.
Thomas Groh
Lucky - USA 2017 - Regie: John Carroll Lynch - Darsteller: Harry Dean Stanton, David Lynch, Ron Livingston, Ed Begley Jr., Tom Skerritt, Beth Grant - Laufzeit: 88 Minuten.
---

Dr. Paul Kersey (Bruce Willis) ist liebender Ehemann und Vater und arbeitet als Chirurg in der Notaufnahme eines Krankenhauses in Chicago. Als bei einem Raubüberfall seine Frau Lucy (Elisabeth Shue) ermordet wird und seine Tochter Jordan (Camila Morrone) im Koma landet, beschließt er, in den Straßen der Stadt auf Ganovenjagd zu gehen.
Was Michael Winners Original-"Death Wish" aus dem Jahr 1974 ideologisch besonders unsympathisch machte, sucht man in Eli Roth' Neuauflage des Stoffes glücklicherweise vergeblich. Dort ging es nicht nur um Selbstjustiz, die politische Agenda des Films schloss auch eine affirmative Haltung gegenüber der Todesstrafe ein und eine weitere Liberalisierung der Waffengesetze. Diese weiteren Themen fallen bei Roth komplett weg, beziehungsweise werden mit einem kurzen Witz abgehandelt. Bleibt die Sache mit der Selbstjustiz.
Kersey wird eingeführt als jemand, der nicht so leicht aus der Ruhe zu bringen ist, der lieber eine schwere Demütigung hinnimmt als zuzuschlagen. Also muss schon das schlimmste eintreffen, was einem family man wie ihm passieren kann, damit aus dem täglichen Retter, der weiter seinem Job nachgeht, ein nächtlicher Rächer wird.

Roth macht aus diesem Stoff einen so derben wie eigensinnigen Splatter-Film. Der freilich die reaktionäre Agenda der Vorlage auf vielfache Weise ironisch brechen muss, um sie durch eine einfache Dialektik zwischen den "guten" und den "bösen" Persönlichkeitsanteilen der Filmfigur Paul Kersey zu ersetzen. Roth erreicht das dadurch, dass er das macht, wofür er bekannt ist: rumsauen. Der Film übersteigert die Gewalt ins Groteske, macht sie dabei aber nicht komensurabel. Das Lachen bleibt einem im Halse stecken. Denn wer guckt schon gerne dabei zu, wie sich ein Mann eine tiefe Wunde mit einem Tacker verarztet?
In seinem aufgrund des Stoffes und der Besetzung der Hauptfigur kommerziell erfolgsversprechendsten Film eignet sich Roth die gängigen psychologischen Deutungsmustern des Hollywoodmainstreamkinos nur an, um sie zugleich in subversiver Absicht überzuerfüllen: Kersey kommt aus einer gefährlichen Ecke der Stadt, er ist ein Mann, der sich nach oben arbeiten musste, der ein ambivalentes Verhältnis zu seinem Bruder hat und einmal die Woche brav zu seiner Therapeutin geht, die im Verlauf des Films große Fortschritte in seiner Befindlichkeit bemerkt. Die Frage, wie ernst der Regisseur von "Hostel 2", einer nicht sonderlich subtilen Satire auf die neoliberale Weltordnung, das meint, stellt sich dabei nicht. Entscheidend ist allerdings, welcher Form der Ironie sich der Film bedient.
Frei nach John Wayne könnte man sagen, dass Kersey tun muss, was er glaubt, als Mann tun zu müssen. Genau wie in Michael Winners Original. Nur war der eben von Anfang an der rechte Wolf im linken Schafspelz, aus dem sein innerer Zwiespalt nur mit den gängigen Mitteln des 1970er-Jahre-Brutalokinos herausgekitzelt werden musste. Bei Roth dagegen Ist, wenn nach allerlei blutigen und unvorhersehbaren Volten Jordan aus dem Koma erwacht, noch längst nicht alles gut. Aber der Film ist vorbei. Auf den nächsten Film von Eli Roth bin ich sehr gespannt.
Nicolai Bühnemann
Death Wish - USA 2018 - Reige: Eli Roth - Darsteller: Bruce Willis, Vincent D'Onofrio, Elisabeth Shue, Camila Morrone, Nean Norris, Beau Knapp - Laufzeit: 107 Minuten.
Kommentieren