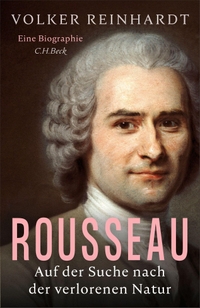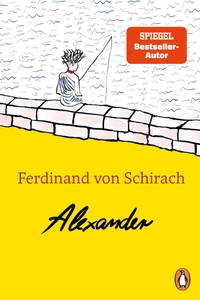Im Kino
Ausgerechnet Stromboli
Die Filmkolumne. Von Robert Wagner, Jochen Werner
15.07.2020. Marjane Satrapis Biopic "Marie Curie - Elemente des Lebens" betrachtet die wissenschaftlichen Leistungen der Forscherin Marie Curie nur auf einem Basislevel. Für die Details ihrer Arbeit, für das Was und das Wie entwickelt der Film kein Interesse. Was bleibt, ist das Bild einer Streberin. Es wird Zeit, Justine Triet als herausragende Autorin des französischen Kinos zu entdecken: Ihr Film "Sibyl" beschreibt einen abgründigen weiblichen Tanz zwischen manischen Stimmungslagen.
Vier Leute sitzen an einem Tisch. Zwei sind kommende Nobelpreisträger, Marie Curie (Rosamunde Pike) und ihr Ehemann Pierre (Sam Riley). Ihnen gegenüber sitzt eine naturwissenschaftlich unbedarfte Frau, welche die beiden ausfragt, um zu verstehen. Ihrem Mann, Mitarbeiter der Curies, ist ihr Unwissen sichtlich peinlich. Die beiden Koryphäen beteuern aber, dass die Fragen völlig in Ordnung sind und erklären möglichst simpel. Es kann ja nicht jeder ein Ass in den Naturwissenschaften sein. Das ist ein Moment, in dem Marjane Satrapis Biopic "Marie Curie - Elemente des Lebens" in Metagefilde vordringt. Nicht etwa, weil an der Stelle potentiell unkundigen Zuschauern die Arbeit der Hauptfigur(en) mit möglichst allgemeinen Erklärungen nähergebracht und ihnen versichert wird, dass sie keine Experten sein brauchen. Sondern, weil der Film sich in dem Laienblick der Frau selbst bestätigt: Mehr als dieses Basislevel braucht es nicht.
Die erste Hälfte des Films ist von Einstellungen bestimmt, die mit unzähligen Erlenmeyerkolben im Vorder- und/oder Hintergrund vollgestellt sind. Außerdem fällt in jedem zweiten Satz das Wort "Science", ein Wort, mit dem jegliche Spezifik großräumig umschifft wird. Wir sehen, wie sich Marie Curie an groben Erzen abschuftet, bevor sie gemeinsam mit ihrem Mann verkündet, dass zwei neue Elemente gefunden wurden. Vor den Offiziellen der Sorbonne stellen sie ihre Ergebnisse vor - Radioaktivität ist entdeckt - und alles bleibt noch unbestimmter als am Tisch mit der Laienehefrau. Der stürmische Applaus ist ihnen trotzdem sicher. Mit groben Mitteln wird vermittelt, dass hier ernsthafte, schwerwiegende Wissenschaft betrieben wird. Für Details der Arbeit, für das Was und das Wie entwickelt "Marie Curie" nie ein Interesse.
Gleichwohl stellt Satrapi das Leben Marie Curies in diverse Zusammenhänge. In einer von Männern dominierten Welt der Wissenschaft muss sie bestehen. Immer wieder steht sie dann vor älteren Herren, die ihr nicht die Anerkennung zukommen lassen, die ihr gebührt, die sie nicht in ihrer Arbeit unterstützen, die ihr bei Erhalt des Nobelpreises den Applaus verwehren. Genauso wird ihr Pragmatismus einer gefühlsbetonten bis bigotten Gesellschaft gegenübergestellt. Nur ein paar wenige sonnendurchtränkte Minuten gönnt der Film ihrer Heirat mit Pierre und der anschließenden romantischen Stimmung. Wenn eine Affäre ans Licht kommt, die für sie lediglich Notwendigkeit ist, steht sie öffentlich am Pranger einer engstirnigen Moral. Gleichzeitig führt die Erkenntnis über die starke Gesundheitsgefährdung durch die von ihr entdeckte Radioaktivität dazu, dass sich die polnische Immigrantin rassistische Anfeindungen gefallen lassen muss. Die schreiende Meute auf der Straße, sie eingesperrt in ihrer Wohnung hinter Fenstern. Dazu kommen noch Einschübe zu den historischen Folgen ihrer Forschung: Krebsbehandlung, Hiroshima, Tschernobyl. Viel geschieht, viel wird angerissen, aber all diese Dinge den gröbsten Allgemeinplätzen zu entreißen, versucht Satrapi nicht einmal.

Zu Beginn leuchten die Bilder in einer zum Impressionismus der Zeit passenden Farbigkeit - in einem gesetzten, zur Sachlichkeit passenden Maß freilich. Zunehmend setzt sich dann jedoch ein giftiger Grünton durch, der die Bilder und den Film zu dominieren beginnt. Der Horror, jemanden zu beobachten, der nicht weiß, dass er sich etwas Krankmachendem und Tödlichem aussetzt, ist das Grundmotiv des Films. Zuerst zielt der Horror auf die Radioaktivität selbst, später springen die Gesellschaft, der Tod Pierres und der krankhafte Wille zur absoluten Unabhängigkeit Marie Curies dafür ein. Schleichende Krankheiten, die trotz ihrer Allgegenwart eher nagende, als offene Konflikte darstellen.
Die Marie Curie des Films möchte einfach nur forschen, doch sie wird ausgebremst. Durch Chauvinismus, Rassismus, Ignoranz - und die Liebe. Letzteres ist das einzige Hindernis, welches sich in ihr selbst findet. Dieser Liebe zu Pierre wird motivisch eine Tänzerin anbei gestellt. Grell leuchtet sie, wenn sie sich auf ihrer Bühne dreht. Die Erkenntnisse der Wissenschaft werden durch sie in künstlerische, irreale Zusammenhänge überführt und ihr Theater ist es auch, in dem Marie und Pierre bei einem Kuss von raumgreifenden Flammen umschlungen werden. Die Präsenz der Tänzerin sorgt für die schönsten Momente des Films. Marie aber versteht nicht, was es mit diesen Performances, mit Poesie auf sich hat, wie sie auch nicht versteht, wie sie mit ihrer Liebe umgehen soll. Fast scheint es, dass sie die Radioaktivität erforscht, weil diese leichter zu enträtseln ist. Zerstörerisch ist aber beides für sie. Nach Pierres Tod ist auch die Tänzerin verschwunden und der Film schneidet von einer verlassenen, hysterischen Marie auf Tschernobyl. Subtil ist "Marie Curie" wahrlich nicht.
Das Schauspiel ist hölzern und definiert sich größtenteils über artifizielle Requisiten. Allein Sam Rileys angeklebter Bart hat mehr Präsenz als das sonstige Anspielen gegen das ungelenke Drehbuch. Dass Rosamunde Pike zum klassischen Fall einer bildhübschen Hollywoodschauspielerin wird, die agiert, als sei sie nicht bildhübsch, passt ins Bild. Wie ein Fremdkörper fühlt sie sich an, der in klobiger Garderobe überfordert diesen Schnipseln einer Biografie Leben einhauchen möchte. Ihre Marie Curie ist vor allem verunsichert und widerspenstig. Gegenüber ihrer Umwelt befindet sie sich meist sofort in einer Verteidigungshaltung, die der Film mehr schlecht als recht durch ein kindliches Trauma erklärt. Gegen jede Diskussion bellt sie an. Mit anderen Menschen ist sie nicht mehr, was sie ansonsten ausmacht: rational.
Die Dramaturgie - auf den wissenschaftlichen wie privaten Erfolg folgt eine tiefe Krise, aus der reißt sie sich schlussendlich heraus und kommt mit sich ins Reine - wird ihr dabei ebenso wenig habhaft, wie das grüne Licht. Dass sie sich gegen jeden Zugriff verbarrikadiert, ist das sprechendste Bild des Films für den Schmerz, ein Außenseiter zu sein, beziehungsweise was es heißt, eine Frau und Naturwissenschaftlerin zur vorletzten Jahrhundertwende gewesen zu sein. Mit etwas mehr Wahnwitz hätte "Marie Curie" in seiner Verknüpfung von Strahlung, Liebe und seelischer Verkrüppelung voller Charme sein können. Doch anders als seine Hauptfigur schreckt Satrapi vor jeglichem Engagement zurück. Immer wieder wird auf Versatzstücke aus dem Biopic-Werkzeugkasten zurückgegriffen. Es bleiben leere Gesten. Das Gefühl, sich in einem unmotivierten Physik- oder Chemieschulvortrag zu befinden, einen Vortrag über prähistorische Streber, lässt sich nur bedingt abschütteln.
Robert Wagner
Marie Curie - Elemente des Lebens - GB 2019 - OT: Radioactive - Regie: Marjane Satrapi - Darsteller: Rosamund Pike, Sam Riley, Harriett Turnbull, Simon Russell Beale, Sian Brook - Laufzeit: 109 Minuten.
---

Eins der zentralen Motive, die die ersten beiden Filme der französischen Regisseurin Justine Triet miteinander verbindet, ist das des verzweifelten Babysitters. Immer wenn Triets Protagonistinnen heimkommen, was angesichts ihrer beruflichen Überforderungen selten genug und meist hoffnungslos verspätet und bereits in Eile angesichts des nächsten Termins geschieht, warten da eine verwüstete Wohnung, zwei bestenfalls notdürftig bekleidete Mädchen im Kleinkindalter und vorwurfsvolle Blicke der nicht weniger überforderten jungen Männer, die von den Laetitias oder Victorias eher als Vollzeitbetreuer denn als Kurzfristaushilfen betrachtet werden und die die Töchter auch schon einmal, auf der Flucht vor potenziell gewalttätigen Kindesvätern, zu Großkundgebungen an Wahlabenden schleppen müssen, während die alleinerziehenden Mütter ihren Jobs als TV-Reporterin nachgehen.
Die Grundstimmung von Triets in Frankreich gefeiertem und in Deutschland nahezu unbekanntem Debüt "La bataille de Solferino" wie auch ihrer mittels deutschem Untertitel etwas hilflos als Boulevardkomödie vermarkteten zweiten Regiearbeit "Victoria - Männer und andere Missgeschicke" ist eine leicht manische und sehr neurotische Hektik, mit der ihre Heldinnen durch Berufs- und Familienleben und meist extreme Gemütszustände schlittern. Ihr dritter Film stellt dieses Manische zunächst einmal in einer vermeintlichen Stabilisierung seiner Titelheldin Sibyl still, was durch eine Art Perspektivverschiebung erreicht.
Am Ende von "Victoria" stand die Hauptfigur, die zuvor als Anwältin durch einen angerissenen Gerichtsfilmplot um einen absurden Mordfall, in dem ein Schimpanse und eine große Dogge eine Rolle spielten, getrieben wurde, vor ihrem Ex-Klienten und Ex-Babysitter, einem Ex-Drogendealer, und rang um zwei Minuten innere Ruhe, um diesem ihre Liebe zu erklären, nachdem sie in den 90 Minuten zuvor mithilfe eines Psychotherapeuten (und einer Hellseherin) versucht hatte, irgendeine Form von Struktur in das heillose Chaos ihres Lebens zu bringen. In "Sibyl" ist nun die erneut famose Hauptdarstellerin Virginie Efira selbst Therapeutin, und ihr fällt die Aufgabe zu, ihrer irrlichternden Patientin Margot (Adèle Exarchopoulos) etwas Stabilität zu vermitteln. Das geht, man ahnt es bereits, nicht lange gut.

Ein weiteres Motiv aus dem Vorgänger taucht erneut und gespiegelt auf: Wo Victoria noch unter ihrem Ex-Mann litt, einem Schriftsteller, der kaum verfremdet und unter der Fahne der Kunstfreiheit vertrauliche Details aus Victorias Prozessen in seinem Blog veröffentlicht, da verarbeitet Sibyl nun selbst Margots Geschichte zu ihrem Debütroman weiter. Das verblasst hier allerdings zur Anekdote am Rande und ist auch Margot selbst eigentlich völlig egal. Sibyl verliert zunehmend die professionelle Distanz, findet sich alsbald bei den Dreharbeiten zu einem von der sehr überspannten deutschen Regisseurin Mika (Sandra Hüller) inszenierten Europudding-Arthousefilm auf (ausgerechnet) der Vulkaninsel Stromboli wieder und gerät dort selbst in das Liebesdrei-, beziehungsweise dann -viereck, das sich zwischen Margot, Mika und dem Schauspieler Igor (Gaspard Ulliel) entspannt.
Leider ist dieser Teil des Films der schwächste, wirkt doch das ganze Film-im-Film-Szenario selbst im ohnehin nicht gerade an psychologischem Realismus orientierten Kinokosmos Triets etwas arg gewollt herbeigeschrieben. Der folgende Absturz nebst Rehabilitation Sibyls, die bereits den gesamten Film über als trockene Alkoholikerin mit der Sucht und sich selbst rang (in "Victoria" wollte die konsultierte Hellseherin ihrer Klientin noch hartnäckig eine Sucht unterschieben, von der diese nichts wissen wollte), macht aber wieder eindrucksvoll deutlich, auf wie dünnem Eis sämtliche Protagonistinnen Triets immer weiter und weiter hetzen, und wie dunkel die Abgründe sind, die darunter lauern. "Sibyl" endet mit einer Art Epilog und dann doch abrupt, von tiefer, dunkler Ambivalenz durchdrungen, die zunächst durch viele kleine und dann den einen, tiefen Riss im Eis in den nur sehr oberflächlich betrachtet komödiantisch-harmlosen Stoff eindringt.
Wie genau Triet diesen Tanz zwischen manischen Stimmungslagen erzählt, das ist immer eigenwillig, immer eindrucksvoll und in diesen spezifischen emotionalen Färbungen und Kontrasten einzigartig im kontemporären Kino, und auch wenn "Sibyl" ein nicht ganz gelungener und selbst zwiespältiger Film ist: es wird Zeit, Justine Triet als herausragende Autorin des französischen Kinos zu entdecken.
Jochen Werner
Sibyl - Frankreich 2020 - Regie: Justine Triet - Darsteller: Virginie Efira, Adèle Exarchopoulos, Gaspard Ulliel, Sandra Hüller, Laure Calamy - Laufzeit: 100 Minuten.
Kommentieren