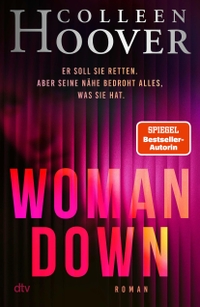Im Kino
Heldenkörper im Gegenlicht
Die Filmkolumne. Von Lukas Foerster, Nikolaus Perneczky
20.03.2014. Brutalstmöglich befreit Peter Berg das Kriegsfilmgenre in "Lone Survivor" von allen Ambivalenzen. In Mira Fornays Antiziganismusdrama "My Dog Killer" behält - möglicherweise - der Beißreflex das letzte Wort.
Wie sehr man sich daran gewöhnt hat, dass Kriege im Kino im Modus der Ambivalenz verhandelt werden, bemerkt man vielleicht erst, wenn ein Film mit diesem impliziten Konsens bricht. Womit nicht gesagt werden soll, dass die vielen anderen, politisch verhältnismäßig komplex argumentierenden Kriegsfilme, die in den USA und anderswo in den letzten Jahren produziert wurden, nicht auf mehr oder weniger eindeutige ideologische Gehalte hin dekonstruiert werden könnten. Aber dafür sind interpretatorische Anstrengungen notwendig - und durchaus auch eine interpretatorische bias, die idealerweise mitreflektiert werden sollte.
Jetzt aber "Lone Survivor", inszeniert von Peter Berg, der spätenstens seit "Hancock" (2008) zu den schlechtesten Big-Budget-Regisseuren Hollywoods zählen darf. Sein neuer Film macht schon im videoästhetisch hässlichen Prolog (und erst recht im noch viel blöderen Epilog…), in dem die Jungs von Nebenan zu betörend flächiger Musik bei der soldatischen Ausbildung und der Körperstählung gezeigt werden, klar, worum es geht: um ein Heldendenkmal; wobei das mit dem "denk" im -denkmal nicht allzu ernst genommen werden sollte. Der ältere Ausdruck "Heldenmal", ohne "denk", trifft es besser, auch, weil da die Verletzung, die Wunde mitschwingt, die in "Lone Survivor" noch einmal lustvoll aufgerissen wird, aber nur, weil das richtige Heilungsmittel eh immer schon bereit steht: in letzter Instanz ist dieses Heilungsmittel Hollywood selbst, sein Starsystem vor allem, die Schmerzen werden durch Übertragung auf andere, geschmeidigere Körper gelindert, die Wunden endgültig zugenäht.
Wenn die Fiktion übernimmt, werden die Bilder sofort slick, Afghanistan sieht super aus, ein perfekt ausgeleuchteter Abenteuerspielplatz; ansonsten ändert sich nicht viel, den patriotischen Auftrag haben eh alle Beteiligten internalisiert, die Kameraführung bleibt sinnfrei hektisch, die Jungs von Nebenan bleiben die Jungs von Nebenan. Ganz um Ambivalenzen kommt man im Kino nie herum, nicht einmal in "Lone Survivor", zum Beispiel: Die Navy SEALs, die im Mittelpunkt des Films stehen, sind zwar überprofessionelle harte Kerle, eine echte Killer-Elite, aber deswegen noch lange keine tumben Rednecks - sie unterhalten sich über Coldplay-Konzerte und Innenarchitektur, einer hat sogar ein "Anchorman"-Poster über dem Feldbett hängen. Eine andere leichte Irritation: Ihre Gesichtsbehaarung unterscheidet sich nicht grundsätzlich von der der Taliban-Kämpfer, auf die sie angesetzt sind.
Die entscheidende Differenz zu anderen Kriegsfilmen der jüngeren Vergangenheit ist, dass es "Lone Survivor" nicht darum geht, diese Ambivalenzen aufzufalten, sondern darum, sie stillzustellen, in fast schon religiös überformten Bewegungs- und Schmerzensbildern. Der Film ist um eine einzige, hoffnungslos überproduzierte, endlos zerdehnte Actionszene herum gebaut, auf die die Erzählung ohne Umwege zusteuert: Nachdem die Soldaten lange genug als ideale Schwiegersöhne vorgeführt wurden, erhalten einige von ihnen, unter ihnen Marcus Luttrell (Mark Wahlberg), den Auftrag, den Toptaliban Ahmad Shah zu exekutieren. Bevor sie aktiv werden können, begegnen sie im Wald unweit eines Dorfes drei Ziegenhirten.

"Operation Red Wings", die Kriegsepisode, auf der "Lone Survivor" basiert, wurde 2005 in der amerikanischen Presse ausführlich behandelt: Die Soldaten ließen die Hirten am Leben, im Wissen, damit nicht nur ihre Missionsziel, sondern auch ihr Leben zu gefährden. Luttrell, der einzige Überlebende des anschließenden Gefechts mit Talibankämpfern, wird nicht müde, diese Entscheidung zu bedauern - unter anderem in einem gemeinsam mit Patrick Robinson verfassten Buch, auf dem der Film basiert. Dieser macht nicht einmal allzu viel Aufhebens um moralische Grundsatzfragen, und sich deshalb auch nicht unbedingt mit Luttrells Position gemein. Man merkt aber bald, warum er das nicht tut: Der Punkt ist nicht so sehr, dass in jedem Ziegenhirten ein Terrorist steckt, sondern, dass man diesen Afghanen eben doch an der Nasenspitze ablesen kann, ob sie auf der guten oder auf der bösen Seite stehen - also wird es im Zweifelsfall schon die richtigen treffen.
Aus der sicheren Distanz deutscher Kinosäle sind die Qualen, die der Film bereitet, eh eher ästhetischer Natur. Die erwähnte zentrale Actionszene vor allem: Fünf amerikanische Bartträger werden da von einer unüberschaubaren Zahl afghanischer Bartträger einen Berghang herunter gehetzt, kein Ende nimmt das, nicht das Herumgeballere, nicht die begleitenden dämlichen Sprüche ("I'm the Reaper!") vor allem nicht das Herunterfallen, wieder und wieder krachen die Körper durch Büsche und auf Felsen. Die Kamera kennt nur zwei Modi: entweder ist sie extrem nah dran an den Körpern, aber auf eine ziemlich indifferente Art, die sich nie so recht entscheiden kann zwischen einem fetischistisch-pornografischen Blick auf blutendes Männerfleisch und hektischen Subjektivierungen, Überidentifizierungen, zum-Navy-SEAL-werden; oder sie schwingt sich per Helikopter auf zu Postkartenpanoramen. Was die Kamera nicht kennt: Einstellungen, die Menschen als Handelnde, als Subjekte, als Individuen mit Entscheidungsspielraum zeigen. Besonders schlimm sind die Märtyrerszene, bei denen der Film das eh nur vorgetäuschte Tempo ganz rausnimmt, die Musik anschwellen lässt (das ist eh das einzige, was sie macht, von Anfang bis Ende: schwellen), die eh schon allgegenwärtigen lens flares endgültig Überhand nehmen, die geschundenen Heldenkörper im Gegenlicht verewigt, einbalsamiert werden.
"Gut gemacht" zu sein, bescheinigt ein großer Teil der Kritik diesen Actionszenen. Gott weiß, welche Maßstäbe man anlegen muss, um zu einem solchen Urteil zu gelangen; vielleicht ja tatsächlich dieselben, nach denen Leni Riefenstahl "geniale Bilder" erschaffen hat - und nicht etwa blueprints für besonders armselige Werbeästhetiken und potthässliche Musikvideos. Um nicht falsch verstanden zu werden: Faschomonumental wird es nur selten insgesamt geht es bei Berg stilistisch in eine andere, fragmentarischere Richtung - und so schlimm wie Nazipropaganda ist "Lone Survivor" sowieso nicht, dafür sorgt schon der prollige vibe, der durch den ganzen Film schwingt und der das alles auf ein wenig menschlichere Maße zurecht stutzt (was sich freilich, für sich selbst genommen, auch wieder schlimm genug anhört: "I'm a hard bodied, hairy chested, rootin' tootin' shootin', parachutin' demolition double cap crimpin' frogman. There ain't nothin' I can't do. No sky too high, no sea too rough, no muff too tough."). Aber ein nicht nur als Gesamtprojekt, sondern auch auf der unmittelbaren Erfahrungsebene fast schon überwältigend obszöner Film ist das schon schon, von der ersten bis zur letzten Sekunde.
Lukas Foerster
Lone Survivor - USA 2013 - Regie: Peter Berg - Darsteller: Mark Wahlberg, Taylor Kitsch, Emile Hirsch, Ben Foster, Yousuf Azami - Laufzeit: 121 Minuten.
---

"My Dog Killer" ist ein gewollt kruder Film auf den Fersen eines jungen Skinhead irgendwo in der slowakischen Einöde, ein Film, der sich wie eine miserabilistische Bildersammlung anfühlt. Von der fahrigen Kamera, die den Figuren der Gebrüder Dardenne oftmals im Nacken sitzt, bis zu den Seidlschen Altarbildern des sozialen Elends werden alle im Gegenwartskino verfügbaren Realismus-Optionen angetippt, ohne in eine neue oder auch nur interessante Konstellation zu treten. Ähnliches gilt für die Erzählung: Mehr oder weniger dezent platzierte Erläuterungen zur Lage der Nation - auf Fernsehbildschirmen oder im Gespräch mit einer lamentierenden Nachbarin - stehen neben unlesbaren Gesichtern und (vereinzelt) langen Einstellungen, die wenig mehr wollen, als der Dauer beim Verstreichen zuzusehen. Wiederum bleiben sich die verschiedenen Register weitgehend fremd, scheinen noch da, wo sie in derselben Einstellung vorkommen, seltsam ungestaltet und willkürlich zusammengewürfelt.
Das soll nicht heißen, dass Regisseurin Mira Fornay nicht auch Momente von großer Intensität gelängen - überhaupt ist meine Kritik dahingehend zu relativieren, dass sie auf viel zeitgenössisches Festivalkino anwendbar wäre. Fornays Gefühl für Landschaften und ihre inspirierte Besetzung - Marek die Glatze sieht mit seinen grüngrau leuchtenden Augen aus wie ein rechtsextremes Alien - transportieren den Film über das epigonale juste milieu hinaus, dem er ansonsten nahe steht. Wir begleiten Marek auf dem Weg zu seiner Mutter, die er verachtet, weil sie vor Jahren mit einem Rom durchgebrannt ist, mit dem sie nun ein zweites Kind hat. Damit Mareks Vater, ein ständig besoffener Weinbauer, sein konkursbedrohtes Gut retten kann, soll die alte Familienwohnung, anteilig im Besitz der ausgebüxten Mutter, verkauft werden. Dazu ist ihre schriftliche Einwilligung erforderlich. Es sind diese "Papiere", um deren Beschaffung sich Marek über weite Strecken des Films mit der ihm eigenen Borniertheit bemühen wird.
Unterwegs aufs Mareks Moped entfaltet sich ein Schreckenspanorama des provinziellen Antiziganismus. Der Unterschied zwischen dem Ressentiment der Rechtsextremen und dem - mehrheitsfähigen - der Normalbevölkerung ist, wenn man "My Dog Killer" glauben darf, mit freiem Auge kaum zu erkennen: Nicht ein einziges Mal widerspricht ein Beistehender den Anfeindungen, denen Mareks Mutter und ihr kleiner Sohn auf Schritt und Tritt ausgesetzt sind. Das Verhältnis zwischen Marek und seinem Halbbruder läuft in Fornays Inszenierung immer wieder auf Off-Räume und andere Trennungsarten hinaus. Eine direkte Begegnung scheint kaum mehr möglich, und wo sie sich doch ereignet, stürzt sie den Film in eine Katastrophe.

Eine große, tiefschwarze Dunkelheit fällt dann über das Dorf und, so wird uns zu verstehen gegeben, über das ganze Land - nicht umsonst war "My Dog Killer" die offizielle Einreichung der Slowakei für den Auslandsoscar. Nicht mehr als zehn Minuten dauert diese Nacht der Vernunft; zehn Minuten indes, von denen man sich so bald nicht erholen wird. Was genau vor sich geht, ist im Dunkeln zwar nur schemenhaft auszumachen - als ob das Off auf den Kader übergriffe -, die schreckliche Tonspur aber lässt keine Zweifel. So wie typischerweise bei den Dardennes dreht sich auch hier alles um eine Tat. Das letzte Drittel des Films vergeht hernach aber fast so, als ob sich nichts geändert hätte: Die letzte Einstellung ist die erste. Das wird die eigentliche Provokation von "My Dog Killer" gewesen sein: dass Sühne, Vergebung, Versöhnung nicht einmal mehr als entfernte Möglichkeit bestehen.
Dass der in Osteuropa grassierende Antiziganismus mörderisch ist, wie zuletzt vom Ungarn Benedek Fliegaufs intensivem "Csak a szél" heraufbeschworen, soll einem breiteren Publikum bekannt gemacht werden. Bei allen löblichen Drehbuchabsichten scheinen Fornay aber auch Zweifel gekommen zu sein an der letztinstanzlichen Lesbarkeit des Sozialen. Die realistischen Blickschulen, bei denen sie sich so eklektisch wie unverbindlich bedient, vermögen einiges aufzuschlüsseln an der slowakischen Gegenwart. Etwas bleibt im Dunkeln, for better or worse. Oder soll/will die zentrale, an Sam Fullers "White Dog" erinnernde Hundemetapher - von der Abrichtung zum Beißreflex - am Ende doch das letzte Wort behalten?
Nikolaus Perneczky
My Dog Killer - Slowakei 2013 - OT: Môj pes Killer - Regie: Mira Fornay - Darsteller: Adam Mihal, Marian Kuruc, Irina Bendova, Libor Filo - Laufzeit: 90 Minuten.
Kommentieren