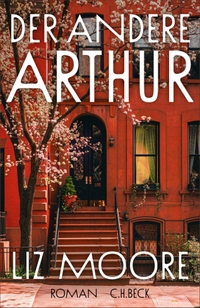Im Kino
Plötzlich ein Hundegesicht
Die Filmkolumne. Von Lukas Foerster, Thomas Groh
11.12.2013. Jose Luis Vallees gleichermaßen faszinierendes und frustrierendes Sozialdrama "Workers" entwickelt eine fast ballettartige Choreografie des Sozialen. Und Tolkiens "Hobbit" wird unter den Anabolika-Muskeln von Peter Jacksons Blockbuster-Maschinerie, die immer nur noch teurere Bilder produzieren will, zu Brei.
Zwei in fast jeder Hinsicht ungleiche Handlungsstränge laufen parallel, ohne Berührungspunkte im Aktuellen, in der Gegenwart; die Verbindungen vermitteln sich über Vergangenes, über Andeutungen: Rafael, der bebrillte, stets ordentlich zurecht gemachte ältere Herr, der in einer Glühbirnenfabrik als Putzkraft arbeitet und, da illegal in Mexiko, von seinem Chef über die Pensionierung hinaus zum Weiterarbeiten erpresst wird, war wohl einst romantisch involviert mit Livia, einer älteren Dame, die als Haushälterin eine grotesk zurechtgeschminkte Patrizierin versorgt. Auf die Verbindung schließen lässt unter anderem ein Tattoo auf Rafaels Oberkörper, ein verkörperlichtes Zeichen, das eine weitere Bedeutung dadurch enthält, dass sein Träger zu Beginn des Films Analphabet ist und also sich selbst, sein eigenes Begehren sogar, nicht entziffern kann.
Der Film folgt Rafael und Livia durch einen Alltag, der zunächst hoffnungslos von Routinen überformt scheint. Vor allem für Rafael heißt das: Routine nicht nur leben, sondern auch (wieder-)herstellen, einen umgeworfenen Putzwagen wieder aufrichten, die Toiletten nach jedem Besuch säubern. Da enthält die strenge Form des Films eine ethische Dimension: Ein Bild stehen lassen, nachdem die Handlung vorbei ist, um zu sehen, was "danach kommt"; und das "danach" ist jene alltägliche Erwerbsarbeit, die das am Spektakulären orientierte Erzählkino in seinem Normalmodus noch fast immer ausspart. Ein wenig anders steht die Sache bei Livia: Man hat von Anfang an den Eindruck, dass das Haustier der Patrizierin, eine Hündin namens "Prinzessin", die wahre Herrin im weniger genuin dekadent, als überdesignt wirkenden Haus (passend zum Film: der zelebriert Exzesse der Form, nicht des Inhalts) ist. Eine Situation, die sich im weiteren Verlauf des Films auf durchaus bizarre Weise zuspitzt.
"Workers" hat bei all dem etwas Schematisches. Der Film versteckt seine Schemata nicht, er stellt sie regelrecht aus, in seinem Verzicht auf jegliche Psychologisierung zum Beispiel, in seiner minimalistischen Gestaltung vor allem, in seiner Präferenz für weite Einstellungsgrößen, für Plansequenzen, für symmetrische Bildgestaltungen, die manchmal ein wenig an die Filme Ulrich Seidls erinnern, ohne allerdings deren klaustrophobische Dimension; aber er verkompliziert sie auch. Zum Beispiel weigert er sich, die beiden Episoden in eindimensionalen Begriffen von Ausbeutung und Entfremdung wieder zu vereinen. Das Kapital trägt, siehe oben, eher groteske als brutale Züge, es stellt sich auch nicht besonders schlau an: Am Ende wird Jose Luis Vallee zwei sehr unterschiedliche Emanzipationsgeschichten erzählt haben. Und mit der Entfremdung ist das auch so eine Sache, wenn der Unterdrückungszusammenhang plötzlich ein Hundegesicht erhält und einen Mitleid heischend anwinselt.

Die eindrücklichste Sequenz des Films treibt Vallees minimalistisches Formenspiel ins Extrem: Fast sechs Minuten lang zeigt der Film einen Straßenzug, in einer starren Einstellung ohne jede Kamerabewegung; nur ganz zu Beginn ist eine der Figuren der Spielhandlung im Bild - Rafael, der eine Prostituierte anspricht und mit ihr in ihrer Arbeitsstätte verschwindet. Anschließend zeichnet "Workers" vorderhand minutenlang nur noch Alltag auf, eine x-beliebige Straßenszene, während es gleichzeitig dunkel wird (ist die rapide Dämmerung eine Markierung der Realzeit? Oder hat der Regisseur auch da nachgeholfen?); eine alltägliche Straßenszene, die allerdings gerade in der Länge ihren hochgradig inszenierten Charakter offenbart, sich in eine fast ballettartige Choreografie des Sozialen verwandelt. Man sieht, wie ein Polizeiwagen die Szene erst entleert, wie sie sich dann, nachdem er aus dem Bild gefahren ist, langsam wieder füllt, man erkennt die interpersonellen Muster eines (vermutlichen) Drogendeals - schwer zu sagen, ob da jemand genau beobachtet und diese Beobachtungen anschließend verdichtet hat, oder ob einfach nur auf Effekt hin ausgewählt und dann ausgiebig geprobt wurde.
Eine der vielen Mikrohandlungen in diesen sechs Minuten besteht darin, dass ein Graffito ergänzt und umgearbeitet wird: Aus "Juana, ich liebe Dich" wird "Juana, ich liebe Dich nicht mehr". Alles ist Form, und alle Form ist lesbar; und auch: alles ist formbar, alles ist umschreibbar. Es ist gerade nicht so, dass das Gefilmte, weil es sich in aller Ruhe entfalten kann, Widerstand leistet gegen die Verfügbarmachung als Material für den smarten Autorenfilmer. Oder gibt es doch einen Widerstand und der Ablauf der Szene beschreibt gerade dessen unendliche Verfeinerung?
Selbst der "Hintersinn" dieser längsten Einstellung des Films (fast ein Film im Film) wird im Nachhinein umgeschrieben: Zunächst musste man annehmen, dass hinter dem Straßenballett und in einem gewissen psychoökonomischen Sinne als dessen unsichtbare Antriebskraft der Sex steckt, den sich Rafael kauft. Später erfährt man, dass sich seine Beziehung zu dem Mädchen zumindest auch andere Dimensionen hat.
Alles ist formbar, alles ist umschreibbar. Am Ende weiß man nicht einmal genau, ob im Lauf des Films ein Jahr oder zehn Jahre vergangen sind. Oder ob zwischen der ersten und der letzten Einstellung tatsächlich nur ein Schnitt liegt. Und ob die unendliche Ver- und Umformung tatsächlich etwas sichtbar macht oder ganz im Gegenteil etwas (aber jeweils: was?) verschleiert, kann man auch am Ende dieses gleichermaßen faszinierenden und frustrierenden Films nicht einmal mit einiger Sicherheit sagen.
Lukas Foerster
Workers - Mexiko 2013 - Regie: Jose Luis Vallee - Darsteller: Jesus Padilla, Susana Salazar, Barbara Perrin Rivemar, Sergio Limon, Vera Talaia, Adolfo Madera - Laufzeit: 120 Minuten.
---

Unterm Goldschatz schlummert der Drache. Noch bevor man das CineStar im Berliner SonyCenter betritt, wo die Pressevorführung von Peter Jacksons zweitem Hobbitfilm stattfinden soll, ist man in Mittelerde, genauer: im Einsamen Berg, in dem ein Drache vor Jahr und Tag eine Zwergenstadt erst ausgeräuchert und dann deren prächtigen Goldschatz in Besitz genommen hat, weshalb nun eine Horde von 13 Zwergen samt Hobbit Bilbo Baggins (Martin Freeman) unter gelegentlicher Begleitung von Gandalf (Ian McKellen) quer durch Mittelerde stapft, um, nunmehr schon im zweiten von insgesamt drei Teilen, zurückzuholen was einst fest in Zwergenhand war. Zur Premiere am Vortag hat die Marketingabteilung was springen lassen: Ein prächtiger Plastikdrache lugt aus einem noch prächtigeren Plastik-Goldschatz, der Schriftzug des Franchise prangt funkelnd über allem. Während einen Steinwurf weiter die Buden vom Weihnachtsmarkt im herbstlich-nassen statt winterlich-romantischen Berliner Dezember ein eher kärgliches Bild bieten, klotzt man im SonyCenter richtig ran mit dem Weihnachtsprunk. Ein Event, ein Film, der sich über die Grenzen des Kinosaals hinaus auf die Stadt legt, der darin aber auch unmissverständlich klar macht: Man kann gegen ihn eh nicht anschreiben. Und man kann es wirklich nicht.
Unterm Goldschatz schlummert der Drache tatsächlich, wenn der Film an seinen Höhepunkt gelangt. Kein Zweifel, Smaug, so heißt der Drache, der von "Sherlock" und gegenwärtigem everybody's darling Benedict Cumberbatch nicht nur gesprochen, sondern per Motion Capture auch gespielt wurde, Smaug also ist, was Animationskunst betrifft, state of the art. Wie eh der ganze Film: Ausstattung, Maske, Effekte - höchste Punktzahl, redlich verdient. Was der Film ausgiebig herzeigt: Auch der zweite Hobbitfilm ist in erster Linie ein Portfolio-Film, ein Demonstrationsobjekt, das redselig vom Stand des derzeit Machbaren kündet. Zuweilen kann das ganz schön sein: Es gibt zum Beispiel tolle, unheimliche Riesenspinnen, die jeden ernsthaften Arachnophobiker glückselige Momente gesteigerten Kinogrusels durchtaumeln lassen. Hier, in diesen Schlaglichtern, in denen es um nichts anderes als um die Freude an hochfrisiertem Schauder und Ekel geht, ist Peter Jackson, der aus dem Splatterfilm kommt, ganz bei sich. Die Freude an grotesken Monsterleibern und wild wuselnden Spinnenbeinen, an denen Zwerge in einem schön beknackten Moment ordentlich rupfen dürfen, überstrahlt um einiges die schal gewordene Lust am Panorama-Shot, den Jackson seit der klassischen "Herr der Ringe"-Trilogie kultiviert und im nachgeschobenen "Hobbit"-Prequel-Triptychon nun ad nauseam betreibt: Der Film hat was gekostet, das soll man gefälligst auch sehen, ruft es von der Leinwand herunter.

Unterm Effektschatz schlummert die Vorlage. Tolkiens "Hobbit"-Büchlein, ein sprachlich gewitztes, märchenhaft keckes Kinderbuch, in dem das schwere Epen-Pathos der späteren "Herr der Ringe"-Wälzer höchstens in Spuren und eher nur als Vorzeichnung zu finden ist, weil es doch nie recht um die ganze Welt, sondern vor allem um die sympathische Sehnsucht nach dem nächsten Frühstück geht, Tolkiens "Hobbit" wird, unter den Anabolika-Muskeln einer freidrehenden Blockbuster-Maschinerie, die immer nur noch teurere Bilder produzieren und projizieren will, gehörig zu Brei. Die Problematik ist altbekannt: Für die "Herr der Ringe"-Bücher mit ihren, was, 1500 Seiten?, hatte Jackson mit neun bis zwölf Stunden (je nachdem, welche Edition der Filme man als gültig erachtet) viel zu wenig, für die schmalen 280 Seiten (inklusive Illustrationen) des "Hobbit" mit neun bis zwölf Stunden eindeutig zu viel Zeit. Da helfen auch eigens erfundene Dreingaben nicht viel: Der Tragödie zweiter Teil will, wie schon Teil eins, gehörig nicht vom Fleck - und zwar buchstäblich. Jedes Set, egal wie wenig von Belang, wird von der wuselnd suchenden 3D-Kamera bis aufs letzte abgegrast, immer findet Jackson noch ein Bild, noch einen Dialog, noch irgendetwas, das längst auserzählten Szenen noch ein bisschen mehr Spielzeit abgewinnen kann. Selbst Smaug gerät zur verquasselten Labertasche, dass man irgendwann auch von der Kunst des allseits gefeierten Stimmenmeisters Cumberbatch die Schnauze voll hat. So breitgetreten wie der ganze Film ist, fühlt man sich am Ende irgendwann auch selbst.
Denn das Schlimmste überhaupt: Unter all diesem Mumpitz schlummert das Herz dieses Films und das Herz eines Filmemachers, dessen Filmografie sich, von wenigen Ausnahmen abgesehen, als große Liebeserklärung ans phantastische Kino lesen lässt. Smaug immerhin darf sich aus seinem Schlummer erheben. Nur das Herz dieses Films bleibt still und leise unter endlos aufgehäuften Reichtümern vergraben und tut nicht einen einzigen Schlag.
Thomas Groh
Der Hobbit - Smaugs Einöde - USA 2013 - Originaltitel: The Hobbit: The Desolation of Smaug - Regie: Peter Jackson - Darsteller: Ian McKellen, Martin Freeman, Richard Armitage, Ken Stott, Graham McTavish, William Kircher, James Nesbitt - Laufzeit: 161 Minuten.
6 Kommentare