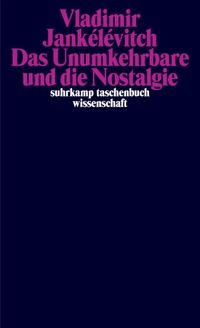Im Kino
Schrift an der vierten Wand
Die Filmkolumne. Von Lukas Foerster, Ekkehard Knörer
04.05.2011. Wes Craven testet mit einem weiteren Sequel die dehnbarkeit der gemeingefährlich selbstreflexiven Horrorfilm-Serie "Scream". Adam Salkys Indie-Adoleszenz-Dramödie "Dare" macht in der Frage der sexuellen Orientierung ihres High-School-Protagonisten weder bei hetero noch bei schwul ein klares Kreuz.
Es fällt einem heute eher schwer, nachzuvollziehen, warum "Scream" einmal, es ist allerdings doch schon wieder ein gutes Jahrzehnt her, ein richtig großes Ding war - nicht nur an den Kinokassen, sondern auch zum Beispiel in den deutschen Feuilletons. Kreischende Jungschauspielerinnen, augenzwinkernd-nerdige Smartness, ein sympathisch tumber Polizist und der Killer Ghostface, dessen herausragende Eigenschaft in seiner Eigenschaftslosigkeit, beziehungsweise in seiner völligen Kontingenz besteht, der also nichts mehr von dem biografischen beziehungsweise psychopathologischen Ballast benötigt, den seine Vorgänger mit sich herumschleppten (und dessen Edward-Munch-Maske dann konsequenterweise von Anfang an vor allem nach einem Merchandise-Artikel aussieht, der bereits innerhalb des Films beworben wird).
Unterm Strich waren das dann drei durchaus unterhaltsame, allerdings stets berechenbare, weil allzu deutlich am Reißbrett entworfene, untereinander außerdem problemlos austauschbare Filme, die selbst in der Filmografie ihres Regisseurs Wes Craven neben Genreklassikern wie A "Nightmare on Elm Street" oder "The Hills Have Eyes" inzwischen eher alt aussehen. Der vierte Teil der "Scream"-Saga, wieder inszeniert von Craven und wieder geschrieben von Kevin Williamson, stellt ein weiteres Mal Sidney Prescott (Neve Campbell, die sich ihre post-"Scream"-Karriere auch anders vorgestellt haben dürfte) in den Mittelpunkt. Sidney hat ihre Rolle als ewiges Ghostface-Opfer inzwischen zu einem Bestseller verarbeitet und kehrt für Promotionzwecke in ihre Heimatstadt Woodsboro zurück. Der maskierte Killer, der sich natürlich schnell wieder an ihre Fersen heftet, scheint es außerdem auf ihre Nichte Jill abgesehen zu haben.
"Scream 4" ist exakt so, wie man ihn sich vorgestellt hat - oder vielleicht eher: wie man ihn sich vorgestellt hätte, wäre er zehn Jahre früher gedreht worden. Also: alles genau wie in den ersten drei Episoden, nur mehr von allem; Entwicklung, Veränderung, Differenz sind dem postmodernen Zitatkino zutiefst fremd. Es fließt mehr Blut (aber glücklicherweise unternimmt Craven nicht den Versuch, mit den Folterknechten der "Saw"-Konkurrenz mitzuhalten), es kreischen mehr scream queens (eine davon sogar, nur kurz am Leben allerdings: Kristen Bell aka "Veronica Mars"), vor allem gibt es mehr Selbstreflexivität. Wie in den Vorgängern werden die "Regeln" des eigenen Genres innerhalb des Films reflektiert und strategisch gebrochen, gefühlte fünfzig Horrorfilmtitel tauchen in den oft doch etwas angestrengt-geekigen Dialogen auf, die Filmreihe-im-Film "Stab" hat das Mutterfranchise längst überholt und ist inzwischen bei Seriennummer Sieben angelangt; neuerdings hat außerdem jede Filmfigur eine eigene Kamera, der Killer wird bei seinen Taten gefilmt und filmt zurück. Die vierte Wand kollabiert fast im Minutentakt.

Das Problem ist allerdings, dass der Film immer sehr genau zu wissen meint, was für eine Art von Zuschauer sich vor dieser befindet. Öffnen tut sich da nichts, statt dessen entstehen geschlossene Kreisläufe. Dass das mehr denn je bild- und mediengesättigte Verweissystem nicht nur ein leeres, blutiges Zentrum, sondern auch ein Außen jenseits des hermetischen Horrorfilmuniversums haben könnte, gerät mehr noch als in den Vorgängern aus dem Blick, auch wenn immer noch gelegentlich zwischen den oneliners das nicht uninteressante Panorama einer amerikanischen Provinzstadt durchscheint. Die Postmoderne frisst ihre Kinder. Spätestens nach diesem vierten Teil dürfte, dafür spricht auch das wenig berauschende Einspielergebnis in den USA, die Scream-Reihe bis auf die Knochen abgenagt sein.
Lukas Foerster
***

Alexa ist straight, Ben ist schwul und Johnny durcheinander dazwischen: "I'm not gay or anything..." Man spielt irgendwo in American-Indietown an der Highschool Theater, "Endstation Sehnsucht", Alexa tutort Johnny, der gegen den ersten Anschein Talent oder jedenfalls schon mehr als Alexa erlebt hat. Bei der nächstbesten Party brezelt Alexa sich auf und entjungfert sich kurz entschlossen mit Hilfe von Johnny, der dennoch erfreut eher nicht weiß, wie ihm geschieht. Das ist das erste Kapitel, Überschrift Alexa.
Kapitel 2: Ben. Der benimmt sich verwuschelt, wie aus einem Mumblecore-Film in diese Indie-Dramödie transportiert und macht keine klaren Ansagen und liest in der Pause Edith Wharton und antwortet auf die Frage: "School or pleasure?": "School, but I also like it." Mit dem nicht unsympathischen jungen Mann, der ihn da anspricht, passiert weiter nichts. Dafür ergibt es sich eines Nachts, dass Ben und Johnny im dunklen Blau am Swimmingpool sitzen und dies und das reden und Ben, bislang ungeküsst, nähert sich Johnny im Wasser, der ihn küsst und dann gibt Ben ihm einen Blow-Job. Es sitzen am Ende dieses Kapitels Ben, Alexa und Johnny selbdritt auf der Couch und sehen dabei mit Bens Eltern fern.
Kapitel 3: Johnny. Der ist aus reichem Eltern-, beziehungsweise Vaterhaus, nach außen hin der Typ Schul-Jock, in Wahrheit schwer durcheinander, nimmt Medikamente, geht zur Therapeutin und bespricht mit ihr, wie das war, mit Ben im Pool. ("Felt cool.") Johnny sucht Liebe, die Familie ist verkracht, Alexa und Ben sind gute Freunde, auf dem Parkplatz der Schule wehrt sich Johnny gegen die Beschimpfung - seine und Bens - als "fag" mit den Mitteln des Stärkeren. Es folgt noch eine alkoholgeschwängerte Sex-Experiment-Party mit der sich allerdings rasch zurückziehenden Courtney, die vom kommenden Superstar Rooney Mara (sie ist die Lisbeth Salander in David Finchers Stieg-Larsson-Verfilmung) gespielt wird. Alles endet vergleichsweise offen.

"Dare" ist ein ehrenwerter Film, der die Konventionen der High-School-Adoleszenz-Dramas in unerwartete Richtungen zu wenden versucht. Zugrunde liegt ein gleichnamiger Kurzfilm vom selben Team (Regie: Adam Salky, Drehbuch: David Brind), aber mit anderer Besetzung, der sich allerdings ganz auf die Swimmingpool-Episode konzentriert. Wacklig balanciert der nun in ein vollgültiges Dreieck mit ambivalenten Ecken aus Freundschaft und Liebe ausformulierte Langfilm auf einem seltsamen Grat und fasst, den überzeugenden Schauspielern zum Trotz, nie richtig Tritt: Er versteht sich als ernst gemeinter Gegenentwurf zu Hetero-Sex-Komödien diesseits und jenseits von "American Pie"; als Indie-Kino, das auf die üblichen Date- und First-Night-Versatzstücke verzichtet, beim Versuch, es besser zu machen, aber von einem ungelenken Moment in den nächsten gerät; als Übung in Ambivalenz, nur dass da oft eher handwerkliche Unsicherheit als gezielte Lust an der Offenheit zugrundezuliegen scheint. Der Ton schwankt beträchtlich zwischen leisen Annäherungen ans Groteske und tief empfundener Adoleszenz-Peinlichkeit. Weil es an jedwedem ästhetischen Ehrgeiz fehlt, bleibt summa summarum wenig mehr als ein aufrechter Indie-Film mit dem Herzen am rechten Fleck - oder jedenfalls in vertretbarer Nähe des Flecks.
Ekkehard Knörer
Scream 4. USA 2011 - Regie: Wes Craven - Darsteller: Neve Campbell, David Arquette, Courteney Cox, Emma Roberts, Hayden Panettiere, Rory Culkin, Nico Tortorella, Marielle Jaffe, Marley Shelton, Mary McDonnell
Dare. USA 2009 - Originaltitel: Dare - Regie: Adam Salky - Darsteller: Emmy Rossum, Zach Gilford, Ashley Springer, Ana Gasteyer, Alan Cumming, Sandra Bernhard, Cady Huffman, Annie Hibbs
Kommentieren