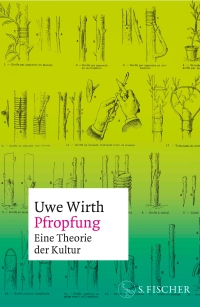Im Kino
Voller Einsatz von Körper und Geist
Die Filmkolumne. Von Lukas Foerster, Jochen Werner
03.01.2013. Auf einen meat and potatoes-Actionfilmhelden heruntergekocht hat Christopher McQuarrie den von Tom Cruise gespielten Titelhelden in der Literaturverfilmung "Jack Reacher". Ulrich Seidls "Paradies: Liebe" macht es einem nicht leicht, Europäer zu sein.
Ein Scharfschütze - dessen Identität der Film verschleiert - verschanzt sich in einem Parkhaus, blickt durch das Zielfernrohr seines Gewehrs auf eine nahegelegene Parkanlage, verfolgt einzelne Menschen mit dem Sucher: eine Geschäftsfrau, die sich zielstrebig in Richtung eines Bürogebäudes bewegt, eine Frau mit Kind auf dem Arm, ein Mann auf einer Parkbank. Dann beginnt er, auf einige dieser Menschen zu schießen: sechs Kugeln, fünf Opfer, ein Fehlschlag.
Mit dieser hochgradig visuellen Szene, in der ein entkörperlichter, analytischer Blick plötzlich umschlägt in totbringende Gewalt, beginnt "Jack Reacher" und zu ihr findet der Film später gleich mehrmals zurück, im Modus der Interpretation. Wie ist diese spezielle Anordnung von Blick und Projektil zu erklären? Wie die (nur auf den ersten Blick willkürliche) Auswahl der Opfer? Wie der Rhythmus der Schüsse? Was hat es mit dem Fehlschuss auf sich?
Diese Art der Interpretation, diese Art der Spurensuche, die nicht einfach nur Indizien nach naturwissenschaftlichen Kriterien aufbereitet (obwohl sie auch dazu in beeindruckender Weise in der Lage ist), sondern daneben auf ein umfassenderes Weltwissen und auf psychologische Intuition zurückgreift, ist eine Spezialität der literarischen Vorlage des Films. Lee Childs mittlerweile 17-teilige Reacher-Serie folgt einem Einzelgänger, einem regelrechten Phantom, auf dessen Reisen durch Amerika. Einst war Jack Reacher ein Militärpolizist, jetzt ist er aus allen bürgerlichen Registern herausgefallen, zieht ziellos von Ort zu Ort - sein einziges Gepäckstück: eine zusammenklappbare Reisezahnbürste - und wird doch auf jeder einzelnen Station in zumeist schwerwiegende Kriminalfälle verwickelt.
"Jack Reacher" ist der erste Versuch, die Serie auf die Leinwand zu übertragen, Ausgangspunkt ist "One Shot", der neunte Roman der Serie, in dem Reacher einen alten Bekannten, einen des Mordes verdächtigten Ex-Soldaten erst ins Gefängnis, wenn nicht gleich um die Ecke befördern möchte, ihm dann aber, nach gründlicher Durchsicht der Beweislage, doch zur Hilfe eilt; selbstverständlich mit vollem Einsatz von Körper und Geist. Vorab sorgte vor allem die Besetzung der Hauptrolle für Irritation und tatsächlich ist die Idee, den bei Child als zwei Meter groß, blond und ansonsten äußerlich eher räudig beschriebenen Helden ausgerechnet mit Tom Cruise zu besetzen, mindestens originell. Ich kann mich in dieser Hinsicht nur anderen Rezensenten anschließend und Entwarnung geben: Cruise macht seine Sache alles in allem gut, weil er noch weniger als sonst den Versuch unternimmt, ein "echter" Schauspieler zu werden, weil sein eindimensionales Minenspiel zum Gespenstischen der Reacher-Figur passt und auch, weil er zumindest sein inzwischen fortgeschrittenes Alter auf interessantere Weise durchscheinen lässt als zuletzt in "Mission Impossible 4".

Die eigentliche Schwierigkeit liegt sowieso an anderer Stelle: Wie Ekkehard Knörer jüngst in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Cargo ausgeführt hat, schreibt Child nicht einfach dynamische Bewegungs-, sondern analytische Gedankenprosa. So großartig die knochenharten Actionsequenzen der Reacher-Serie auch sind, weitaus wichtiger für die Bücher ist ihre Vorbereitung, Reflexion und Einbettung im welt- und psychendurchdringenden "Jack Reacher state of mind", für den das Visuelle eben nur eine unter vielen erst einmal gleichwertigen Informationsquellen darstellt.
Der bislang hauptsächlich als Drehbuchautor in Erscheinung getretene Regisseur Christopher McQuarrie ("The Usual Suspects", "Valkyrie") versucht eigentlich nur in der oben beschrieben Sniper-Sequenz und ihren Wiederaufnahmen später im Film ernsthaft, diesen "Jack Reacher state of mind" dann doch wieder ins Audiovisuelle zu übertragen. Und dieser eine Versuch gelingt eigentlich ziemlich gut. Es ist auch deswegen etwas schade, dass der Film ansonsten kaum an diesen Aspekt der Vorlage anschließt, sondern sich darauf beschränkt, die plot points des Romans halbwegs ökonomisch auszubreiten - wobei dann doch einige entscheidende Verkomplizierungen wegfallen und das Ganze zumindest der Tendenz nach in eine handelsübliche Vigilante-Erzählung umgebogen wird, Jack Reachers auf mehreren Ebenen mit dem Gesellschaftsinneren verschaltete Außenseiterperspektive hinter dem generischen Rächer, der aus dem Nichts kommt, verschwindet.
Andererseits hätte eine ambitioniertere, "literarischere" Verfilmung (zum Beispiel eine mit einem eigentlich naheliegenden durchgängigen voice-over-Kommentar) auch sehr leicht komplett scheitern können. McQuarrie wählt die meat and potatoes-Variante und ist darin fast schon wieder wagemutig altmodisch. "Jack Reacher" beginnt zwar "Drive"-mäßig mit der Großaufnahme einer Hand, die einen Schaltknüppel ergreift und setzt in einem fort allzu stylische, vielzylindrig röhrende Automobile ins Bild (selbst der drittklassige Meth-Koch fährt eine edle Hochglanz-Karosse), ist aber ansonsten eine erfreulich unfetischistische Angelegenheit; dem Oberflächenglanz zum Trotz wird "Jack Reacher" von einem soliden und noch nicht einmal besonders hochtaktigen narrativen Motor angetrieben (in den unter anderem noch Wernern Herzog und Robert Duvall eingespeist werden, was zumindest im Fall des letzteren ausgezeichnet funktioniert).
McQuarries Adaption mag Childs Protagonist zwar auf mehreren Ebenen nicht gerecht werden - als no-nonsense-Action- und hochprofessionelles Starkino ist sie aber vielleicht genau die Art von Film, die Jack Reacher gefallen würde. "And whatever else he was, Reacher knew he was a rational man", heißt es einmal in Die Trying, dem zweiten und vielleicht besten Band der Reihe.
Lukas Foerster
---

Es gibt im kontemporären Weltkino wohl keinen kompromissloseren Chronisten des alltäglichen Horrors als den Österreicher Ulrich Seidl. Ob in Vereinen organisierte Freizeitparkfans, erotomanische, von Senta Bergers Brüsten schwadronierende Muttersöhnchen oder - in Seidls umstrittenstem Film "Tierische Liebe" - Menschen, die ihre Haustiere etwas leidenschaftlicher lieben als von der Gesellschaft gemeinhin akzeptiert: Seidls Blick ist bereits in seinen frühen Dokumentarfilm unerbittlich, er hält die Kamera gnadenlos auf seine zur oftmals unbeholfenen, aber völlig reflexionsbefreiten Selbstdarstellung neigenden Protagonisten, so lange, bis sie sich selbst entlarven, bis all das Grauen aus ihnen hervorbricht, das in einer durchschnittlichen provinziellen Kleinbürgerexistenz und im Laufe eines Lebens so heranwächst.
Vom ohnehin bereits stark künstlerisch geformten Dokumentarfilm zog es Seidl im Verlauf der letzten Dekade zum narrativen Spielfilm, wo er mit "Hundstage" (2001) und "Import/Export" (2007) zwei Höhepunkte des neueren österreichischen Miserabilismus beisteuerte. Unter dem Übertitel "Paradies" erscheinen nun in kurzer Folge gleich drei neue Regiearbeiten Seidls, in denen dieser sich eine Vivisektion der christlichen Zentraltugenden in der (globalisierten) Welt vorgenommen hat: Glaube, Liebe, Hoffnung.
Die Trilogie eröffnet nun, nach der Premiere im Wettbewerb von Cannes, mit dem deutschen Kinostart von "Paradies: Liebe", während der zweite Teil "Paradies: Glaube" bereits in Venedig uraufgeführt wurde und der dritte und abschließende "Paradies: Hoffnung" im Februar im Wettbewerb der Berlinale seine Weltpremiere feiern wird. Dabei bleibt abzuwarten, in welche Richtungen Seidl die Trilogie weiterführen wird - in Sachen Kulturpessimismus, scheint es, ist "Paradies: Liebe" kaum noch etwas hinzuzufügen. Der Film ist ein einziger Blick in die Hölle.

Dieser Blick fällt - jedenfalls ein Stück weit, denn obgleich Seidls Kamera oftmals brutal nah an der furchtlosen Darstellerin Margarethe Tiesel und ihrer wuchtigen Körperlichkeit bleibt, bleibt dies wie jede seiner Inszenierungen vor allem ein Spiel von Nähe und Distanz - durch die Augen der mittelalten, korpulenten österreichischen Pauschaltouristin Teresa, die im Keniaurlaub eine Affäre mit einem afrikanischen Beachboy beginnt. Anders als ihre sextourismuserfahrenen Mitreisenden, die mit dem kapitalistischen Charakter dieser Transaktion - sexuelle Gefälligkeiten und falsche Liebesschwüre gegen finanzielle Zuwendungen der solventen Europäerinnen - bestens vertraut sind, sucht Teresa etwas Anderes. Obgleich sie völlig ungehemmt in die rassistischen, demütigenden (Wort-)Spielchen ihrer Mitreisenden einstimmt, erhofft sie sich von ihrer Liaison mit dem viel jüngeren Munga echte Gefühle, echtes Begehren - wenngleich freilich, wie sie überhaupt schon im Prolog in Österreich als pedantischer Kontrollfreak charakterisiert wurde, zu ihren Bedingungen.
"Paradies: Liebe" ist ein Film, der an die Substanz geht und der sich furchtlos und kopfüber noch in die problematischste Ambivalenz stürzt. Immer wieder nimmt Seidls Kamera den voyeuristischen, kolonialistischen Blick seiner Protagonistin - und vielleicht: Europas - auf Afrika auf, das in diesem Touristenmoloch vor allem in den erotisierten Körpern dunkelhäutiger Bediensteter in Erscheinung tritt. Und Bediensteter scheint die einzige Rolle zu sein, die den Kenianern gegenüber den dickbäuchigen, dümmlich-infam kichernden, rassistische Witze reißenden Urlauberinnen zugestanden wird.
Aus diesem in der Kulturdiagnose von "Paradies: Liebe" völlig ungebrochen sich fortsetzenden kolonialistischen Verhältnis zu Afrika heraus entsteht ein System gegenseitigen Missbrauchs, in dem letztlich jeder in irgendeiner Form zum Opfer wird: Die naive Teresa lässt sich von Munga, der ihr übliche Geschichten von kranken Familienangehörigen und dringend benötigten Arzthonoraren auftischt, nach Strich und Faden ausnehmen. Die Voraussetzungen aber sind grundlegend andere: Munga hat keine Möglichkeit, aus dem System ökonomisch bedingter Zwangsprostitution zu fliehen. Teresa hingegen kann sich einen neuen Beachboy kaufen, diesen in einer kaum zu ertragenden (Beinahe-)Orgiensequenz demütigen - und schließlich wieder nach Wien in ihre spießbürgerliche Häkeldeckchenwelt zurückkehren, als sei nichts gewesen.
Aus dem Film hinaus läuft sie einen morgendlichen, kenianischen Strand entlang, während drei Beachboys Salti schlagen - für sie? Ihr zum Spott? Wir werden jedenfalls zwei Stunden lang durch ihre Augen geschaut haben, werden mit unseren eigenen Voyeurismen und Sterotypen konfrontiert und ausgelaugt und verstört zurückgelassen worden sein. Kein leicht zu ertragender Film, und kein Film, der es sich je leicht macht. Aber ein wichtiger Film. So sehr hat man sich noch selten dafür geschämt, Europäer zu sein.
Jochen Werner
Jack Reacher - USA 2012 - Regie: Christopher McQuarrie - Darsteller: Tom Cruise, Werner Herzog, Robert Duvall, Rosamund Pike, Richard Jenkins, Jai Courtney, Alexia Fast - Laufzeit: 130 min.
Paradies: Liebe - Deutschland, Frankreich, Österreich 2011 - Regie: Ulrich Seidl - Darsteller: Maria Hofstätter, Margarete Tiesel, Inge Maux, Peter Kazungo, Carlos Mkutano, Gabriel Mwarua - Laufzeit: 120 min.
Kommentieren