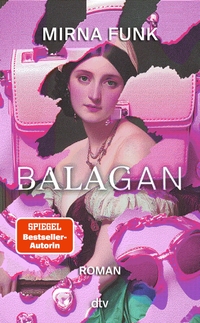Im Kino
Eine gewisse Lieblichkeit
Die Filmkolumne. Von Nicolai Bühnemann, Lukas Foerster
25.09.2018. Warwick Thornton ist mit "Sweet Country" ein historisch-materialistischer Western von beeindruckender Konsequenz und Präzision gelungen. Mit "Offenes Geheimnis" dient sich das Kino des iranischen Exilanten Asghar Farhadi dem internationalen Arthaus-Mainstream an.
Wenn der von Anfang an asozial durch die Gegend polternde Harry Marsh (Ewen Leslie) sich bei dem Prediger Fred Smith (Sam Neill) nach dem Zustand von dessen "black stock" ("schwarzes Vieh") erkundigt und damit ein Aboriginespaar mittleren Alters meint, das für Smith arbeitet, dann ist das nicht nur ein schlagendes Beispiel für die Entmenschlichung, die Rassismus mit sich bringt; sondern es zeigt auch, warum der Western - beziehungsweise in diesem Fall: dessen Adaption an die australische Geschichte und Landschaft - sich besonders gut dafür eignet, von Rassismus zu erzählen. Schließlich ist der Western ein Genre, das sehr direkt vom Verfügen über und Nutzbarmachen von Land und Menschen handelt. In der Welt, die "Sweet Country" zeigt, in den Northern Territories Australiens des Jahres 1929, ist Rassismus nicht nur eine Ausprägung gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit unter anderen, sondern ein direkter Effekt von Ökonomie. "Black stock" - die weißen Australier haben ein geldwertes Interesse daran, die schwarzen, indigenen Australier nicht als gleichgestellt und damit theoretisch als Kontrahenten, sondern als untergeordnet, als dinggleich, als Kapital zu behandeln.
Die historische Gewalt des kolonialen Rassismus tritt einem in "Sweet Country" gewissermaßen in Reinform entgegen, zumindest bis zu einem gewissen Grad unabhängig von Fragen der kulturellen Differenz und der individuellen Moral - also jenen Begrifflichkeiten, mithilfe derer Rassismus in der medialen Gegenwart fast ausschließlich diskutiert wird. Ganz kann der Film das nicht durchhalten, aber am stärksten ist er, wenn er es doch tut; dann wird der zweite lange Spielfilm von Warwick Thornton zu einem historisch-materialistischen Western von beeindruckender Konsequenz und Präzision.
Berückend ist insbesondere der unaufgeregte, gleichmäßige Rhythmus des Films. Die blutige Geschichte um den Aborigine Sam Kelly (Hamilton Morris), der Harry Marsh aus Notwehr erschießt und anschließend von einer Posse durch die Wildnis gejagt wird, entfaltet sich einerseits in geduldiger Seelenruhe, ohne übergriffige dramaturgische Zuspitzungen; andererseits kommt "Sweet Country" nie komplett in einer banal kontemplativen Attitüde zum Stillstand. Thorntons komplexe Erzählmaschine verpflichtet sich außerdem nicht durchweg der linearen Zeitlichkeit. Eingeschoben sind immer wieder einzelne Einstellungen, die auf vergangene oder zukünftige Aktionen oder Gemütszustände verweisen: eine glückliche Familienminiatur, ein blutüberströmtes Gesicht. Das denaturalisiert den Erzählfluss und installiert eine filmische Chaostheorie: Jede Handlung hat Konsequenzen, aber nicht alle Konsequenzen sind unmittelbar sichtbar.

Auch in den Cinemascope-Naturpanoramen soll sich der Blick nicht verlieren, schon alleine die karge, musikfreie Tonspur verhindert Immersion. Dennoch ist das ein zentrales Element des Films: Die beeindruckende Landschaft der australischen Outbacks, die nicht einfach nur dünn, sondern schlichtweg weitgehend überhaupt nicht besiedelte Weite, in der jede Holzhütte, die dann doch hochgezogen wird, wie ein Fremdkörper wirken muss. Verglichen mit den Landschaften des amerikanischen Westens verblüfft an der in "Sweet Country" eine gewisse Lieblichkeit, die aber keineswegs mit Menschenfreundlichkeit verwechselt werden kann. Eher blicken wir auf eine Schönheit, die mit der Abwesenheit, oder jedenfalls der äußerst spärlichen Anwesenheit von Menschen zu tun hat. Wenn der Film sich gegen Ende in eine kleine Siedlung verlagert, verändert er sich komplett. Plötzlich tauchen andere, verschachtelte, ausgestellt artifizielle Bildformen auf, in einer erstaunlichen Einstellung füllt die Rückseite einer improvisierten Kinoleinwand eine Fensterdurchsicht aus.
"Sweet Country" ist immer dann stark, wenn die Bildintelligenz die oft etwas hölzern anmutenden Figureninteraktionen an die Wand drängt. Besonders gelungen sind jene Momente, in denen ein Hang zur Abstraktion durchschlägt, auch im Visuellen. Ein Seil, das senkrecht durch den Bildraum gespannt wird, ein Leintuch, das in Richtung Kamera geschüttelt wird und für einen Moment alle anderen Informationen überschreibt. Besonders deutlich wird das in einer Szene, die in einer Salzwüste spielt. Wie in Werner Herzogs "Salt and Fire" oder in Vincent Gallos "The Brown Bunny" wird die endlos sich ausbreitende Salzkruste selbst zu einer Art Leinwand, auf der eine neue, fiebrige Form der kinematografischen Schrift eingetragen wird. Das Weiß der Salzwüste ist gefräßig, es destabilisiert die gerade noch fest im Raum verorteten Formen und stellt die Ganzheit des Menschen infrage.
Lukas Foerster
Sweet Country - Australien 2017 - Regie: Warwick Thornton - Darsteller: Hamilton Morris, Ewen Leslie, Sam Neill, Wayne Doolan, Natassia Gorey Furber, Gibson John - Laufzeit: 113 Minuten.
---

Die ersten Einstellungen zeigen, schnell und rhythmisch hintereinandergeschnitten, die rostigen Zahnräder einer alten Kirchenuhr, in deren Ziffernblatt sich unten ein kleines Loch befindet, durch die Vögel schlüpfen. In "Offenes Geheimnis", dem neuen Film Asghar Farhadis geht es darum, dass die Gegenwart durchlässig wird, und sich etwas, das unter ihr brodelte, seinen Weg an die Oberfläche bahnt. Das ist für das Schaffen des Regisseurs ebenso typisch wie die Tatsache, dass er dafür eine nicht sonderlich subtile visuelle Metapher findet. Das ist nicht per se ein Problem. Nur verweist das Bild auch darauf, dass die übliche Mechanik des Farhadi-Kinos diesmal auf ungute Weise frei zu liegen scheint.
Farhadi dreht zwar keine Genrefilme, aber seine Filme enthalten meist ein gewisses Genre-Moment in Form eines Rätsels - oft ist es ein Verbrechen -, das es zu lösen gilt. Und das wie ein MacGuffin funktioniert, weil es nicht an sich von Interesse ist, sondern eher dazu dient, mannigfaltige Konflikte sowohl zwischen den als auch innerhalb der Figuren zu Tage zu fördern. Die dann das sind, worum es eigentlich geht.
In "Offenes Geheimnis" sieht das so aus: Laura (Penélope Cruz), die vor vielen Jahren den Argentinier Alejandro (Ricardo Darín) geheiratet hatte und mit ihm nach Buenos Aires gezogen war, kommt zurück in ihr Heimatdorf in der Nähe von Madrid, weil ihre jüngere Schwester Ana (Inma Cuesta) Juan (Roger Casmajor) heiratet. Auf dem Anwesen von Lauras Vater Antonio (Ramón Barea) kümmert sich derweil Paco (Javier Bardem), der kinderlos und glücklich mit Bea (Barbara Lennie) verheiratet ist, um die Geschäfte. Ein Stromausfall und ein Gewitter können die ausgelassene Stimmung der Hochzeitsnacht kaum schmälern, wohl aber die Nachricht über die Entführung von Lauras Tochter Irene (Carla Campra), die zuvor entdeckt hatte, dass Laura und Paco als Jugendliche einst miteinander liiert waren.

Es stellte stets eine Qualität der Filme Farhadis dar, dass er seine Beziehungsdramen mit der Intensität eines gut geölten Thrillers auszustatten versteht. Auch hier die Art, wie er den Moment in Szene setzt, in dem die Stimmung kippt, diejenige, die noch am ehesten für den insgesamt leider uninteressanten Film einnimmt. Wie er Bilder für die Verzweiflung seiner Figuren findet, in den angespannten Gesichtern, die nur von den Smartphone-Displays, auf die sie, auf Nachricht der Entführer wartend, starren, illuminiert werden und die Wucht, die er dem nächtlichen Unwetter verleiht, zeigen Farhadi als einen fähigen Regisseur. Es scheint, als hätte sich das ländliche Spanien vom Anfang des Films, das mit seiner sonnendurchfluteten Rustikalität von gängigen Klischees schwer zu unterscheiden war, komplett im Regen aufgelöst und wäre von ihm davongespült worden. Leider folgt auf diese Szene nicht allzu viel Bemerkenswertes.
Vielleicht verrät ein Blick auf einen von Farhadis iranischen Filmen, den schönen, an der narrativen Oberfläche dem Neuen ähnlichen "About Elly" (2009), was das Problem ist. Im älteren Film waren die Konflikte der Figuren präzise sozial grundiert, und gaben einen Einblick in Mentalität, Wertvorstellungen und Geschlechterverhältnisse einer Gesellschaft, der nicht auf eine verallgemeinernde Patriarchatskritik hinauslief. Diesmal schwebt Farhadi wohl Ähnliches vor, aber leider kommt das Resultat über Allgemeinplätze kaum hinaus. Etwa in der Geschichte Pacos, der sich vom Kind der Bediensteten des Guts zum anerkannten und erfolgreichen Winzer hinaufarbeitet, womit er die Ablehnung und den sozialen Neid der Älteren im Dorf auf sich zieht. Oder in der dem konträr entgegenstehenden Niedergangsgeschichte Alejandros, der einst sehr wohlhabend war, seinen Stand aber durch seinen Alkoholismus nach und nach verspielte.
Das setzt sich fort in der Form der Filme: Wo Farhadi es in "About Elly" verstand, durch Handkamera und den Verzicht auf Filmmusik eine eigenständige Atmosphäre hoffnungsloser Verzweiflung zu kreieren, scheint "Offenes Geheimnis" ästhetisch ganz dem Arthouse-Mainstream verpflichtet, was sich nicht zuletzt darin ausdrückt, wie er sich auf den Starruhm seiner HauptdarstellerInnen Cruz und Bardem verlässt, deren Beziehung zueinander in der zweiten Hälfte klar ins Zentrum des Films gerückt wird - wenn auch nicht als gegenwärtige, sondern eher als emotionale Altlast.
Nicolai Bühnemann
Offenes Geheimnis - Spanien 2018 - OT: Todos lo saben - Regie: Asghar Farhadi - Darsteller: Penélope Cruz, Javier Bardem, Ricardo Darín, Inma Cuesta, Roger Casmajor, Ramón Barea, Barbara Lennie - Laufzeit: 132 Minuten.
Kommentieren