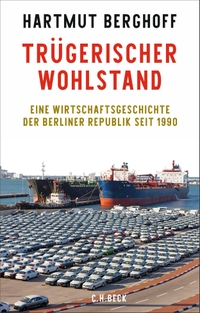Im Kino
Erkundung einer Fremderfahrung
Die Filmkolumne. Von Lukas Foerster, Thomas Groh
09.11.2016. Millimeterarbeit im Fantastischen leistet Denis Villeneuve, der in seinem Science-Fiction-Film "Arrival" Amy Adams die Kommunikationsmöglichkeiten mit Außerirdischen austesten lässt. Edward Zwicks "Jack Reacher: Never Go Back" ist auf den ersten Blick ein romantischer Film noir der mittleren Budgetklasse und auf den zweiten Blick Tom Cruise beim Dienst nach Vorschrift.
Manchmal ergeben sich sonderliche Bezüge im Zusammenspiel zwischen politischen Großwetterlagen und etwas an sich sehr zufälligem wie einem Kinostart. In der Nacht zum Mittwoch ist Donald Trump - entgegen allen Voraussagen der Wahlforscher und den Hoffnungen in den Filterblasen des juste milieu - siegreich aus den Präsidentschaftswahlen der USA hervorgegangen. Am Donnerstag darauf startet nun Denis Villeneuves Arthaus-Science-Fiction-Blockbuster "Arrival", der, wie viele Vertreter des besseren SF-Kinos, mehr von der Gegenwart als von der Zukunft handelt. Trumps Wahl wird jenseits seiner ca. 59 Millionen Wähler gemeinhin als Katastrophe wahrgenommen, als Rückzug der Weltmacht USA auf einen isolationistischen Kurs. Wo Obama, was ihm seine Kritiker zum Beispiel im Hinblick auf Syrien als fatale Zaghaftigkeit auslegten, als begnadeter Rhetoriker auftrat, der die verführerischen Qualitäten des dezenten Dialogs auszuspielen wusste, gilt Trump als egomanischer Trampel. "Arrival" wiederum handelt mitunter von der Katastrophe, die damit einhergeht, wenn sich Supermächte im Zeitalter fortgeschrittener Globalisierung aufs Abenteuer isolationistischer Sonderwege einlassen.
Es geht in "Arrival" also, kurz gesagt, buchstäblich buchstäblich - ja, kein Tippfehler - um Kommunikation. Ums Reden, den Dialog, ums Parlare, um die Details von Sprache, um die Bedingungen der Möglichkeit von Kommunikation überhaupt. Um die Anstrengungen, die für Kommunikation notwendig sind, denn "Kommunikation ist unwahrscheinlich", wie Niklas Luhmann wusste. "Sie ist unwahrscheinlich, obwohl wir sie jeden Tag erleben, praktizieren und ohne sie nicht leben würden."
Den großen, intergalaktischen Rahmen dieses behutsam mit melancholischer Lakonie erzählten Films bildet eine klassische Situation der Hard SF: Die Begegnung zwischen den Menschen und, zunächst, einem rätselhaften Artefakt einer außerirdischen Intelligenz. Der große Arthur C. Clarke hat davon häufiger erzählt - am bekanntesten in "2001: Odyssee im Weltraum" oder in seinem Roman "Rendezvous mit Rama", mit dem sich (der allerdings auf einer Kurzgeschichte von Ted Chiang basierende) "Arrival" ein paar lose Ähnlichkeiten teilt: Quer über den Globus verstreut tauchen eines Tages rätselhafte, hochhaushohe Alien-Raumschiffe von abweisend wirkender Schwärze auf - wie Monolithen verharren sie regungslos auf der Erdoberfläche. Weltweit reisen Forschungsteams und Militärs an, die rund um diese erhabenen Erscheinungen ihre Zelte aufschlagen: Was wollen diese Aliens? Steht eine Invasion unmittelbar bevor? Während die Forscher sich im Schatten der großen Raumschiffe an die wichtigen Fragen herantasten, gerät die globale Lage, vermittelt nur durch Bildschirme, in eine krisenartige Schieflage.
Unter den Forschern befindet sich auch die Linguistin Louise Banks (Amy Adams), der die Aufgabe zuteil kommt, die rätselhaften Laute und Zeichen zu entziffern, die die krakenartigen, nur selten aus dem Dunst im Innern des Raumschiffs in Erscheinung tretenden "Heptapoden" vor sich hinknarzen und hintupfen. Währenddessen läuft die Kommunikation zwischen den internationalen Forscherteams per Direkt-Schalte Sturm: Ein globales Pokerspiel zwischen kollektiv-globalen und insularen Interessen. Nicht nur mit den Aliens muss die Menschheit eine Weise des Miteinander-Sprechens finden - sondern insbesondere auch untereinander. Nicht zuletzt handelt "Arrival" darüber hinaus auch noch von universellen menschlichen Themen - von der Liebe, von der Zeit.

Diese Geschichte einer tastenden Annäherung und vorsichtigen Erkundung einer Fremderfahrung, die die bisherigen Parameter des irdischen Daseins neu ausrichten, erzählt Regisseur Denis Villeneuve mit einem erheblichen "Sense of Wonder", der gerade in seiner ästhetischen Strategie der Reduktion große Wirkung entfaltet: Lange Minuten nimmt sich Villeneuve dafür Zeit, Banks und ihr Team ins Innere des Raumschiffs, in dem sanft verquere Gravitationsverhältnisse herrschen, vordringen zu lassen. Die Ambientmusik von Jóhann Jóhannsson taucht die Millimeterarbeit im Fantastischen ein in wattig-wabernde, monochrome Klang-Irisierungen. Die Farbpalette dazu ist herbstlich kalt bis nassschwarz-glänzend: Eine Krakenwelt aus Vulkangestein im Nebel. Auf eine solch erhaben-abweisende Weltgestaltung versteht sich der Kanadier Villeneuve. Seit einiger Zeit ist zu beobachten, wie er sich mit cleveren und ästhetisch ausgestalteten Filmen von Arthauskino-Rand ins Zentrum der Produktion vorarbeitet, dabei aber stets eine eigenständige Position verteidigt. Mit "Arrival" ist er nun auf dem besten Weg, sich neben Christopher Nolan als Regisseur von Auteur-Blockbustern zu profilieren.
Für Menschen, die im Kino immer noch gerne fremde Welten erkunden, ist dieser Film ein großes Geschenk. Dass das Puzzle, wie man fremdartige Symbolismen zum Sprechen bringt, ein klitzekleines bisschen zu hopplahopp gelöst wird und dabei ein paar Fragen bei der Vermittlung grundverschiedener symbolischer Ordnungen sehr nebenbei eher nicht beantwortet werden, lässt sich als Zugeständnis an die Erzählökonomie verschmerzen.
Und dann eben noch diese Sache mit dem Aktualitätsbezug. Sein großes Drama bezieht "Arrival" am Ende nicht so sehr aus der Anwesenheit der Aliens und deren undurchsichtigen Absichten, sondern aus der Unfähigkeit des Menschen, globale und partikulare Interessen miteinander in ein Verhältnis zu bringen. "Arrival" zeigt den Horror der abgebrochenen Diplomatie und ersehnt sich eine melancholische Erlösung. Ein Überwinterungs- und Durchhaltefilm für all jene, denen an der Vernunft liegt - wider Willen: der erste große Film der frisch angebrochenen Ära Brexit und Trump.
Thomas Groh
Arrival - USA 2016 - Regie: Denis Villeneuve - Darsteller: Amy Adams, Jeremy Renner, Michael Stuhlbarg, Forest Whitaker, Sangita Patel - Laufzeit: 115 Minuten.
---

Eigentlich müsste mir der Film gefallen, und nicht nur, weil ich ein großer Fan von Lee Childs in unnachahmlich prägnanter Sprache verfassten Romanserie um den bärenstarken und supersmarten Drifter Jack Reacher bin, die nun bereits ihre zweite Verfilmung erfährt. Sondern vor allem, weil "Jack Reacher: Never Go Back" auf den ersten Blick genau die Art von populärem Kino ist, die in Hollywood einen zunehmend schweren Stand hat und die nicht nur ich vermisse: Ein Genrefilm der (gehobenen) mittleren Budgetklasse ist das, getragen weniger von einem marktschreierischen Konzept oder einem übergriffigen Franchise, als von einem Star und der poetischen Tradition, in der er sich verortet - in diesem Fall kann man sie mindestens bis zur hard-boiled-Literatur und den film noirs der 1940er zurückverfolgen: Es geht um den einsamen Kampf gegen korrupte Institutionen, und um Helden, die nach bürgerlichem Verständnis dysfunktional sind, die aber gerade aufgrund dieser Dysfunktionalität triumphieren.
Mainstreamkino nicht als Eventproduktion im Hyperdrive, sondern im Normalmodus einer technisch hochentwickelten Serienproduktion; Routine, die immer schon über sich selbst hinausweist, weil sie ein Verhältnis zu ihrer eigenen Geschichte hat, und damit auch zu der Welt, in der wir leben; und die in der aus schlechter Gewohnheit schlecht beleumundeten Spezialfilmform "Sequel" nicht etwa vor die Hunde geht, sondern zu sich selbst kommt - gute Sequels (und es gibt sehr viele gute Sequels) setzen im besten Fall fast wie von selbst jenen Mechanismus von Ähnlichkeit und Differenz in Gang, der moderne populäre Massenkultur schon seit dem 19. Jahrhundert zu immer neuen Höhen treibt.
Freilich: auf den ersten Blick, im besten Fall... denn wenn ich dann im Kinosessel sitze, helfen solche Überlegungen gar nichts, dann zählt doch nur, was auf der Leinwand erscheint; und da ist leider sehr wenig los. "Jack Reacher: Never Go Back" ist kein gutes Sequel, kein guter Mid-Budget-Actionfilm, keine gute Lee-Child-Verfilmung, kein guter Tom-Cruise-Film; sondern einfach nur, und solche Filme hat es natürlich zu allen Zeiten zuhauf gegeben: Dienst nach Vorschrift.

Die wenigen Anfälle von Ambition, die die Regie Edward Zwicks überkommen, werden in der ersten Viertelstunde abgehandelt: Gleich zum Einstieg fertigt Cruise in einer schönen Diner-Miniatur ein paar Trottelpolizisten ab, wenig später folgt eine halbwegs elaborierte Gefängnisausbruchsequenz - an der sich der Film freilich gleich verhebt. Cruise / Reacher befreit sich selbst und gleichzeitig Cobie Smulders / Turner, eine Militärpolizistin, die unter Spionageverdacht steht. Man merkt, worauf Zwick hinaus will: Er möchte ein dynamisches, elegantes und gleichzeitig knochenbrecherisch wuchtiges Räderwerk anschmeißen, in der sich jede Einstellung, jede Bewegung mit blutiger Konsequenz aus der vorherigen ergibt. Theoretisch könnte sich daraus ein düsterer, unwiderstehlicher Sog ergeben, ein wenig wie in einem Refn-Film vielleicht (der Roman, der freilich ansonsten einer der schwächsten der Serie ist, nimmt in der Passage ziemlich Fahrt auf), praktisch gerät die filmische Maschinerie schon auf den ersten Metern ins Stocken - weil die Blickachsen nicht ganz stimmen, weil sich die Regie nicht zwischen subjetiver und objektiver Perspektive entscheiden möchte, weil sie sich keine Zeit dafür nimmt, einen Handlungsraum zu etablieren.
Kurzum: Die Feinabstimmung passt nicht. Da hilft auch die ganz nette Pointe um eine Fluchtwagenverwechslung nichts mehr, mit der die Szene endet - da ist kein Sog mehr, sondern nur noch eine stotternde Maschine, die einen Sog erzeugen möchte. Im weiteren geht der Film solche Risiken eh nicht mehr ein. Und fällt spätestens dann auch deutlich hinter den Vorgänger aus dem Jahr 2012 zurück, der zwar auch nicht allzu viel mit der Hauptfigur anzufangen wusste, aber immerhin vom unbedingten Stilwillen des Regisseurs Christopher McQuarrie profitierte. Diesmal geht es nur noch darum, den generischen Plot, auf den "Jack Reacher: Never Go Back" die Sprachwucht der Vorlage reduziert, möglichst unauffällig herunter zu filmen. Ganz besonders unauffällig: Patrick Heusinger als fast schon klinisch uncharismatischer bad guy. Cruise selbst wirkt oft etwas hilflos, insbesondere dann, wenn er versucht, einen breitschultrigen tough guy swagger zu kultivieren, der ihm kein bisschen steht.
Ein blondes Teeniemädchen namens Samantha (Danika Yarosh), das möglicherweise Reachers Tochter ist, bringt bei ihren ersten Auftritten mit ihrer leicht verbiesterten Art immerhin ein wenig Leben in die Bude; freilich ist bei ihr die Zähmbarkeit von Anfang an mitgedacht. Auch Turners Rolle erhält etwas mehr Gewicht, als weiblichen Sidekicks in derartigen Filmen für gewöhnlich zusteht; dass der Film ihr Verhältnis zu Reacher von einigen Blickwechseln und fast schon rührend holprigen Flirtversuchen abgesehen auf einer professionellen Ebene belässt, gehört zu seinen wenigen guten Entscheidungen. Turners Insistenz darauf, Reacher nicht nur emotional, sondern auch tatkräftig unterstützen zu wollen, begründet sie einmal so: "Für mich steht doch viel mehr auf dem Spiel!" Der Satz rührt am Kern der Reacher-Figur: An ihrer grundsätzlichen Nichtverstricktheit in die Welt, durch die sie sich bewegt; eine Nichtverstricktheit, die es, das ist einer von vielen faszinierenden Aspekten der Romane, erst zu überwinden gilt, bevor die Geschichte beginnen kann. Den Romanen gelingt das durch sprachliche Intelligenz und erzählerischen Wagemut; mit der kinematografischen Indifferenz, die "Jack Reacher: Never Go Back" auf allen Ebenen prägt, kommt man dieser eigenartigen Figur dagegen nicht bei.
Lukas Foerster
Jack Reacher: Never Go Back - USA 2016 - Regie: Edward Zwick - Darsteller: Tom Cruise, Cobie Smulders, Aldis Hodge, Danika Yarosh, Patrick Heusinger, Holt McCallany - Laufzeit: 118 Minuten.
Kommentieren