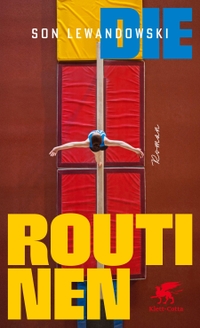Im Kino
Auf der einsamen Insel unseres Lebens
Die Filmkolumne. Von Robert Wagner
20.08.2025. Simon Jaquemet arbeitet sich in seinem neuen Film an KI-Diskursen und schwerer Metaphysik ab. Im Kern geht es in "Electric Child" jedoch um ein zutiefst menschliches Thema: den Schmerz.
Zwei Kinder werden zu Beginn von "Electric Child" geboren. Eines wird unter Schmerzen aus der Gebärmutter in eine Badewanne gepresst und landet in den Armen seiner Eltern. Ein anderes erhebt sich aus den Wellen des Meeres und strandet als nackter Jugendlicher auf einer einsamen Insel. Das erste Kind, das Baby, wurde mit einer neurologischen Mutation geboren und kann ein bestimmtes Enzym nicht produzieren. Seine Lebenserwartung liegt bei bestenfalls einem Jahr. Das andere, der Jugendliche, ist die anthropomorphe Darstellung einer künstlichen Intelligenz, die in einem Survivalcomputerspiel ausgesetzt wurde und nun lernen soll. Nur stellt sich seine Lernfähigkeit als äußerst begrenzt heraus. Es springt zwar bald nicht mehr von Klippen in den Tod beziehungsweise zum Neustart, zieht sich aber hauptsächlich zurück und sitzt sein "Leben" aus.
Beide, das natürlich und das elektrische, sind Kinder Sonnys (Elliott Crosset Hove), eines Forschers an einer Uni, eines zuerst stolzen, dann verzweifelten zweifachen Vaters. Den Problemen seines digitalen Nachwuchses stellt er sich auf seine Weise: Er setzt sich vor seinen Computer und füttert die Algorithmen; er begibt sich ins Innere der Kabel- und damit der Gehirnwindungen seiner Rechner und Server und versucht zu basteln. In der menschlichen Welt bleibt er so zwar hochgradig impotent und wird keine Rettung für das Baby finden, mittels VR-Brille kann er aber die Insel des Spiels betreten und seiner Schöpfung ein Vater sein, der dem Kind die nötige Hilfestellung gibt, sich zurechtzufinden.
Mittels dreier Referenzen ließe sich vielleicht erklären, welche Ziele Regisseur Simon Jaquemet in seinem neuen Film verfolgt. Erstens: "Rosemary's Baby". Sonnys Auftauchen mittels klandestiner Apparatur auf der Insel und damit in einem abgeschotteten System, in dem die Welt vor den unabsehbaren Folgen eines Experiments geschützt werden soll, stellt eine Verletzung der Regularien dar. Die K.I. soll folglich abgeschaltet, quasi getötet werden. Wie Rosemary steht Sonny vor der Frage, ob er sein Kind aus rationalen Gründen umbringt, oder ob er es retten soll - was womöglich den Weltuntergang bedeutet. Nur wird der Film nicht zum atmosphärischen Horror- und Paranoiathriller, sondern zu einem surrealen Actiongebilde, in dem die Welt aus den Fugen geraten ist.

Zweitens: "2001 - Odyssee im Weltraum". Stanley Kubrick stellte in seinem Film einen schwarzen Quader in die Landschaft und machte den in ihm symbolisierten Funken, der in Urzeiten dafür sorgte, dass aus tierischen Primaten Menschen werden konnten, zum Mysterium. Worin dieser Funke lag, blieb letztlich unerklärt. Bei Jaquemet gibt es mehr Hinweise darauf, was die entscheidenden Entwicklungen in Gang setzt, ganz eindeutig ist es gleichwohl auch hier nicht. Die K.I. erhält den nötigen Anstoß nämlich von ihrem Vater. Einerseits also von Sonny als Elternteil, der sein Wissen an sein Kind weiterreicht. Andererseits von dessen Verschwinden, sobald er sich aus der virtuellen Welt ausloggt und im Spiel einfach in Luft auflöst. Der K.I.-Jugendliche sucht diese Entität, die gerade noch vor ihm stand, im Meer oder gräbt sich in den Strand. Zurück bleibt das nackte Bewusstsein mit metaphysischen Fragestellungen. Was begrenzt meine Welt? Was macht sie aus? Woher stammt sie, woher stamme ich? Vielleicht sind es diese Erfahrungen, diese Frage nach einem Gottesvater, die es antreiben? Während Kubrick seinen Film in enigmatische Strenge kleidet, ist "Electric Child" eher eine rumplige, ironische Komödie.
Drittens: "Blade Runner" oder überhaupt die fragilen Realitäten des Science-Fiction Autors Philip K. Dick. Läuft die K.I. nämlich über die Insel, dann sehen wir sie des Öfteren von hinten, wie in einem Computerspiel. Allerdings sehen wir auch Sonny in dieser Perspektive. Die Übergänge von der glatten Welt der Technik zu seiner Wohnung, die zunehmend von Pflanzen übernommen wird, sind äußert surreal. Als er im Tagebuch seiner Frau blättert, die darin die kurze Zeit mit dem gemeinsamen Kind dokumentiert, steht auf einer Seite groß die Frage, wie real das alles sei. Mit kleinen, aber spürbaren Markern wird immer wieder in Frage gestellt, wie wirklich Sonnys Wirklichkeit und er selbst sind.
All diese Dimensionen und Diskurse bezüglich künstlicher Intelligenz, ihren Gefahren, unserer Verantwortung, Erkenntnisphilosophie und Subjektivität im Allgemeinen stehen groß und breit im Film herum, und doch bleiben sie nur grobe, nette Motive, die ein ums andere Male drohen, "Electric Child" in bedeutsame Beliebigkeit auseinanderfallen zu lassen. Gleichzeitig scheinen sie aber auch nur eine Maske zu sein, hinter der etwas anderes lauert. Etwas, das sich direkt vor unseren Augen, aber im toten Winkel Sonnys abspielt. Das von ihm Verdrängte nämlich, der Tod des leiblichen Kindes, und damit der Kern des Films.

Während wir ein ums andere Mal erahnen können, dass Sonnys Frau Akiko (Rila Fukushima) Trauerarbeit leistet, weint, sich verkriecht, schreit, das Beste aus der wenigen Zeit, die sie zur Verfügung hat, macht, ihr Heim umformt, sich ablenkt, bleibt Sonny ein Getriebener, der ruhelos seinen Emotionen aus dem Weg geht. Elliott Crosset Hove spielt ihn ungemein effektiv als Zombie auf Autopilot, der hin und her stürzt, handeln möchte, keinen Weg aus seiner Sackgasse findet, weil er sie nicht akzeptiert und so erst gar nicht sieht. Höchstens im Frust, wenn er wiederholt gegen Dinge tritt, wird spürbar, wie es in ihm brodelt.
Aus einer anderen Perspektive ist "Electric Child" das Abbild des Brodelns in Sonny. Nachdem er euphorisch sein Kind und Akiko nach der Geburt in den Arm nimmt, nachdem er seine K.I. und ihr Potential euphorisch bei einer Präsentation vorstellt, folgen Bilder von Hilflosigkeit und Zerstörung. Er sitzt vor unklaren Zeichen auf Bildschirmen, steht in brummenden, fast schreienden Serverblöcken - eingeklemmt zwischen vibrierenden Farben, zwischen klaustrophobischer, eigenwilliger Rechnerpotenz, die ihm doch nichts nützt. Er rennt durch Gänge, durchwühlt Kabel, tut gegenüber seinen Schwiegereltern so, als hätte das Kind eine Zukunft - sie schenken dem Enkel ein Skateboard, das symbolreich zertreten wird. So offensiv der Film über künstliche Intelligenzen meditiert bis schwadroniert, so sehr ist er auch ein ruhiges, sachliches Dokument eines stummen, unbewussten Schreis.
Damit rettet Jaquemet nicht nur seinen Film davor, ein netter, gutgemeinter Indiefilm zu einem schweren Thema zu sein, und schafft ein ungewöhnliches emotionales Drama, sondern schlägt auch noch einen Bogen zu seinem Thema. Immer wieder baut er nämlich Trennlinien auf zwischen der (möglicherweise) realen und der virtuellen Welt, zwischen der offenen Emotionalität Akikos und der verschlossenen Sonnys. Die zentrale Trennlinie, die gezogen wird, ist die des Schmerzes. Während die K.I. von der Klippe stürzt und danach einfach neu beginnt, müssen die Menschen mit Leid, Angst und Verzweiflung leben.
"Electric Child" formt daraus eine bitterböse Pointe. Gefühle sind unser Vorteil, sind unser Antrieb, sind ein großer Scheiß, und Elternsein heißt, sich entweder geballten Gefühlen ohne Ratio ausliefern: dem (sterbenden) Kind; oder einer rationalen Macht ohne Mitgefühl: den unabsehbaren Folgen des eigenen Handels. Wir Menschen sind, anders ausgedrückt, nichts anderes als ein nacktes Bewusstsein, das auf der einsamen Insel unseres Lebens ausgesetzt wurde, wo unsere Fähigkeit getestet wird, mit überfordernden Aufgaben zurecht zu kommen. Ohne Möglichkeit zum Neustart.
Robert Wagner
Electric Child - Schweiz 2024 - Regie: Simon Jauemet - Darsteller: Elliott Crosset Hove, Rila Fukushima, Sandra Guldberg Kampp, João Nunes Monteiro, Helen Schneider - Laufzeit: 118 Minuten.
Kommentieren