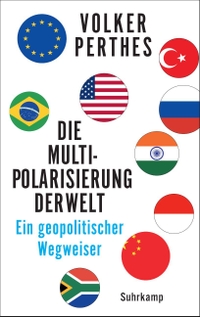Im Kino
Spitzes Licht, stumpfes Licht, gemaltes Licht, gefilmtes Licht
Die Filmkolumne. Von Nicolai Bühnemann, Lukas Foerster
19.08.2020. Hinreißende Lichtorgien von Kameramann Sean Price Williams und eine recht sympathische Hauptfigur zeichnen Michael Almereydas "Tesla" aus. Leider wäre der gerissene Thomas Edison das interessantere Objekt für ein Biopic gewesen. Schöne Atmosphäre, fliegende, das Gehirn aussaugende Stahlkugeln und eine ansprechende Filmmusik bietet Don Coscarellis Splatterfilm "Phantasm" von 1978.
Über das Berliner Festival of Lights habe ich mich früher gelegentlich, fürchte ich, lustig gemacht, es kam mir immer ein bisschen albern vor, wie da diverse Mitte-Fassaden bunt ornamentalisiert aufblühen. Dabei ist das prinzipiell eine großartige Sache: Endlich ist Licht nicht mehr nur ein Medium, das etwas Anderes sichtbar werden lässt, sondern selbst Attraktion. Nachdem ich "Tesla" gesehen habe, stelle ich mir vor, dass die Welt des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts ein einziges Festival of Lights war. In dieser Phase entstehen die Grundlagen der modernen Informationsgesellschaft, schon klar, und das ist auch der von Regisseur Michael Almereyda mit eher albernen brecht'schen Tricks - oh, ein Macbook! In einem Historienfilm! - akzentuierte Gegenwartsbezug des Films; aber es ist eben auch die Zeit, in der das Licht selbst mobilisiert wurde, in der es sich von Ewigkeitsgesetzen wie dem Wechsel der Tages- und Jahreszeiten sowie von Zufälligkeiten wie der Wetterlage emanzipiert. In der das Licht, Bedingung und Grenze aller Sichtbarkeit, in die Hände und die Kontrolle der Menschheit übergeht. Jede der großen Erfindungen der Zeit - ob nun die Glühbirne, das Auto oder, natürlich, das Kino - ist eine Intervention im Feld des Sichtbaren und alle paar Jahre verändert sich, durch diese oder jene Substanz, die durch diese oder jene Technologie bearbeitet wird, nicht nur die Welt, sondern die Bedingung unseres Blicks auf sie.
So zumindest in meiner Imagination der vorletzten Jahrhundertwende, und so auch in Michael Almereydas "Tesla"-Film, der in seinen schönsten Passagen nicht viel mehr ist als ein Schaulaufen aller Lichter dieser Welt. Tesla-Licht und Edison-Licht, das Licht des Wechselstroms und das Licht des Starkstrom, das Licht der Kohlebogenlampe und das Licht des Oszillators, blaues Licht und orangenes Licht, spitzes Licht und stumpfes Licht, gemaltes Licht, gefilmtes Licht, Lichtmontagen, Lichtparzellen, Kerzenlicht in der Gelehrtenstube, eine regelrechte Lichtexplosion im Pavillon of Light auf der Weltausstellung 1893.
Sean Price Williams, der Impressionist unter den jüngeren amerikanischen Kameraleuten, ist zweifellos der richtige Mann für eine solche Lichtparade. Wenn sich in seinen Arbeiten für die Safdie-Brüder oder Alex Ross Perry die Texturen urbanen Lebens immer wieder in autonome Lichtereignisse verwandeln, dann wird diesmal, genau umgekehrt, das Licht selbst zur Textur, zu einem sinnlich-dichten Gewebe, dem die Objekte der Welt lediglich als austauschbares und zumeist nicht allzu solides Trägermaterial dienen. Tatsächlich schrumpft die Welt immer wieder zur bemalten Kulisse zusammen, oder irrealisiert sich in Rückprojektionen.
Ins Licht treten dann freilich früher oder später doch stets Figuren. Nikola Tesla (Ethan Hawke) natürlich vor allem, der griesgrämige Lichtzauberer, der selbst am liebsten im Dunkeln bleibt. Einst war er in Thomas Edisons (Kyle MacLachlan) Werkstatt angestellt, aber das ging nicht lange gut. Der Bruch zwischen den beiden Erfindern ist Almereyda eine weitere, diesmal tatsächlich einigermaßen amüsante brecht'sche Pointe wert und wird zur Urszene, aus der sich, wie in Biopics üblich, die restlichen Entwicklungen mehr oder weniger schlüssig herleiten. Tesla ist Erfinder, aber kein Geschäftsmann, wird andauernd über den Tisch gezogen und glaubt irgendwann, dass Aliens mit ihm kommunizieren. Auch Frauen tauchen immer mal wieder auf, manchmal sogar Sarah Bernhardt, aber zumeist belassen sie es beim Auftauchen: In der effektvollen Illumination ihrer Gesichter findet das Licht, so scheint es, seine finale Bestimmung. Entschädigen soll für diese recht eindeutige Rollenaufteilung vermutlich ein ebenfalls weiblicher, aber leider arg phrasenhaft-neunmalkluger Off-Kommentar.

Man kann sich durchaus wohlfühlen in "Tesla", sich treiben lassen, im Licht baden und auch in der zum Licht passenden samtenen Musik, sich aufs nächste schöne Frauengesicht freuen. Anders als Almereydas phänomenaler Vorgänger "Marjorie Prime", ebenfalls sehr lichtexpressiv von Williams fotografiert, hebt sein neuer Film freilich nie wirklich ab. Das Problem ist nicht so sehr, dass sich unter "Teslas" hipper Oberfläche ein recht konventionelles erzählerisches Gerüst verbirgt; sondern eher, dass dieses Gerüst um die falsche Figur herum errichtet wird. Als Protagonisten einer wild fabulierenden Steampunk-Anime-Serie kann man sich den enigmatischen Tesla sehr gut vorstellen; für ein Biopic und dessen letztlich eher sozialpsychologische als wissenschaftstheoretische Interessenlagen bietet sein Leben (oder zumindest die Aspekte seines Lebens, auf die Almereyda fokussiert) nicht allzu viel Stoff, gerade auch im Vergleich mit seinem historischen Kontrahenten.
Es ist natürlich verständlich, dass ein Independent-Filmer wie Almereyda sich lieber mit dem mysteriöseren und zumindest teilweise verkannten Genie Tesla identifiziert. Aber in diesem Fall wäre das erkannte Genie Thomas Edison die deutlich interessantere Option gewesen. Wo Tesla von der Zeitgeschichte bald zum grummeligen Eckensteher degradiert wird, chargiert Edison zeitlebens zwischen Entdeckergeist und Profitdenken, Größenwahn und Pragmatismus, humanistischen Idealen und faktischer Vorprägung der Kontrollgesellschaft. Dass ausgerechnet die Tötung eines Hundes und dann die Hinrichtung eines zum Tode verurteilten Strafgefangenen mittels Stromschlag zu einem zentralen Testfall der neuen Technik wird, gibt ihm für einen Moment zu denken. Ich bin ja eigentlich gegen die Todesstrafe, meint er; nachdem der Delinquent, anstatt blitzartig das Zeitliche zu segnen, qualvoll im lauen Spannungsfeld dahin schmort, gibt er dann aber doch gerne Hinweise, wie man es beim nächsten Mal besser machen könnte. Hinzu kommt, dass Kyle MacLachlan ein weitaus inspirierender Schauspieler ist als Ethan Hawke, der den gesamten Film über hauptsächlich damit beschäftigt ist, seine Stirnfalte und einen höchstens mittelüberzeugenden osteuropäischen Akzent zu kultivieren. MacLachlan hingegen verwandelt selbst eine Szene, in der er nichts weiter zu tun hat, als verdattert eine Glühbirne anzustarren, in eine umwerfende komödiantische Miniatur.
Lukas Foerster
Tesla - USA 2020 - Regie: Michael Almereyda - Darsteller: Ethan Hawke, Kyle MacLachlan, Eve Hewson, Hannah Gross, Rebecca Dayan, Donnie Keshawarz, Ian Lithgow - Laufzeit: 102 Minuten.
---

Eine der filmhistorischen Spekulationen, denen ich mich von Zeit zu Zeit gerne hingebe: Was wäre, wenn der Film, der vom Ende der Siebziger her einen großen Teil des US-Horrorkinos der Folgezeit prägte, nicht John Carpenters "Halloween" (1978) gewesen wäre, sondern ein anderer Film, der ein Jahr später in die Kinos kam: Don Coscarellis "Phamtasm - Das Böse"?
Beide Filme wurden mit etwa 300.000 gedreht und spielten ein vielfaches ihres winzigen Budgets ein. Beide waren der dritte Langspielfilm in der Filmografie ihrer jeweiligen Regisseure. Beiden merkt man an, dass die Filmemacher in den stark politisierten, theorielastigen Sechzigern und Siebzigern aufgewachsen waren bzw. ihre Filmkarrieren begonnen hatten. Hier beginnen aber auch die Unterschiede, die die Pointe des Vergleichs sind: Während in Carpenters Ur-Slasher sich neben und unter der unzählige Male kopierten Genreformel auch eine deutliche Kritik am kleinstädtischen Mittelamerika der Zeit findet, weht durch Coscarellis Film ein Hauch der Gegenkultur der Sechziger - bzw. genauer: dessen, was von ihr zehn Jahre nach dem Schock der Manson-Morde noch übrig war.
Vielleicht ließe sich der Unterschied so fassen, dass Carpenter mit seinem Film dem Genre den Weg in die Zukunft wies, während es bei Coscarelli um das Fortwirken der Vergangenheit in der Gegenwart geht. Dabei ist das Hippie-Feeling, das in diesem sehr musikalischen Film etwa durch Gitarren-Ständchen und Rolling-Stones-T-Shirts entsteht, nur eine Ebene einer vielschichtigen Welt. Zugleich scheint sich der Schauplatz, eine südkalifornische Kleinstadt, mehr und mehr in eine kleine Westernstadt (zurück) zu verwandeln.
Die dafür typische frontier, die Zivilisationsgrenze, ist eine zwischen der "realen" Welt und einer besonderen, schwer greifbaren Unterwelt, die unter der rigiden Herrschaft des örtlichen Leichenbestatters steht, der aufgrund seiner imposanten Körpergröße The Tall Man (Angus Scrimm) genannt wird. In dem schwarzen Anzug, den er auch in den vier Sequels trägt, hätte er zu einem ähnlichen popkulturellen Phänomen werden können wie die maskierten Killer der Endlos-Slasher-Reihen. Dass er und die Serie genau das nie ganz wurden, sondern sie die Horrorfilmgeschichte immer in die zweite Reihe relegierte, trägt durchaus zu ihrem Reiz bei.

Die Hauptprotagonisten sind der 13-jährige Mike (A. Michael Baldwin) und sein 24-jähriger Bruder Jody (Bill Thornbury), der ihn nach dem Tod der Eltern, die einem grausamen Mord zum Opfer gefallen waren, aufzieht. Die beiden bekommen es mit dem Tall Man und seiner Armee von Zwergen zu tun, die in Umhänge gehüllt sind, deren Kapuzen ihre Gesichter verbergen. Hilfe in einer bedrohlichen Umwelt finden die Brüder nur bei dem befreundeten Eisverkäufer Reggie (Reggie Bannister). Im weiteren Verlauf des liebenswürdig durchgeknallten, aber nicht wirklich wichtigen Plots kommt heraus, dass es sich bei den Zwergen um die Wiedergänger der ermordeten BewohnerInnen der Stadt in der Parallelwelt eines anderen Planeten handelt, einer Art untoter Sklaven, über die der Tall Man herrscht. Dass er Mike in der direkten Konfrontation immer wieder mit einem langgezogenen "Boy!" anredet, stellt zugleich die Assoziation zur Geschichte der realen Sklaverei in den USA her.
Trotz solcher politischer Spitzen ist es das beträchtliche handwerkliche Können Coscarellis, das den Film so sehens- und liebenswert macht. Es manifestiert sich etwa in der Effektivität der einzigen Splatter-Szene, in der eine fliegende Stahlkugel sich mit ausfahrbaren Spitzen in die Stirn eines Mannes bohrt, ihm das Gehirn aussaugt und es in einem Blutschwall hinten wieder ausspeit. Aber auch und vor allem in der schönen Atmosphäre. Nicht den geringsten Anteil an ihr hat die Filmmusik von Fred Myrow und Malcolm Seagrave, in der Carpenters ikonischer, flatternder "Halloween-"Synthesizer-Score, der aus der fortwährenden Wiederholung und Variation einiger weniger Noten besteht, zwar deutlich anklingt, die dabei aber eigene Akzente setzt. Mehr noch als bei Carpenter wird bei Coscarelli die Kleinstadt zu einem Ort, der im Freudschen Sinne unheimlich ist. Dadurch, dass sich unter ihr eine Art Fenster auftut, durch das man in eine - durchweg negativ gedachte - Vergangenheit gelangt, wird das vertraute Umfeld feindlich und bedrohlich.
Eng damit zusammenhängend fundiert Coscarelli seine Geschichte psychologisch. Insbesondere dadurch, dass Mike zu Beginn, angetrieben von der Erinnerung an ein traumatisches Verlusterlebnis, Jody überallhin folgt. Auch auf den Friedhof, den der große Bruder, in einer Durchdringung von Eros und Thanatos, gerne für ein Schäferstündchen mit seinen diversen erotischen Eroberungen nutzt. Eben darum geht es Coscarelli, der letztlich im Kern eine düstere Coming-of-Age-Geschichte mit den Mitteln des Horrorfilms erzählt: dass es keinen Weg in die Vergangenheit gibt, in eine Kindheit, die auch eine Welt vor dem Trauma wäre.
Nicolai Bühnemann
Phantasm - USA 1979 - Regie: Don Coscarelli - Darsteller: A. Michael Baldwin, Bill Thornbury, Reggie Bannister, Kathy Lester, Angus Scrimm - Laufzeit: 89 Minute. Phantasm gestreamt auf justwatch.de
Kommentieren