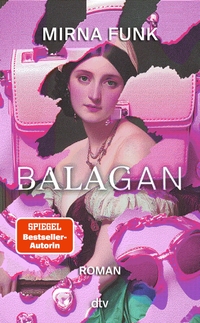Im Kino
Fortgeschritten stählern
Die Filmkolumne. Von Nicolai Bühnemann, Thomas Groh
04.08.2016. Auf halber Strecke liegen bleiben die Ambitionen von Paul Feigs "Ghostbusters"-Remake, der infantile Karikaturen als Comedy von Frauen verkauft. Kunstvoll konstruiert, aber auf steril-heteronormative Art zeigt sich Pedro Almodovars zwanzigster Film "Julieta".
Wie kaum ein zweiter Blockbuster der jüngeren Zeit war Paul Feigs "Ghostbusters"-Remake (das Erzähluniversum wird auf Null gesetzt, von einem dritten Teil kann also nicht die Rede sein) schon lange im Vorfeld ein Politikum. Die Umstände der Debatte waren zwar denkbar hirnrissig, wenngleich man sie bei Sony aus PR-Gründen wohl dankbar in Kauf genommen hat: Seit bekannt wurde, dass die vier Geisterjäger der beiden ursprünglichen "Ghostbusters"-Filme, von denen zumindest der erste einen zentralen Bestandteil im Kanon des amerikanischen Unterhaltungskinos der 80er Jahre darstellt, in der neuen Version von vier Frauen gespielt werden, kochten die Gemüter insbesondere maskulinistischer Zeitgenossen über. Selbst diejenigen, die es bei schwachsinnigen Reizthemen aus guten Gründen mit Bartleby halten, kommen um eine Beantwortung der popkulturellen Gretchen-Frage unserer Tage kaum herum: Nun sag, wie hast Du's mit dem neuen "Ghostbusters"-Film?
Machen wir es schnell, damit diese leidigen, filmäußeren Faktoren abgehakt sind: Es versteht sich für jeden denkenden Menschen von selbst, dass gegen einen weiblich besetzten "Ghostbusters"-Film nichts zu sagen ist. Wer der Ansicht ist, dass Frauen Comedy nicht können, ist nur zu bemitleiden, denn er verbringt sein Leben offenkundig unter einem Stein. Es ist nur zu begrüßen, wenn patriarchale Strukturen im Unterhaltungskino aufgeweicht werden und ihrer Hegemonie verlieren. Variatio delectat. Und ja, es ist gut, wenn ein Hollywood-Film in der Lage ist, das beengte Korsett üblicher Geschlechterrollen abzulegen und vier Frauen in Hauptrollen präsentiert, die sich voneinander stark unterscheiden, je das Ihre zum Plot beitragen, an keiner Stelle übergriffig sexualisiert werden; und auch, dass man sogar eine Ahnung davon bekommt, mit welchen Auflagen zur Verbiegung insbesondere Frauen in der Arbeitswelt zu tun haben. Wenn dann noch ein Hollywood-Beau wie Chris Hemsworth sein maßgeblich durch Marvels "Thor"- und "Avengers"-Filme geprägtes Macker-Image aufbricht und als Quasi-Sekretärin der Ghostbusters sämtliche "Dummchen"-Klischees einer solchen Rolle aufgreift, zuspitzt und bis zur Kenntlichkeit entstellt, ist das als strategische Entscheidung des Films kein bisschen schlecht, ganz im Gegenteil.
Als Gegenentwurf zu gewissen Backlash-Tendenzen des Hollywoodkinos, ist das alles rein strategisch gesehen erstmal nicht falsch. Kino aber ist mehr als soziopolitisches Taktieren. Und im Betonen der (im Grunde nicht gar so großen, da eigentlich nur invertierten) Abweichung liegt dialektisch immer die Anerkennung des Bestehenden als Referenzpunkt. Sprich: Der Film ist leider trotzdem Mist. Und "Leider" mit einem sehr großen L, denn "Ghostbusters" riecht an allen Ecken und Enden nach einer gründlich verschenkten Chance.
Zugegeben, er sieht tricktechnisch tatsächlich so fantastisch aus, wie das Andreas Busche auf ZeitOnline betont. Anders als Busche habe ich aber keinen Film gesehen, der sich von seinem Original freigemacht hätte. Ganz im Gegenteil wird Feigs Film geradezu zerrieben zwischen ständigen Anspielungen auf den Originalfilm und der Überforderung, die Lücken dazwischen produktiv zu füllen. Es beginnt bei der Handlung, die in wesentlichen Punkten dem Original folgt: Vom Wissenschaftsbetrieb frustriert beziehungsweise von diesem ausgeschlossen, wenden sich drei Erforscherinnen des Paranormalen (Melissa McCarthy, Kristen Wiig und Kate McKinnon) der freien Marktwirtschaft zu, wo sie nach der erfolgreichen Sichtung eines Geistes ihren Sachverstand in Form eines prekären Quasi-Start-Ups zu Geld machen wollen, was aufgrund des eher exotischen Betätigungsfelds mit erwartbaren Schwierigkeiten und Vorbehalten einher geht. Ergänzt werden die drei bald durch die schlagfertige U-Bahn-Angestellte Patty (Leslie Jones), die als Afro-Amerikanerin eine ähnliche Randrolle einnimmt wie der ebenfalls schwarze Winston (Ernie Hudson) in den beiden ersten "Ghostbusters"-Filmen. Dass sich die paranormalen Ereignisse in New York zusehends häufen und auf einem Stadtplan zu einem Muster verdichten, schreiben sie bald dem üblen Plan eines Schurken namens Rowan North (Neil Casey) zu. Als North das Raum-Zeit-Gefüge zu zerbersten droht und die Stadt mit popkulturell angehauchten Giganten aus der Jenseits-Welt überrollt, stellen sich die nach vielen tappsigen Episoden endlich souverän gewordenen Ghostbusters der Bedrohung entgegen.

Soweit, so eighties. Auch in den Details gibt es ständig Anspielungen auf das Original, die mal uninspiriert ausfallen (Dan Akroyd sagt als mürrischer Taxifahrer "I'm afraid of no ghost"), mal lieblos (der mittlerweile gestorbene Harold Ramis darf als Büste aufblitzen), mal schlicht nervtötend (Bill Murray als sinnlos im Film herumstehender Skeptiker, der kurzerhand aus dem Fenster geworfen und nie mehr gesehen wird) oder auch beknackt (der ikonische Marshmellow-Mann darf auftreten, allerdings wird ihm buchstäblich die Luft herausgelassen). Auch Sigourney Weaver (nach dem Abspann) und Ernie Hudson (kurz vor dem Abspann) haben Auftritte, auf Rick Moranis wartet man allerdings vergebens, da der sich vor zig Jahren aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat. Sogar der schluffige Geisterkobold aus dem ikonischen Ghostbusters-Logo ist mit dabei und darf sich zum Welten zermalmenden Oberbösewicht auswachsen.
Wer derart offensiv das Original in Erinnerung ruft - der Film ist geradezu heimgesucht, wenn nicht besessen davon -, muss sich Vergleiche gefallen lassen: Wo die ursprünglichen Geisterjäger einigemaßen runde Figuren waren, die in Ansätzen ein Verhältnis zur sozialen Wirklichkeit aufbauten, sind die vier weiblichen Ghostbusters aufgedrehte, grimassierende, wild gestikulierende Karikaturen, denen der über-performante Charakter ihrer Figuren in jeder Einstellung anzusehen ist. Insbesondere McKinnon, in deren Figur sich der nerdig-verschlossene Ingenieur Egon und der draufgängerische Venkman amalgamisieren, gibt einen sich ständig verrenkenden, unkenden, Schnute ziehenden Kasper, der jede Szene ungut sabotiert. Die Gags sind entweder morsch oder fortgeschritten stählern in ihrer Unwitzigkeit - der Film wirkt, als würde er mit seinen Übersteuerungen Unsicherheiten überspielen wollen. Frauen, scheint dieser Film nahelegen zu wollen, können Comedy nur als infantile Karikatur. Was ebenso blödsinnig wie schade ist. Zwar neigen auch Männerkomödien zur Überdrehtheit und Infantilität, in solchen hat beides aber oft eher offenlegenden, bloßstellenden Charakter. Hier hingegen wirkt es wie eine Preisgabe und ein Eingeständnis. Und nicht zuletzt wie eine Zumutung: Wenn sich dieser Film insbesondere emanzipierten Frauen als Komödie anbietet, könnten sich emanzipierte Frauen durchaus fragen, ob man sie nicht für blöd verkaufen will.
Ironischerweise kommt ebenfalls in dieser Woche ein weiterer Geisterfilm in die Kinos, der mit solchen Fragen um einiges souveräner umgeht: David Sandbergs erwachsener Horrorfilm "Lights Out" schleift die üblichen Geschlechterrollen effektiv und souverän, aber ohne viel trommelnden Aufhebens.
Zugegeben, der Ärger mag auch mit der nervtötenden Synchronisation zu tun zu haben, die den Film fortlaufend torpediert: Verantwortlich dafür zeichnet Oliver Kalkofe, der als TV-Parodist zwar Grandioses leistet, aber immer dann, wenn er sich mit Filmen befasst, sonderbar schlecht beraten wirkt und daneben greift: Man denke an seine schauderhaften Edgar-Wallace-Parodien, den verkniffene Humor seiner Schlefaz-Einführungen auf Tele5, nun diese Synchro.
Nicht zuletzt mangelt es dem Film an einer wesentlichen Facette des Originals: Das war nämlich tatsächlich noch äußerst welthaltig. Soziale und politische Kämpfe bildeten sich darin - im Rahmen der Möglichkeiten eine Mainstreamfilms - en passant ab, hinzu kamen ungeschönte Aufnahmen des heute romantisierten, in den Achtzigern aber noch ziemlich desolaten New York. Ansätze davon sieht man auch in Feigs neuem "Ghostbusters"-Film, diese werden aber rasch überspielt oder bleiben als ungenutzte Bruchstücke liegen.

Was auch insofern schade ist, als dieser Aspekt Feig theoretisch zu interessieren scheint: Tatsächlich geht es am Rande um den Wandel, in dem New York stetig und in den vergangenen 20 Jahren akzeleriert begriffen ist. Die Spukszene etwa, mit der der Film eröffnet, spielt in einem musealen Ambiente, wir befinden uns, laut Museumsführer, im letzten Haus der Stadt, das in seinem Zustand des 18. Jahrhunderts erhalten geblieben ist. Als sich später die Ghostbusters als solche formieren, geht es darum, ein neues Domizil zu finden: Natürlich besichtigen sie auch das aus den ersten Geisterjägern bekannte Firehouse - in den 80ern noch eine heruntergewirtschaftete Immobilie in einer zweifelhaften Gegend, im zwischenzeitig modernisierten New York nach Giuliani allerdings ein unbezahlbares Prestige-Objekt, weshalb die neuen Ghostbusters angesichts des Mietpreises rasch abwinken und mit einem Zimmer über einem chinesischen Restaurant vorlieb nehmen. Im Showdown schließlich überzieht Rowan North die Gegend um den Times Square mit einem Zauber, der das insbesondere an dieser Ecke einstmals schmuddelig-schäbige New York der 70er als Kulisse und gewissermaßen als Verdrängtes der Stadt wieder auferstehen lässt. Womit der Film allerdings, von etwas Kirmes-artigen Schaueffekt abgesehen, rätselhaft wenig anzufangen weiß.
In diesen Spuren liegen vielversprechende, allerdings auf halber Strecke zum Erliegen gebrachte Ambitionen. Was an dem Film interessant hätte sein können, bleibt nach wenig entschlossenem Aufgriff einfach liegen. Herausgekommen ist eine triste Komödie, die ihre theoretisch guten Entscheidungen unter einem Konvolut von praktisch schlechten Entscheidungen begräbt. Schade, unendlich schade.
Thomas Groh
Ghostbusters - USA 2016 - Regie: Paul Feig - Darsteller: Kristen Wiig, Melissa McCarthy, Kate McKinnon, Leslie Jones, Chris Hemsworth, Neil Casey - Laufzeit: 116 Minuten.
---

Vielleicht ist das, was ich zu Almodóvars zwanzigstem Film zu sagen habe, ziemlich ungerecht. Vielleicht ist die Konsolidierung dieses autorenfilmerischen Werks, die mit "Julieta", der von weiten Teilen der deutschsprachigen Presse als "reif" und "erwachsen" gelobt wird, neue Ausmaße erreicht hat, eine Sache des Älterwerdens und also der Lauf der Welt. Damit will ich mich mit meinen knapp 36 Jahren und als großer Bewunderer des frühen Arbeiten des Regisseurs aber nicht abfinden. Deshalb hier zwei oder drei Dinge, die mich an "Julieta" stören.
Man mag es vermessen finden, dass ich mich in diesem betont geschmackvollen, ja sterilen Drama über nichts mehr gefreut hätte als über einen Werbespot für einen Damenslip, der Fürze in Parfum verwandelt und als Windel oder - zusammengerollt - als Dildo fungiert wie in seinem Debüt "Pepi, Luci, Bom und der Rest der Bande" (1980); oder über ein Nachbarsmädchen mit telekinetischen Kräften und roten Haaren wie Sissy Spacek in "Womit habe ich das verdient?" (1984). Schließlich hatte sich der Filmemacher in seinem letzten Werk, "Fliegende Liebende" (2013), mal wieder an einer Komödie versucht, und die Bruchlandung, die er damit erlitt, zeigt, dass queere Komik (wenn man denn Sperma-im-Bart-Witzeleien als solche durchgehen lassen möchte) und, nun ja, Anarchie bei ihm nicht mehr zünden.
Aber wo ist der Almodóvar geblieben, der in "Alles über meine Mutter" (1999) seinen Status in seinem Heimatland dazu nutzte, um im spanischen Mainstream über verschiedenste (und darunter in vielerlei Hinsicht prekäre) queere Identitäten zu sprechen - in einem wirklich ergreifenden Film? Oder der aus "Sprich mit ihr" (2002), der noch der moralisch ambivalentesten Liebesgeschichte ein zutiefst humanistisches Verständnis entgegenbrachte? Hat Susanne Ostwald, die in der Neuen Zürcher Zeitung "Julieta" als "so etwas wie die Quintessenz von Almodóvars Schaffen" bezeichnet, denselben Film gesehen wie ich? Die moralischen Ambivalenzen in "Julieta" belaufen sich in ihrer Summe darauf, dass es Männer, deren Frauen todkrank ans Bett gefesselt sind (eine Konstellation, die gleich zweimal vorkommt), mit der Monogamie nicht so genau nehmen.
Doch fangen wir am Anfang an: Die ungefähr 50-jährige Julieta (Emma Suárez) sitzt auf gepackten Koffern, sie möchte mit ihrem Freund Lorenzo (Darío Grandinetti) Madrid verlassen, um in Portugal neu anzufangen. Doch eine schicksalhafte Begegnung hält sie zurück. Auf der Straße trifft sie auf Bea, eine alte Freundin ihrer Tochter Antía (Auftritt der einzigen queeren Figur des Films: einer aus einem Grüppchen von Freunden, die auf Bea wartet). Bea beschließt zu bleiben, in ihr altes Viertel in Madrid zurück zu ziehen, ihre Geschichte aufzuschreiben, die mit einer schicksalhaften Begegnung in einem Nachtzug beginnt.

In dieser Geschichte trifft die 25 Jahre jüngere Julieta, nun von Adriana Ugarte verkörpert, zunächst einen älteren Mann, der ihr schnell auf die Nerven geht und sich wenig später umbringt, weswegen sie sich schuldig fühlt, dann den Fischer Xoan (Daniel Grao), mit dem sie Sex hat, und den sie später in seinem galizischen Dorf aufsucht, wo er bis vor kurzem noch seine schwerkranke Frau Ana pflegte, die praktischerweise kurz vor Julietas Eintreffen verstirbt. Die beiden bekommen eine Tochter: Antía. Als diese neun Jahre alt ist und mit ihrer besten Freundin Bea ins Ferienlager fährt, gerät Xoan beim Fischen in einen Sturm, den er nicht überlebt. Natürlich haben sich die beiden zuvor gestritten, sodass sich Julieta so richtig schuldig fühlen kann. Antía und Bea pflegen Julieta in Madrid durch ihre schwere Krise hindurch. Dass Antía zwischenzeitig erwachsen oder zumindest älter wird, nimmt ihre Mutter genauso wenig wahr, wie es der Film zeigt. Mit achtzehn geht sie in die Schweiz, eigentlich will sie nur drei Monate bleiben, tatsächlich kehrt sie nie wieder zur Mutter zurück.
Diese setzt zunächst alles daran, ihre Tochter zu finden, backt ihr Jahr für Jahr zum Geburtstag eine Torte, um sie hinterher unangerührt in den Müll zu werfen. Schließlich verdrängt sie, dass es Antía je gegeben hat, lernt in ihrem neuen Leben Lorenzo kennen. Eben als Julieta ihr altes Leben und die Erinnerung an ihre Tochter endgültig hinter sich lassen will, trifft sie an einer Straßenecke Bea.
Einerseits sollen die Eckpunkte dieser Geschichte wohl die des echten Lebens sein: Liebe (auch wenn das Wort im Film nie vorkommt), Tod, Geburt, Trennung von den Kindern, schicksalhafte Begegnungen. Man muss Almodóvar nicht sonderlich böse gesinnt sein, um diese Vorstellung des Lebens an sich heteronormativ zu finden. Andererseits lässt der kunstvoll konstruierte - und in einem Fort auf die eigene kunstvolle Konstruiertheit verweisende - Plot kaum Realismusverdacht aufkommen. Einerseits spielt Almodóvar mit Hitchcock-Zitaten und lässt die junge Julieta auf das todbringende Unwetter durch regenverhangene Scheiben schauen wie Barbara Stanwyck bei Douglas Sirk (und was für einen tollen Film hätte Sirk - oder auch: ein fähiger Sirk-Epigone - aus diesem Drehbuch machen können!); andererseits fürchtet der Film das Genrekino wie der Teufel das Weihwasser.
Was dabei herauskommt ist ein Drama, das so gründlich von Gefühlen befreit ist, wie seine sterilen Schauplätze von Keimen. Wenn etwa Julieta sagt, dass sie den Tod Xoans ohne die Fürsorge ihrer Tochter und Beas nicht überwunden hätte, glaubt man ihr das; dabei irgendetwas zu fühlen erlaubt einem ihre tränenfreie Lethargie jedoch nicht. Den Wechsel von der jungen zur älteren Julieta inszeniert der Film bewusst als Bruch. In einer Szene liegt Ugarte in der Badewanne, in der nächsten kommt unter dem Handtuch, mit dem die beiden Mädchen sie abtrocknen, die 21 Jahre ältere Suárez hervor. Anstatt aus diesem Bruch aber etwas zu machen, eine Idee zu ihm zu entwickeln, wird er gleich in der nächsten Szene mit Schminke, die die ältere Darstellerin etwas jünger aussehen lässt, zugekleistert. Wie diese Schminke sollen auch die betont bürgerlich-geschmackvolle Ausleuchtung und Inszenierung kitten, was in diesem Film einfach nicht zusammenpasst. Übrig bleibt stimmiger Einheitsbrei. Erzählerische und inszenatorische Meisterschaft kann man Almodóvar kaum absprechen, doch sie unterstreichen nur, was für eine Todgeburt von einem Film "Julieta" ist.
Nicolai Bühnemann
Julieta - Spanien 2016 . Regie: Pedro Almodovar - Darsteller: Adriana Ugarte, Rossy de Palma, Emma Suarez, Michelle Jenner, Inma Cuesta - Laufzeit: 99 Minuten.
Kommentieren