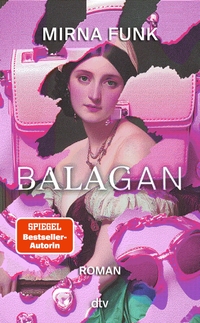Im Kino
Hyper, Hyper
Die Filmkolumne. Von Elena Meilicke, Jochen Werner
15.05.2013. Großraumdissenkino statt Mittelstufenliteraturverfilmung bietet Baz Luhrmanns "Der große Gatsby". Ulrich Seidls Trilogieabschluss "Paradies: Hoffnung" gönnt uns das Nichteintreten des Allerschlimmsten. Und das ist auch mal schön.
"Ich las das Buch in der Mittelstufe und war tief beeindruckt," sagt Leonardo DiCaprio über "The Great Gatsby". Wie ihm ging es Tausenden anderen, und deswegen sind jetzt die deutschen und amerikanischen Zeitungen voll von mäkeligen bis enttäuschten Buch-Film-Vergleichen, Beteuerungen von Unverfilmbarkeit usw. usf. Was natürlich eine müßige und vorhersehbare Debatte ist, die hier nicht weiter verfolgt werden soll. Der Film selbst geht mit seiner Herkunft aus Buchdeckeln, seiner literarischen Abstammung, einigermaßen hemdsärmelig um, der hat da kein Problem mit: mal schieben sich Schriftzüge von links vorne nach rechts hinten quer durchs Filmbild (ist ja 3-D), mal segeln einzelne Schreibmaschinenlettern auf Manhattan herab wie Schneeflocken. Literatur unverfilmbar? Von wegen.
Im klassischen Sinne schön sehen die räumlich rieselnden Buchstaben allerdings nicht aus, und das gilt für den ganzen Film. In visueller Hinsicht hat "The Great Gatsby" ungefähr die Eleganz und Subtilität eines Scooter-Songs. Hyper, Hyper. Da saust die Kamera Hochhausfassaden im Höllentempo herab oder schießt immer wieder über die blaue Bucht, die Gatsby (Leonardo DiCaprio) von seiner geliebten Daisy (Carey Mulligan) trennt. Achterbahn- oder ADHS-Bilder sind das, schrill, steril und nervös. Die großen Partyszenen mutieren zu bombastischen, grell ausgeleuchteten Wimmelbildern, in denen alles zu hell, zu viel und zu schnell ist. Das treibt beim Zuschauen den Puls in die Höhe und sorgt für Gänsehaut auf den Unterarmen. Scooter hört man ja auch ganz gerne, manchmal.
Die 3-D-Technik tut ihr übriges und zeitigt seltsame Effekte: Figuren wirken so scharf und fein herausziseliert, dass die Bilder in Einzelobjekte und Schichten zu zerfallen drohen; die Unschärfen dagegen scheinen noch unschärfer als in herkömmlichen Kinobildern. So induziert "The Great Gatsby" ein flirriges, fast delirantes Sehen und produziert eine besondere Art des Eingesogen- und Angegangenwerdens. Den ganzen Film hindurch kann ich mich nicht von dem leichten Unbehagen darüber befreien, dass die 3-D-Bilder auf unbewusste, befremdliche und nicht zu kontrollierende Weise mit meinem Hirn und meiner Wahrnehmung spielen. Was Kino natürlich immer tut.

Spaß macht das alles trotzdem und Sinn sowieso. Wenn Luhrmann seinen "Gatsby" als dezidiert geschmackloses Überwältigungskino anlegt, das den Charme einer gepflegten Großraumdisse ausstrahlt, dann passt das gut zur Figur des Jay Gatsby, zu dem Emporkömmling und Parvenü, der es zu unvorstellbarem Reichtum gebracht hat. Mein Haus, mein Auto. Nur die Frau fehlt, und darum geht es ja. Unterlegt wird die Besitzstandsschau mit einem Soundtrack aus Pop und Hiphop (Jay-Z ist auch Produzent des Films): Lana del Rey, Beyoncé und Bryan Ferry haben mitgemacht, es gibt die großen Hits "Crazy for You" und "Back to Black" in interessant verfremdeten Versionen, schön langsam und verstolpert.
DiCaprio gibt den windigen Dandy sehr gut, fand ich, als steife Kunstfigur mit exaltierter Garderobe (rosa) und ausgeprägten Sprachidiosynkrasien ("Old Sport"), undurchschaubar und entwaffnend naiv zugleich in seinem unendlich optimistischen Hoffnungsvermögen. Es mag auch an DiCaprio liegen, dass "The Great Gatsby" in gewisser Hinsicht eher an die späten 90er Jahre als an irgendwie geartete 20er erinnert: DiCaprio am Bug der "Titanic", DiCaprio in silberner Ritterrüstung in "Romeo and Juliet" - solche Bilder kommen wieder in den Sinn, wenn Gatsby in Long Island übers Wasser schaut. Letztlich reaktualisiert Baz Luhrmann mit "The Great Gatsby" eine bewährte Rezeptur, die auf seinen Film "Romeo and Juliet" von 1996 zurückgeht: hier wie dort bildet eine klassische Vorlage den Ausgangspunkt, die dann aufgepoppt und hochgejazzt wird, nach dem Vorbild der hektisch-kurzweiligen Dramaturgien und Choreographien von Musikvideos. Jetzt auch in 3-D.
Elena Meilicke
---

In der Liebe war für Teresa, die fünfzigjährige Protagonistin von Ulrich Seidls "Paradies: Liebe", keine Erlösung zu finden. Im Gegenteil, ließ sie der Film schließlich am Boden zerstört zurück - als Folge einer fatalen Projektion: Obgleich der Sextourismus, unter dessen Brennglas der Auftakt von Seidls Paradies-Trilogie das Zwischenmenschliche sezierte, wenig mit authentischen Emotionen zu tun haben mag, sondern den klar definierten Regeln einer geschäftlichen Transaktion folgt, erhoffte sich Teresa unter seinen Bedingungen eine Ausfüllung der eigenen romantischen Leerstellen und Einsamkeiten, die unmöglich bleiben muss.
Auch im Glauben ist keine Linderung der je individuellen Versehrungen zu haben. Teresas Schwester Anna Maria, Seidls Protagonistin in "Paradies: Glaube", zerschlägt eher, via Selbstgeißelung, die letzten Reste Menschlichkeit in sich, die noch nicht vom Horror vacui der kleinbürgerlichen Provinzexistenz erstickt wurden. Seidl, gnadenloser Chronist des österreichischen Provinzhorrors seit gut dreißig Jahren, demonstriert unnachgiebig, wie diese selbsternannte Botschafterin der Nächstenliebe ihre Mitmenschen - die zu missionierenden Ungläubigen, denen sie ungefragt eine gigantische, ungeheuer hässliche Muttergottes auf die Kommode stellt, ebenso wie ihren körperbehinderten muslimischen Ehemann - eher wie Haustiere als auf Augenhöhe behandelt.
Nun, mit dem abschließenden Film der Trilogie, tritt die Hoffnung ein in Seidls unbarmherzige Spießbürgerhölle, und natürlich liegt zunächst die bange Frage nahe, ob der Filmemacher die jugendliche Protagonistin Melanie, Tochter der Sextouristin Teresa und Nichte der Betschwester Anna Maria, ebenso ungerührt dem Zerfall preisgeben würde wie ihre ältere Verwandtschaft. Oder, anders gefragt: Ist Seidls Blick auf die Hoffnung ebenso sarkastisch, mitunter zynisch gar, wie jener auf die Liebe und den Glauben, die so gar nichts Paradiesisches zu bieten hatten? Die Antwort lautet, einigermaßen überraschend: eher nein. "Paradies: Hoffnung" porträtiert eine Nische der Welt, die den unlebbaren Kleinbürgeralpträumen von "Paradies: Liebe" und "Paradies: Hoffnung" in nichts nachsteht, und doch inszeniert Seidl den Abschluss seiner Trilogie als einen lichtdurchfluteten, luftigen, oft fast zärtlichen Film.
Melanies Aufenthalt am grotesken Schauplatz von "Paradies: Hoffnung", einer Spezialklinik für übergewichtige Jugendliche, ist zwar alles andere als freiwillig, und fortwährend spiegeln sich in den typisch Seidl'schen Tableau-Aufnahmen die grauenhaft symmetrischen Festgefrorenheiten der in den Vorgängerfilmen vermessenen erwachsenen Lebenssphären in ihn hinein - mal in grotesker Komik kulminierend ("If you're happy and you know it, clap your fat."), mal in stark empfundenen Beklemmungen angesichts dieses die noch unfertigen Jugendlichen rigide in vorbestimmte Formen pressenden Zwangssystems, und zuallermeist in beidem zugleich.

Dennoch funktioniert die Heterotopie dieser absurden Klinik auch als eine Art Exklave für Melanie und die anderen Jugendlichen, die in einer Art Schullandheimatmosphäre eine sehr kindliche und immer wieder, allen Schikanen zum Trotz, unbeschwerte Freiheit ausleben können, für die in der Welt ihrer innerlich längst abgestorbenen Angehörigen keine Luft bleibt. Da sitzt man mit den Teenagern zusammen im nächtlichen Schlafsaal, führt unbehagliche erste Gespräche über Sex - der hier noch auf ganz andere Weise unentdecktes Land sein darf als er es, auf ungleich destruktivere Weise, im Leben Teresas in "Paradies: Liebe" noch immer ist - trinkt heimlich Alkohol oder lässt sich beim verbotenen Nachtmahl in der Küche erwischen. Und spürt dabei, dass man es erstmals im Rahmen der Paradies-Trilogie (und vielleicht in Seidls gesamtem Werk) mit Protagonistinnen zu tun hat, die nicht schon von vornherein und von Grunde auf verloren sind. Mit Mädchen freilich auch, die im spielerischen Austesten ihrer erwachenden Sexualität mit einer potenziell gewaltsamen erwachsenen Sexualität konfrontiert werden, als Bedrohung wie auch als Schreckensvision einer eigenen Zukunft - auch wenn Seidl uns und ihnen ausnahmsweise das Nichteintreten des Allerschlimmsten gönnt.
Von vornherein unterscheidet sich bereits die Qualität des individuellen Makels, der Melanie hier zugeteilt wird, dramatisch von den psychischen Beschädigungen Teresas oder Anna Marias. Im Grunde handelt es sich bei Melanie um einen unter den passenden Umständen durchaus lebenslustigen Teenager, dessen Problem eher von der Außenwelt an sie herangetragen wird. Ihr zwar fülliger, aber nicht eben krankhaft übergewichtiger Körperbau fällt aus dem sozialen Raster, was sie - ausgerechnet in den Augen ihrer tiefergreifend verstörten Mutter - als behandlungsbedürftigen Fall erscheinen lässt. Darin, dass sich ausgerechnet Melanie als einzige Protagonistin der Paradies-Filme in therapeutischer Behandlung wiederfindet, besteht die letzte und böseste Pointe in Seidls Trilogie.
Diese war ursprünglich als ein einziger Film mit drei Erzählsträngen geplant, wuchs dann zu einer Komplexität und Länge an, die Seidl dazu bewog, das Material in drei separaten Filmen zu arrangieren. "Paradies: Hoffnung" ist unter diesen dreien der Film, dem man diese Genese am deutlichsten anmerkt. Er ist weniger straff strukturiert und weitaus weniger dringlich als "Paradies: Liebe" und "Paradies: Glaube", und er findet nicht zu einem wirklichen Abschluss. Aber gerade in diesen vermeintlichen Schwächen kommen ganz entschieden die Stärken dieses finalen Paradies-Films zum Ausdruck, der auf eine eigenartige Weise vielleicht der schönste in Seidls Zyklus ist: Es gibt ganze Handlungsstränge, die aufs Bedrohlichste von jener (auch immer sexuellen) Verstörung durchtränkt sind, mit der sich so viele von Seidls Protagonisten zuverlässig das Leben selbst zur Hölle machen. Hier aber bleiben diese ebenso im Offenen, im Vagen und Ambivalenten, wie der Film als Ganzes. Und worin könnte das Prinzip Hoffnung kraftvoller zum Ausdruck kommen als in einem offenen Ende?
Jochen Werner
weiterlesen:
unser Text zu "Paradies: Liebe"
unser Text anlässlich der Berlinale 2013 zu "Paradies: Hoffnung"
unser Text zu "Evil Dead" von Fede Alvarez, der ebenfalls diese Woche startet
Der große Gatsby - USA 2013 - Originaltitel: The Great Gatsby - Regie: Baz Luhrmann - Darsteller: Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire, Carey Mulligan, Joel Edgerton, Isla Fisher - Laufzeit: 142 Minuten.
Paradies: Hoffnung - Österreich 2013 - Regie: Ulrich Seidl - Darsteller: Melanie Lenz, Verena Lehbauer, Joseph Lorenz, Michael THomas, Viviane Bartsch - Laufzeit: 100 Minuten.
1 Kommentar