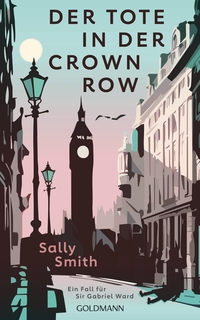Im Kino
Parade-Emo-Indieboy
Die Filmkolumne. Von Thomas Groh, Jochen Werner
27.06.2012. Indie-Regisseur Marc Webb macht beim neuen Spider-Man dasselbe nochmal, aber völlig anders und erlöst dabei New York von seinem Trauma. Wayne Wang erzählt "Seidenfächer" zwei Geschichten von vier Mädchen: halb interessant und doppelt sentimental.
Dieser Peter Parker, der hektisch an die Scheiben des schon abgefahrenen Schulbusses schlägt, dem er unter Gelächter aller Passagiere hinterher rennt, mit der Brille auf der Nase, hinter der er verschüchtert in die Welt schaut, dieser Peter Parker ist der ewige Nerd, das typische Milchgesicht, der übliche Verlierer: Mit seinem Grinsen, seinem unbeholfenen im Weg Stehen, seinen leicht dümmlichen Versuchen, einerseits endlich die Spinnfäden unter Kontrolle zu kriegen, die er nach dem Biss einer genmanipulierten Spinne aus dem Handgelenk schießt, andererseits seine neuen Fähigkeiten beim Wrestling unter Beweis zu stellen, mit all dem ist er in dicken Strichen überdeutlich als Parodie angelegt, die, bei aller Sympathie, die Figur immer auch ein bisschen der Lächerlichkeit preisgibt.
Die Rede ist freilich von Tobey Maguires Interpretation von Peter Parker, aus dem schließlich Spider-Man und damit das Vorbild aller verunsicherten, Comics lesenden Jungs im besten Pubertätsalter wird, wie er in Sam Raimis erster Comicadaption zu sehen war. Das ist zehn Jahre her, trat den zuletzt wild wuchernden Superheldenboom im Kino los und zog zwei Fortsetzungen nach sich, die letzte (unsere Kritik) vor fünf Jahren. Dass Raimi seine Comicverfilmungen mit parodistischen Tönen anreichert - in seinem letzten Spider-Man-Film darf Peter Parker gar als Bee Gee durch New York tigern -, mag dem Mann im Blut liegen: Von Hause aus ist er Fachmann für burleske Splattereien, in denen schallendes Gelächter wahnsinnige Methode ist.

Mit was für einem auf den ersten Blick zwar sehr ähnlichen, dann aber doch ganz anderen Peter Parker man es nun in Marc Webbs neuem Film zu tun hat, der das Franchise auf Anfang setzt, als wäre nichts gewesen: Die Strukturen des alten ersten und des neuen ersten Films ähneln einander zwar zum Verwechseln, im Grunde handelt es sich um ein Remake mit leicht abgewandelten Parametern - doch die Textur ist eine andere. Sie ist wie das neue Spider-Man-Kostüm: detailliert bis in die Poren, kontrastreicher, haptischer, kurz: hochauflösend, statt flächendeckend.
Die parodistische Methode der Stoffaneignung bleibt aus, Darsteller Andrew Garfield verwandelt das Comicabziehbild in einen Charakter mit allen Höhen und Tiefen: Gleich zu Beginn, wenn Parkers Eltern - der Vater ist, mit weitreichenden Folgen, Gentechniker und offensichtlich in Gefahr - den Jungen in die Obhut von Onkel und Tante geben (die Eltern kommen wenig später zu Tode), zielt der Film auf eine emotionale Bindung an die Figur, statt sie, wie Raimi, als Oberfläche mit allerlei Andockmöglichkeiten anzulegen. Die High-School-Dramen des ewigen Außenseiters Peter Parker nuancieren die Figur, Garfield verleiht ihr mit jeder Bewegung zwischen Schlaksigkeit und gedruckster Haltung eine verbindliche körperliche Präsenz.
Eine Präsenz, die der Film zumal in den schönsten Passagen jedes ersten Superheldenfilms zu nutzen versteht, wenn der Held tapsig seine neuen Fähigkeiten entdeckt, die erst mal gründlich mit der gegenständlichen Welt kollidieren: Ein U-Bahnwaggon, ein pflichtbewusster Radiowecker, ein ganzes Badezimmer und manche Sporteinrichtung der High School gehen dem Zuschauer zur Freude gehörig zu Bruch. Noch mehr bejubelt man Parkers Erfolge bei waghalsigsten Skateboardmanövern. Regisseur Marc Webb, der mit seinem Kassenschlager "(500) Days of Summer" von der Indie-Romanze statt vom Splatterfilm zum Comicblockbuster kommt, weiß gut um das Potenzial solcher Szenen. Entsprechend ist dieses Vorspiel zur ersten Großtat des frischen Superhelden - New York wird von einer genmutierten Echse bedroht, die jenem Labor entspringt, dem auch Peter Parker seine Kräfte verdankt - keine abgehandelte Pflichtkür, sondern erhält im überlangen Film eine bemerkenswert privilegierte Gewichtung.

Und noch etwas hat sich verändert: Dieser Spider-Man blutet auffallend häufig und viel. Nicht selten kommt er zur Sorge der Pflegeeltern (darunter Martin Sheen als eine Art bodenständig-robuste Variante seiner US-Präsidentendarstellung in "The West Wing"), übel ramponiert von seiner Verbrecherhatz nach Hause: Den Parade-Emo-Indieboy mit verwuscheltem Haar und traurigem Blick, der aus melancholischer Verbundenheit zu seinem toten Vater dessen Brille aufträgt, spielt Andrew Garfield als fragiles, verletzliches Wesen, das am Ende schließlich, angeschossen und humpelnd, auf die Solidarität der Bauarbeiter New Yorks und deren Kräne angewiesen ist, um die Stadt vor dem Untergang zu bewahren.
Seit Sam Raimi den Superheldenboom in Gang getreten hat, hat sich das Genre gewandelt. Raimis erster Spinnenfilm - vor dem 11. September 2001 gedreht, doch erst im Sommer 2002 gestartet - war ein letzter Spätauslaufer einer noch unverbindlicheren und unschuldigeren Konzeption des Blockbusters, der mögliche Referenzen an den Terroranschlag in New York sorgsam tilgte (ein Vorab-Teaser mit Spinnennetz zwischen den Türmen des WTC verschwand rasch aus den Kinos). Wohl auch als Reaktion auf die schwermütigen Wagner-Opern, mit denen der Konkurrenzverlag DC seine Vorzeigehelden Superman und Batman gegenüber Marvel auf der Leinwand in Stellung brachte, positioniert sich der neue Spider-Man mit seinen düsteren Spitzen nun sehr bewusst am vorläufigen Ende dieser Traumageschichte, die endlich Erlösung findet: Zwar dräut auch hier eine gewaltige Hochhauskatastrophe über der Stadt, die aber schließlich vom geschundenen Helden abgewendet werden kann. Lyrisch-süße Melancholie eines kurz gestatteten Verdrängungsmoments im Bewusstsein seiner Falschheit: Imagine, es ist nichts passiert.
Schon deshalb darf Peter Parker hier nicht lächerlich sein, auch deshalb ist die Klammerung, die sich durch den alten und den neuen Film zwangsläufig um die letzten zehn Jahre schließt, gerechtfertigt - und damit auch dieses Remake nach so kurzer Zeit. Ganz zu schweigen davon, dass es fast schon nebenbei, doch mit Bravour das Versprechen jedes Blockbusters einhält: Mit flotten Actionszenen sein Publikum prächtig zu unterhalten.
Thomas Groh
---

"… and though the world is changing / I will be the same", so skizzierte einst der große Bryan Ferry in "Slave to Love" sein Selbstporträt als melancholischer Dandy und brachte gleichzeitig die zentrale Lebenslüge all jener Mitmenschen auf den (poetischen) Punkt, die gemeinhin zur Zielgruppe eines Filmes wie "Der Seidenfächer" gerechnet werden. Dessen Protagonistin Nina jedenfalls darf auf der Zielgeraden von Wayne Wangs Adaption des Bestsellers von Lisa See aus dem Off ein Kalendersprüchlein ähnlichen Inhalts aufsagen, und auf wesentlich mehr kommt man in der Tat nicht, wenn man am Ende der gefühlt recht langen 104 Minuten das Gesehene rekapituliert.
Um an diesen Punkt zu gelangen, betreibt Wang allerdings durchaus einigen narrativen Aufwand: Zwei Handlungsstränge flicht er ineinander - eine Rahmenhandlung im Shanghai des 21. Jahrhunderts sowie eine im 19. Jahrhundert verortete Binnenerzählung -, die jeweils das Motiv des laotong illustrieren, einer traditionell chinesischen Form der Mädchenfreundschaft, die ein Vertrag besiegelt und sich idealiter in lebenslanger, unverbrüchlicher Treue ausdrückt. Parallel gesetzt wird dabei die Geschichte von Nina und Sophia im Shanghai der Gegenwart mit der historischen Erzählung von Schneeblume und Lilie, die von der nach einem Fahrradunfall im Koma liegenden Sophia in einem Manuskript aufgeschrieben wurde und die sich schließlich als die wahre Geschichte einer Urahnin erweisen wird.

In der Engführung dieser beiden historisch voneinander getrennten Erzählstränge kommt allerdings gerade kein Interesse an den gewandelten historischen Normen im China der letzten zwei Jahrhunderte zum Ausdruck. Im Grunde inszeniert Wang seine beiden Narrative durchweg komplementär, was in der Besetzung der beiden Protagonistinnenpaare durch die jeweils in Doppelrollen agierenden Gianna Jun und Li Bingbing auch offen zutage tritt. Die historischen Folien, vor denen sie agieren, dienen lediglich als dekorative Kulissen für die Inszenierung visueller Pracht: auf der einen Seite die prunkvollen Farben der traditionellen chinesischen Gewänder, auf der anderen Seite die urbanen Lichtarchitekturen des gegenwärtigen Shanghai, die hier und da auch mal in angedeuteten Wischblenden - eine Art Lightversion von Christopher Doyle ikonischem Kamerastil in den Filmen Wong Kar-Wais - modisch aufbereitet werden.
Die visuellen Arabesken von "Der Seidenfächer" langweilen jedoch schnell, weil sie einerseits stets bloße Oberflächenverzierungen bleiben und sich jeder tiefgreifenderen Analyse der individuellen Psyche wie der sozialen Traditionen und Transformationsprozesse verweigern, andererseits auch weil sie schlicht und (wenig) ergreifend durchweg derivativ bleiben. Bei Zhang Yimou etwa, dessen Übersetzungen historischer Prozesse in Individualbiografien (etwa in "Leben!") als ein entferntes Vorbild betrachtet werden können, sind sowohl Prunk als auch Melodrama bereits wesentlich opulenter und vor allem mitreißender ins Kinobild gesetzt worden.
Noch schlimmer wird schließlich alles durch die fürchterlich gefühlige Musikuntermalung, die nahezu den gesamten Film mit schläfrigem Sentiment zukleistert und jeden letzten Rest von Ambition in bildungsbürgerlicher Teestundenatmosphäre erstickt. Alles um uns herum verändert sich, nur wenn wir in uns selbst hineinblicken, entdecken wir das Unveränderliche, so entlässt Wayne Wang, der seine küchenphilosophischen Banalitäten in den 1990er Jahren in den beiden Paul-Auster-Adaptionen "Smoke" und "Blue in the Face" auch schon einmal geschickter zu verpacken verstand, sein Publikum mit der Behauptung einer biografischen Kontinuität, von der man nicht so recht weiß, ob man sie als utopischen Sehnsuchtsort oder Alptraum begreifen sollte. "Der Seidenfächer" jedenfalls ist ein reiner Gebrauchsfilm, der seine Zielgruppe zu ergriffenem Beipflichten animieren und alle anderen Zuschauer vermutlich eher kaltlassen wird.
Jochen Werner
The Amazing Spider-Man - USA 2012 - Regie: Marc Webb - Darsteller: Andrew Garfield, Emma Stone, Rhys Ifans, Denis Leary, Campbell Scott, Martin Sheen, Sally Field, Chris Zylka, Irrfan Khan, Embeth Davidtz, Denis Leary, C. Thomas Howell, Annie Parisse -Länge: 136 min.
Der Seidenfächer - China/USA 2011 - Regie: Wayne Wang - Darsteller: BingBing Li, Gianna Jun, Yan Dai, Congmeng Guo, Vivian Wu, Coco Chiang, Archie Kao, Ruijia Zhang, Russell Wong, Hugh Jackman - Länge: 104 min.
Kommentieren