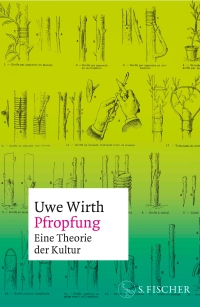Im Kino
Punktuelle Intensitäten
Die Filmkolumne. Von Lukas Foerster, Nikolaus Perneczky
29.02.2012. In Steve McQueens "Shame" driftet Michael Fassbender zombiegleich durch die Betten New Yorks. William Brent Bells Low-Budget-Exorzistenfilm "The Devil Inside" legt wert darauf, dass er ohne den Segen des Vatikan entstanden ist.
Steve McQueen, der 2008 mit dem viel beachteten "Hunger" den Schritt vom Turner-Preis-gekrönten Video- und Installationskünstler zum Regisseur kommerziell auswertbarer Langspielfilme vollzog, hat einen neuen Film gemacht, der in seinem Heimatland England zum Skandalwerk wurde. Was "Shame" diesen Ruf eingebracht hat, ist der Penis seines Hauptdarstellers Michael Fassbender, der in einigen hüfthohen Einstellungen flüchtig vorüberpendelt. Das muss eine hypnotische Wirkung auf die britischen Rezensenten ausgeübt haben - anders ist die ausnehmend positive, ja euphorische Aufnahme dieses doch recht einfach gestrickten Sittenbilds kaum zu erklären.
Fassbenders Figur Brandon lebt ein völlig leeres Dasein. Er arbeitet für irgendeine Firma in irgendeinem New Yorker Hochhaus an irgendetwas Windigem "mit Medien", für das sich "Shame" aber nicht im Geringsten interessiert. Anstatt zu arbeiten, konsumiert Brandon Internetpornografie, onaniert auf der Toilette, oder hängt erotischen Tagträumen mit einer Kollegin nach. Jede freie Stunde verbringt er mit Gedanken an Sex, die er nicht selten in die Tat umsetzt, je nach Verfügbarkeit mit einer Barbekanntschaft, einer Prostituierten, oder mit der Arbeitskollegin - Intensitäten eher als Beziehungen, die so schnell wieder verpuffen, wie sie eben noch aufgelodert waren. Nach dem Sex ist vor dem Sex: Leere. Nur in einer einzigen Szene, die darum den interessanten Eindruck erweckt, aus dem Film herauszufallen, deutet sich eine echte Hinwendung zum Anderen an, die aber im nächsten Moment schon scheitert. Im dunkelblauen New York von "Shame" gibt es keine Bindungen und Aggregatzustände, nur flüchtige Reaktionen ungleichartiger Teilchen.
Dass Fassbender diesen Getriebenen wie einen Zombie anlegt, ist nur konsequent. Nicht einmal zu sich selbst scheint Brandon eine nennenswerte Beziehung zu haben, mit Ausnahme vielleicht von der Scham, die der Titel beschwört, die aber Fassbenders gekonnt ausdrucksloses Spiel eigentlich gar nicht hergibt. Überhaupt besteht eine kognitive Dissonanz im Herzen von "Shame", der sich nicht entscheiden kann, ob sein Protagonist nun ein rein äußerlicher Mann ohne Eigenschaften sein soll, wofür Fassbenders apathisches Gesicht einsteht, oder ob Brandon doch zu Empfindungen und Innerlichkeit fähig ist, was die dramatische Bewegung des Films insgesamt nahezulegen scheint - und wenn auch nur als Möglichkeit zukünftigen Wachstums.

So stark und selbstsicher "Shame" mitunter darin ist, die punktuellen Intensitäten mitzuteilen, für die Brandon lebt oder doch vegetiert - neben seinen Eskapaden erwähnenswert ist ein nächtlicher Lauf durch Manhattan zur hingebungsvoll mitgesummten Bach-Einspielung Glenn Goulds -, so wenig überzeugt der Film in seiner übergeordneten Ambition, einen gültigen Kommentar zur Wohlstandspathologie der Stunde abzugeben: Brandon ist, Cosmo-Leser wissen es längst, ein sex addict.
Verkomplizierend hinzu kommt Brandons Schwester Sissy, der Carey Mulligan wenig mehr als ein vom Leben beschädigtes Blumenmädchen abgewinnt. In einer Szene, für die allein man sich "Shame" vielleicht doch ansehen sollte, singt Mulligan "New York, New York", mit Marilyn-Monroe-Hairdo auf der Bühne eines noblen Jazzclubs. Der Song ist verlangsamt, synkopiert, und nur minimal instrumentiert, ein paar Klavieranschläge hier und da, und Sissy/Mulligan singt sich, in einer lange gehaltene Nahaufnahme, um ihr schieres Leben, was Brandon eine einsame Träne entlockt.
Was Fassbenders Spiel und McQueens Bildgespür an visueller Evidenz entfalten, gerät aufs Ganze gesehen leider ins Hintertreffen gegenüber den immer penetranteren gesellschaftsdiagnostischen Zwischentönen des Films. Was als Fuge - mit formalen, narrativ entkoppelten Reiterationen und Variationen von Brandons Suchtverhalten - beginnt, mündet in die abgedroschene Melodei von Anomie und Entfremdung, und zuletzt in die (offen gelassene) Aussicht, dass aus dem Zombie eines Tages doch noch ein Mensch werden möge.
Nikolaus Perneczky
---

"The vatican did not endorse this film, nor aid in its completion", heißt es am Anfang. Eigentlich nicht die schlechtesten Voraussetzungen. Es geht um Isabella Rossi, eine junge Frau, deren Mutter einst, während eines an ihr vollzogenen Exorzismus, drei Menschen getötet haben soll. Sie landete dann nicht im Gefängnis, sondern in einer psychiatrischen Anstalt nahe Rom. Die Tochter, eine Amerikanerin, beschließt, einen Dokumentarfilm über ihre Mutter zu drehen. Als Rechtfertigung hält sie glückliche Kindheitsfotos in die Wackelkamera. Isabella reist also nach Italien. Die erste Einstellung dort zeigt sie gleich vor dem Kolosseum, es geht dann weiter in Richtung Petersdom und bald lernt sie zwei abtrünnige Priester kennen, die wenig von den offiziellen, viel zu strengen Teufelsaustreibungsrichtlinien halten und deswegen in ihrer Freizeit heimlich frisch drauflos exorzieren, dass es eine Art hat; Isabella hat nichts besseres zu tun, als sich ihnen anzuschließen und so nimmt das hahnebüchene Drama seinen Lauf. Man könnte allerdings auf die Idee kommen, die ganze Teufelsaustreiberei basiere von Anfang an auf einem zirkulären Fehlschluss: "Sometimes it takes an exorcism for a demon to reveal itself".
Man kann sich außerdem schon darüber wundern, dass ausgerechnet der Teufelsaustreibungsfilm auch gut vierzig Jahre nach William Friedkins einsamem Meisterwerk "The Exorcist" nicht totzubekommen ist, ein Genre, dessen antimoderne Schlagrichtung und sexistische Rollenaufteilung so offensichtlich sind, dass man kaum noch darauf zu sprechen kommen möchte. Im amerikanischen Kino werden trotzdem auch weiterhin Jahr für Jahr aufs neue fanatisierte alte - oder wie hier: junge - Männer auf junge Frauen losgelassen, die sich ein wenig daneben benommen haben. Und Jahr für Jahr aufs neue wird der Skeptiker mithilfe der scheinbaren Evidenz des Kamerablicks und der neuesten - oder wie hier: der altbackensten - Special effects eines besseren belehrt.

Umso erstaunlicher ist dieser fortgesetzte Erfolg, weil der Horrorfilm seit einigen Jahren keinen besonders guten Stand hat in Hollywood. Nach einer kleinen Welle ultraharter Splatterfilme Mitte des letzten Jahrzehnts kam nicht mehr viel nach, die Hoffnung ruht derzeit hauptsächlich auf sogenannten "found footage"-Streifen, extrem billig - und oft zunächst außerhalb des Studiosystems - zusammengeschusterten Filmen, die so tun, als wären sie von den Protagonisten selbst gedreht worden. So wie "The Devil Inside" eben.
In "The Devil Inside" tauchen neben den "dokumentarischen" Bildern - die von einem denkbar unbegabten Kameramann eingefangen werden; soviel Realismus muss sein - noch Polizeivideos, Bilder aus Überwachungskameras, Home movies mit gefälschter analoger Patina sowie ein Exorzistenvideo aus dem vatikanischen Untergrund auf. Dass in der modernen Welt alles irgendwie gefilmt wird, dass heutzutage jedes Ereignis quasi automatisch seine Bilder generiert: Diese nicht ganz von der Hand zu weisende Diagnose scheint sich in solchen Filmen zu artikulieren. Und die Schlussfolgerung des Horrorkinos scheint derzeit zu sein, dass eine objektive Perspektive, ein zumindest bis zu einem gewissen Grad unbeteiligter Blick, wie ihn die "unsichtbare Kamera" des klassischen Spielfilms simuliert, in solch einer Welt gar nicht mehr notwendig ist, dass man das Affektzentrum des Zielpublikums am einfachsten dann erreicht, wenn man die Subjektivierung, über die das Genre schon immer funktioniert hat, ins Bild selbst verlegt.
Auch und gerade Home movies sind allerdings, das vergessen die Produzenten solcher Filme regelmäßig, mit Liebe gemacht. Die neuen, billigen Horrorreißer Hollywoods hingegen zeichnen sich, von wenigen Ausnahmen abgesehen - "Paranormal Activity", der erfolgreichste amerikanische "found footage"-Horrorfilm, ist auch der beste, "The Devil Inside" ist ein besonders schlechter -, durch mangelnde Sorgfalt und ein komplettes Desinteresse an den eigenen Figuren aus. Macht nichts, der Film scheint die Marktmechanismen des Alltagsbetriebs ohnehin ausgehebelt zu haben: "The Devil Inside", ein Film ohne Stars, hatte ein Produktionsbudget von einer Million Dollar und spielte mithilfe einer cleveren Werbekampagne alleine in den USA mehr als das Fünfzigfache ein. Der Vertrieb, die Paramount, darf darauf stolz sein: so stolz wie ein Trickbetrüger, der mit einem besonders dreisten Coup davongekommen ist.
Lukas Foerster
Shame - Großbritannien / USA 2011 - Regie: Steve McQueen - Darsteller: Michael Fassbender, Carey Mulligan, James Badge Dale, Hannah Ware, Amy Hargreaves, Nicole Beharie, Mari-Ange Ramirez - Prädikat: besonders wertvoll - Länge: 100 min.
The Devil Inisde - USA 2011 -Regie: William Brent Bell - Darsteller:Fernanda Andrade, Simon Quarterman, Evan Helmuth, Suzan Crowley, Ionut Grama, Bonnie Morgan, Brian Johnson, Preston James Hillier - FSK: ab 16 - Länge:87 min.
Kommentieren