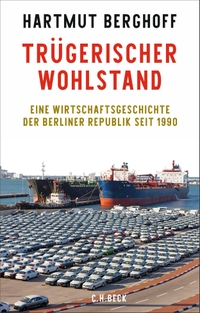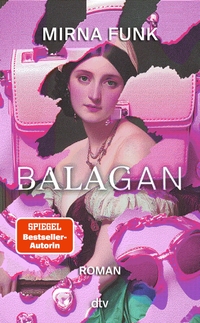Im Kino
Temporäre Inseln
Die Filmkolumne. Von Thomas Groh, Nikolaus Perneczky
27.05.2015. Total anstößig: Brad Peytons "San Andreas", ein Katastrophenfilm im doppelten Sinn. Total unanstößig: George Ovashvilis gnadenlos ausbuchstabierte Flusspastorale "Die Maisinsel"."We"ll sink with California,
when it falls into the sea."
Youth Brigade: Sink with California (1983)

Vielleicht hat es der Hollywoodblockbuster dem 11. September nie ganz verziehen, dass er in Sachen erschütternder ikonischer Wucht dem terroristischen Großanschlag aus dem Jahr 2001 bis heute nicht recht das Wasser reichen kann. Vielleicht auch deshalb häufen sich seit einigen Jahren die Bilder einstürzender Skylines in den entsprechenden Großproduktionen: Durch inflationären Gebrauch wird jedes ikonische Bild irgendwann abgenutzt - und der Blockbuster kann sich wieder freier entfalten. Vor allem aber bietet sich im redundanten, jedes Jahr dank technologischem Fortschritt immer noch ein bisschen beeindruckenderen Hochhaus-Einsturz die Möglichkeit, lustvoll jene Leerstellen auszukundschaften und spekulativ zu füllen, die 9/11 als reales Ereignis ohne Postproduktion und die Vorzüge einer agilen Kamera notwendig hinterlassen hat: Wie hat das wohl aus der Ich-Perspektive auf den letzten Metern ausgesehen, als das Flugzeug mit vollem Karacho ins World Trade Center crashte? Was ging in dem Gebäude wohl unmittelbar nach dem Crash ab, insbesondere in den zwei, drei, vier Stockwerken unter Einschlaghöhe?
Nun bietet ein Film wie "San Andreas", in dem das stärkste jemals in der Menschheitsgeschichte verzeichnete Erdbeben weite Teile Kaliforniens erst vom Festland abzutrennen droht und schließlich die Metropolen dank Tsunami weitgehend unter Wasser setzt, keine Möglichkeit, ein Flugzeug in ein Wolkenkratzer rasen zu lassen, doch dafür allerlei lustvoll aneinander gereihte Möglichkeiten zu äquivalenten Szenarien, in denen beispielsweise eine Kamera, narrativ völlig unmotiviert, wie ein Projektil auf die Glasfassade eines erschütterten Gebäudes zurasen und selbige durchschlagen darf, um dann aus einer gefräßigen Quasi-Ich-Perspektiven-Plansequenz den Zuschauer dabei zusehen zu lassen, wie alles auf der Etage den Bach runtergeht und sich dem Chaos überantwortet. Wenn dann noch in einer sichtlich aufgeführten Choreografie immer mal wieder Leute ins Bild hopsen, um im Nu von irgendetwas wieder aus demselben gerissen zu werden, entwickelt das einen rustikalen, obwohl wahrscheinlich unfreiwilligen Humor, der seine Krönung in einem Ballett der Unwahrscheinlichkeiten erfährt: Einer Frau (Carla Gugino) gelingt es tatsächlich, sich aus diesem Schlamassel aufs Dach zu retten, wo just in diesem Moment ihr in Scheidung befindlicher Ehemann (Dwayne Johnson) mit einem Hubschrauber vorbeifliegt, der sich zu dieser Sekunde an einem völlig anderen Ort aufhalten sollte. So viel unverschämtes Glück hätte man den Leuten aus dem World Trade Center auch gewünscht. Vielen von ihnen blieb nur der Sprung in die Tiefe, wodurch sie sich als Schemen und Striche ins mediale Gedächtnis der 2001 noch wenig hochauflösenden Fernsehbilder einschrieben. Auch diesbezüglich liefert "San Andreas" in HD und 3D verspätete Konkretisierungen nach.
Kurz: "San Andreas" ist nach Jahren voller Subtextausdeutungen, vermuteten oder konkreten Traumaverarbeitungen im Hollywoodkino nicht nur - erst recht im brachial pathetischen Schlussbild, das an der Kippe zur Parodie schwer ins Straucheln gerät - eine auf Restauration drängende Angelegenheit, sondern auch, wohl wegen der immerhin schon 14 Jahre historischer Distanz, auf ziemlich unbekümmerte Weise beherzt, bzw. eben deppert im Zugriff. 9/11 hatte zwei towers, "San Andreas" kippt nach Lust und Laune Türme, Türme und wieder Türme um, gerade so, wie es dem Drehbuch passt; fast grenzt das an infantile Insistenz gegenüber dem bildgebenden Großereignis. Geprägt ist das Ganze von einer Sensationslust, die sich gerade noch am Riemen reißen kann, aber fast platzt vor Prahllust: In den für Katastrophenthriller dieses Zuschnitts obligatorischen "Wissenschaftler werten im Labor Daten aus"-Szenen darf Paul Giamatti in der Rolle eines Erdbebenforschers mit grimmiger Miene darauf hinweisen, dass dies nun wirklich, aber mal wirklich das verdammt größte Erdbeben aller Zeiten ist (im kurzen Vorspiel referiert er kurz die Geschichte der schwersten Erdbeben - schon da hat der Film seine lieben Schwierigkeiten, in froher Erwartung dessen, was noch kommen mag, an sich zu halten). Worin sich die Rolle dieser Figur im wesentlichen auch erschöpft: Im Labor sitzen, ab und an gerüttelt werden, Richterskala-Werte durchgeben als stünden sich Deutschland und Brasilien im Halbfinale gegenüber.

Jedes Kamera-Panorama in (im übrigen: beeindruckenden) 3D dient dem Zweck lustvoll zu präsentieren, was auf jeden Fall in absehbarer Zeit zu Klump gehauen wird - so, als wäre die Leinwand das Schaufenster einer Konditorei. Derart genießerisch hat schon lange kein Film mehr seine Katastrophen antizipiert und ausgekostet. Richtig awesome wird es beim Tsunami, der ebenfalls der größte seiner Art ist und ordentlich Luxusdampfer in die Stadt spült: Dagegen sieht Al-Qaida alt aus - einen Dampfer dieses Ausmaßes haben die Terroristen nachweislich nicht ins Zentrum von Manhattan geschmissen, hier ruiniert ein solcher auf beeindruckende Weise das Straßenbild. In diesem Kräftemessen geht der Blockbuster eindeutig in Führung.
Das Drumherum ist Schema F - und das tritt teils schmerzhaft zutage. Die Zutaten kennt man von Katastrophen-Fachmann Roland Emmerich: Wissenschaftler-Kokolores, unwahrscheinlicher Held, eine Trümmer-Ehe, die über den Trümmern der Zivilisation gekittet wird, Kinder, um die zu bangen ist. Doch wo Emmerich seinen Teig vielleicht nicht unbedingt gut, aber doch auf seine Weise organisch verrührt, bleibt bei Brad Peyton jeder Bestandteil samt Funktion als solcher deutlich zu erkennen - bis hin zum nervigen Klugscheißerkind (frühes Karrieretief: Art Parkinson). Frivoles Amüsement bietet der Film immerhin denjenigen, die sich auf den Subtext einlassen können, der darin verborgen liegt, dass die San-Andreas-Spalte dem phallischen Äußeren der Hochhäuser den Krieg erklärt hat, in dessen Verlauf der nicht minder phallische, glatzenbedingt auch tatsächlich penishaft wirkende Dwayne Johnson alle Hände voll zu tun hat, Schlimmstes abzuwenden.
Möseale gegen phallische Formen - "San Andreas", ein Film über den aus dem Erdreich heraus wirkenden Mythos der Vagina Dentata samt in Folge reihenweise auftretenden Erektionsstörungen? Dazu passt ganz gut, dass auch eine Ehe gerettet, dem Mann die Gespielin wieder gefügig gemacht werden muss: Wenn Johnson seine Ehefrau Gugino im Kombi-Fallschirm mit leichter Hand auf den sicheren Boden eines Baseball-Stadions bringt, kommt ihm ein so verschmitztes wie eindeutig zweideutiges "Been a while since I brought you to second base" über die Lippen. Immerhin darf Johnsons Tochter (Alexandra Daddario) im Nebenstrang der Handlung als taffe, smarte Tochter ihres Vaters regelmäßig gute Ideen haben, fortlaufend einen ziemlichen Wimp und Verzichter (Hugo Johnstone-Burt) vor dem Schlimmsten bewahren und sich dennoch in ihn verlieben. Zur Strafe für diese progressive Rollenverteilung hat sich der Film für sie ausgedacht, dass sie erst ihr Shirt ausziehen muss und dann im Unterhemd nass gemacht wird. Höhö.
Oder kurz: Dieser gigantische Desasterfilm ist ein gigantisches Desaster. Man muss sich schon sehr anstrengen, um ihn sich ein wenig lustig zu machen.
Thomas Groh
San Andreas - USA 2015 - Regie: Brad Peyton - Darsteller: Dwayne Johnson, Carla Gugino, Alexandra Daddario, Paul Giamatti, Art Parkinson, Colton Hayes, Kylie Minogue - Laufzeit: 114 Minuten.
---

"Der Herr gibt es und der Herr wird es wieder nehmen", sagt der namenlose abchasische Bauer (İlyas Salman) zu seiner Enkelin (Mariam Buturishvili), als die ihn fragt, wem das in der Mitte des Flusses vorübergehend angeschwemmte Stück Land gehört, auf dessen besonders fruchtbarem Alluvialboden genügend Mais wachsen wird, um die Familie durch den nächsten Winter zu bringen. Der Zyklus von Entstehen und Vergehen, den "Die Maisinsel" durchmisst, betrifft nicht nur die Figuren und ihr Tun, sondern den Ort der Handlung selbst, eine der temporären Inseln, die alljährlich im Fluss Enguri sedimentieren, dessen Verlauf zudem die politisch labile Grenze zwischen Georgien und der autonomen Republik Abchasien markiert. Daran lässt der neue Film des georgischen Regisseurs George Ovashvili keinen Zweifel: Man muss sich die harte Arbeit und das einfache Dasein auf dem winzigen, von wogenden Wassermassen um- und unterspülten Maisfeld als erfüllend vorstellen. Eine vormoderne, wider das romantische Klischee jedoch radikal unverwurzelte Lebensweise ist das, die nur vorübergehende Nutzungsrechte anmeldet, aber keine dauerhaften Besitzansprüche stellt.
Die spezifischen Affekte dieser Lebensweise (die befriedigende Arbeit, der vertraute Tagesablauf, aber auch Einsamkeit und Isolation) versucht der Film sinnlich nachvollziehbar zu machen, mit nur halbwegs überzeugenden Mitteln. Anfangs kommt kurz der Verdacht auf, "Die Maisinsel" eifere dem (inzwischen gut eingeführten) Weltkino-Minimalismus à la (zum Beispiel) Lisandro Alonso nach, wo Einstellungen ausdauernd, unterbestimmt und nur bedingt lesbar sind. Tatsächlich hat Ovashvili überall Schienen gelegt, auf denen die Kamera ihre Halbkreise um das Geschehen zieht; geschmackvoll zurückgenommene Choreographien, abgerundet bis zur totalen Unanstößigkeit. Auf der Insel, dem alleinigen Schauplatz der fast wortlosen Erzählung, errichtet der Bauer, ein alter Mann mit weißem Bart und pockenvernarbter Nase, Schritt für Arbeitsschritt eine Hütte, ein Feld sowie Befestigungen aus Holz und Schilf, um das Saatbett gegen drohende Überflutungen zu schützen. Zu sehen ist dabei immer nur ein Ausschnitt - Verrichtungen werden angefangen, elliptisch abgekürzt und dann im bereits fertigen Zustand vorgeführt. Das Tagwerk ist vollbracht, der alte Mann lächelt zufrieden - ganz schön dünn für einen Film, der so viel auf Arbeit hält.

Dabei zuzusehen, wie die unwahrscheinliche Inselfarm des abchasischen Bauern allmählich Gestalt annimmt im Schweiße seines Angesichts, ist über weite Strecken dennoch faszinierend. Dann aber ist das Set fertiggebaut und das Drama, das sich bisher höchstens in musikalischen Einsätzen angedeutet hatte, muss beginnen. Es involviert neben der pubertierenden Enkelin, deren Brustansatz sich (inselgleich) unterm nassen Kleid abhebt, noch einige weitere Figuren, Soldaten allesamt, die in Motorbooten und beim Lärm von Gewehrsalven aus der umliegenden politischen Realität einfallen - mehr soll nicht verraten werden. Diese zweite Filmhälfte, in der sich Ovashvili zum Erzähler aufschwingt, funktioniert wesentlich schlechter als die Flusspastorale des Anfangs. Die allegorischen Ebenen, die "Die Maisinsel" vorher aufgeworfen hat, werden personalisiert und entlang vorhersehbarer Routen gnadenlos ausbuchstabiert, bis keine Fragen mehr offen sind.
Den territorialen Grenzkämpfen stellt Ovashvili eine nomadische Form der Landwirtschaft entgegen, die an Grund und Boden nur vorübergehenden Halt findet. Man weiß (weil ein informativer Zwischentitel es antizipiert), was am Ende kommen wird. Dennoch ist man nicht darauf vorbereitet, wenn die Insel, nachdem der Bauer und seine Enkelin einen ganzen Sommer auf ihr geschuftet haben, urplötzlich erodiert, von den Wassermassen auseinandergebrochen wird und schließlich, stückweise, in den Schnellen verschwindet. Ein großartiges Schlußbild wäre das, wenn Ovashvili nicht, wie so oft, noch eins nachsetzen müsste, damit es ja alle verstehen: Der Kreis schließt sich.
Nikolaus Perneczky
Die Maisinsel - Georgien 2014 - Originaltitel: Simindis kundzuli - Regie: George Ovashvili - Darsteller: Ilyas Salman, Mariam Buturishvili, Irakli Samushia, Tamer Levent - Laufzeit: 100 Minuten.
when it falls into the sea."
Youth Brigade: Sink with California (1983)

Vielleicht hat es der Hollywoodblockbuster dem 11. September nie ganz verziehen, dass er in Sachen erschütternder ikonischer Wucht dem terroristischen Großanschlag aus dem Jahr 2001 bis heute nicht recht das Wasser reichen kann. Vielleicht auch deshalb häufen sich seit einigen Jahren die Bilder einstürzender Skylines in den entsprechenden Großproduktionen: Durch inflationären Gebrauch wird jedes ikonische Bild irgendwann abgenutzt - und der Blockbuster kann sich wieder freier entfalten. Vor allem aber bietet sich im redundanten, jedes Jahr dank technologischem Fortschritt immer noch ein bisschen beeindruckenderen Hochhaus-Einsturz die Möglichkeit, lustvoll jene Leerstellen auszukundschaften und spekulativ zu füllen, die 9/11 als reales Ereignis ohne Postproduktion und die Vorzüge einer agilen Kamera notwendig hinterlassen hat: Wie hat das wohl aus der Ich-Perspektive auf den letzten Metern ausgesehen, als das Flugzeug mit vollem Karacho ins World Trade Center crashte? Was ging in dem Gebäude wohl unmittelbar nach dem Crash ab, insbesondere in den zwei, drei, vier Stockwerken unter Einschlaghöhe?
Nun bietet ein Film wie "San Andreas", in dem das stärkste jemals in der Menschheitsgeschichte verzeichnete Erdbeben weite Teile Kaliforniens erst vom Festland abzutrennen droht und schließlich die Metropolen dank Tsunami weitgehend unter Wasser setzt, keine Möglichkeit, ein Flugzeug in ein Wolkenkratzer rasen zu lassen, doch dafür allerlei lustvoll aneinander gereihte Möglichkeiten zu äquivalenten Szenarien, in denen beispielsweise eine Kamera, narrativ völlig unmotiviert, wie ein Projektil auf die Glasfassade eines erschütterten Gebäudes zurasen und selbige durchschlagen darf, um dann aus einer gefräßigen Quasi-Ich-Perspektiven-Plansequenz den Zuschauer dabei zusehen zu lassen, wie alles auf der Etage den Bach runtergeht und sich dem Chaos überantwortet. Wenn dann noch in einer sichtlich aufgeführten Choreografie immer mal wieder Leute ins Bild hopsen, um im Nu von irgendetwas wieder aus demselben gerissen zu werden, entwickelt das einen rustikalen, obwohl wahrscheinlich unfreiwilligen Humor, der seine Krönung in einem Ballett der Unwahrscheinlichkeiten erfährt: Einer Frau (Carla Gugino) gelingt es tatsächlich, sich aus diesem Schlamassel aufs Dach zu retten, wo just in diesem Moment ihr in Scheidung befindlicher Ehemann (Dwayne Johnson) mit einem Hubschrauber vorbeifliegt, der sich zu dieser Sekunde an einem völlig anderen Ort aufhalten sollte. So viel unverschämtes Glück hätte man den Leuten aus dem World Trade Center auch gewünscht. Vielen von ihnen blieb nur der Sprung in die Tiefe, wodurch sie sich als Schemen und Striche ins mediale Gedächtnis der 2001 noch wenig hochauflösenden Fernsehbilder einschrieben. Auch diesbezüglich liefert "San Andreas" in HD und 3D verspätete Konkretisierungen nach.
Kurz: "San Andreas" ist nach Jahren voller Subtextausdeutungen, vermuteten oder konkreten Traumaverarbeitungen im Hollywoodkino nicht nur - erst recht im brachial pathetischen Schlussbild, das an der Kippe zur Parodie schwer ins Straucheln gerät - eine auf Restauration drängende Angelegenheit, sondern auch, wohl wegen der immerhin schon 14 Jahre historischer Distanz, auf ziemlich unbekümmerte Weise beherzt, bzw. eben deppert im Zugriff. 9/11 hatte zwei towers, "San Andreas" kippt nach Lust und Laune Türme, Türme und wieder Türme um, gerade so, wie es dem Drehbuch passt; fast grenzt das an infantile Insistenz gegenüber dem bildgebenden Großereignis. Geprägt ist das Ganze von einer Sensationslust, die sich gerade noch am Riemen reißen kann, aber fast platzt vor Prahllust: In den für Katastrophenthriller dieses Zuschnitts obligatorischen "Wissenschaftler werten im Labor Daten aus"-Szenen darf Paul Giamatti in der Rolle eines Erdbebenforschers mit grimmiger Miene darauf hinweisen, dass dies nun wirklich, aber mal wirklich das verdammt größte Erdbeben aller Zeiten ist (im kurzen Vorspiel referiert er kurz die Geschichte der schwersten Erdbeben - schon da hat der Film seine lieben Schwierigkeiten, in froher Erwartung dessen, was noch kommen mag, an sich zu halten). Worin sich die Rolle dieser Figur im wesentlichen auch erschöpft: Im Labor sitzen, ab und an gerüttelt werden, Richterskala-Werte durchgeben als stünden sich Deutschland und Brasilien im Halbfinale gegenüber.

Jedes Kamera-Panorama in (im übrigen: beeindruckenden) 3D dient dem Zweck lustvoll zu präsentieren, was auf jeden Fall in absehbarer Zeit zu Klump gehauen wird - so, als wäre die Leinwand das Schaufenster einer Konditorei. Derart genießerisch hat schon lange kein Film mehr seine Katastrophen antizipiert und ausgekostet. Richtig awesome wird es beim Tsunami, der ebenfalls der größte seiner Art ist und ordentlich Luxusdampfer in die Stadt spült: Dagegen sieht Al-Qaida alt aus - einen Dampfer dieses Ausmaßes haben die Terroristen nachweislich nicht ins Zentrum von Manhattan geschmissen, hier ruiniert ein solcher auf beeindruckende Weise das Straßenbild. In diesem Kräftemessen geht der Blockbuster eindeutig in Führung.
Das Drumherum ist Schema F - und das tritt teils schmerzhaft zutage. Die Zutaten kennt man von Katastrophen-Fachmann Roland Emmerich: Wissenschaftler-Kokolores, unwahrscheinlicher Held, eine Trümmer-Ehe, die über den Trümmern der Zivilisation gekittet wird, Kinder, um die zu bangen ist. Doch wo Emmerich seinen Teig vielleicht nicht unbedingt gut, aber doch auf seine Weise organisch verrührt, bleibt bei Brad Peyton jeder Bestandteil samt Funktion als solcher deutlich zu erkennen - bis hin zum nervigen Klugscheißerkind (frühes Karrieretief: Art Parkinson). Frivoles Amüsement bietet der Film immerhin denjenigen, die sich auf den Subtext einlassen können, der darin verborgen liegt, dass die San-Andreas-Spalte dem phallischen Äußeren der Hochhäuser den Krieg erklärt hat, in dessen Verlauf der nicht minder phallische, glatzenbedingt auch tatsächlich penishaft wirkende Dwayne Johnson alle Hände voll zu tun hat, Schlimmstes abzuwenden.
Möseale gegen phallische Formen - "San Andreas", ein Film über den aus dem Erdreich heraus wirkenden Mythos der Vagina Dentata samt in Folge reihenweise auftretenden Erektionsstörungen? Dazu passt ganz gut, dass auch eine Ehe gerettet, dem Mann die Gespielin wieder gefügig gemacht werden muss: Wenn Johnson seine Ehefrau Gugino im Kombi-Fallschirm mit leichter Hand auf den sicheren Boden eines Baseball-Stadions bringt, kommt ihm ein so verschmitztes wie eindeutig zweideutiges "Been a while since I brought you to second base" über die Lippen. Immerhin darf Johnsons Tochter (Alexandra Daddario) im Nebenstrang der Handlung als taffe, smarte Tochter ihres Vaters regelmäßig gute Ideen haben, fortlaufend einen ziemlichen Wimp und Verzichter (Hugo Johnstone-Burt) vor dem Schlimmsten bewahren und sich dennoch in ihn verlieben. Zur Strafe für diese progressive Rollenverteilung hat sich der Film für sie ausgedacht, dass sie erst ihr Shirt ausziehen muss und dann im Unterhemd nass gemacht wird. Höhö.
Oder kurz: Dieser gigantische Desasterfilm ist ein gigantisches Desaster. Man muss sich schon sehr anstrengen, um ihn sich ein wenig lustig zu machen.
Thomas Groh
San Andreas - USA 2015 - Regie: Brad Peyton - Darsteller: Dwayne Johnson, Carla Gugino, Alexandra Daddario, Paul Giamatti, Art Parkinson, Colton Hayes, Kylie Minogue - Laufzeit: 114 Minuten.
---

"Der Herr gibt es und der Herr wird es wieder nehmen", sagt der namenlose abchasische Bauer (İlyas Salman) zu seiner Enkelin (Mariam Buturishvili), als die ihn fragt, wem das in der Mitte des Flusses vorübergehend angeschwemmte Stück Land gehört, auf dessen besonders fruchtbarem Alluvialboden genügend Mais wachsen wird, um die Familie durch den nächsten Winter zu bringen. Der Zyklus von Entstehen und Vergehen, den "Die Maisinsel" durchmisst, betrifft nicht nur die Figuren und ihr Tun, sondern den Ort der Handlung selbst, eine der temporären Inseln, die alljährlich im Fluss Enguri sedimentieren, dessen Verlauf zudem die politisch labile Grenze zwischen Georgien und der autonomen Republik Abchasien markiert. Daran lässt der neue Film des georgischen Regisseurs George Ovashvili keinen Zweifel: Man muss sich die harte Arbeit und das einfache Dasein auf dem winzigen, von wogenden Wassermassen um- und unterspülten Maisfeld als erfüllend vorstellen. Eine vormoderne, wider das romantische Klischee jedoch radikal unverwurzelte Lebensweise ist das, die nur vorübergehende Nutzungsrechte anmeldet, aber keine dauerhaften Besitzansprüche stellt.
Die spezifischen Affekte dieser Lebensweise (die befriedigende Arbeit, der vertraute Tagesablauf, aber auch Einsamkeit und Isolation) versucht der Film sinnlich nachvollziehbar zu machen, mit nur halbwegs überzeugenden Mitteln. Anfangs kommt kurz der Verdacht auf, "Die Maisinsel" eifere dem (inzwischen gut eingeführten) Weltkino-Minimalismus à la (zum Beispiel) Lisandro Alonso nach, wo Einstellungen ausdauernd, unterbestimmt und nur bedingt lesbar sind. Tatsächlich hat Ovashvili überall Schienen gelegt, auf denen die Kamera ihre Halbkreise um das Geschehen zieht; geschmackvoll zurückgenommene Choreographien, abgerundet bis zur totalen Unanstößigkeit. Auf der Insel, dem alleinigen Schauplatz der fast wortlosen Erzählung, errichtet der Bauer, ein alter Mann mit weißem Bart und pockenvernarbter Nase, Schritt für Arbeitsschritt eine Hütte, ein Feld sowie Befestigungen aus Holz und Schilf, um das Saatbett gegen drohende Überflutungen zu schützen. Zu sehen ist dabei immer nur ein Ausschnitt - Verrichtungen werden angefangen, elliptisch abgekürzt und dann im bereits fertigen Zustand vorgeführt. Das Tagwerk ist vollbracht, der alte Mann lächelt zufrieden - ganz schön dünn für einen Film, der so viel auf Arbeit hält.

Dabei zuzusehen, wie die unwahrscheinliche Inselfarm des abchasischen Bauern allmählich Gestalt annimmt im Schweiße seines Angesichts, ist über weite Strecken dennoch faszinierend. Dann aber ist das Set fertiggebaut und das Drama, das sich bisher höchstens in musikalischen Einsätzen angedeutet hatte, muss beginnen. Es involviert neben der pubertierenden Enkelin, deren Brustansatz sich (inselgleich) unterm nassen Kleid abhebt, noch einige weitere Figuren, Soldaten allesamt, die in Motorbooten und beim Lärm von Gewehrsalven aus der umliegenden politischen Realität einfallen - mehr soll nicht verraten werden. Diese zweite Filmhälfte, in der sich Ovashvili zum Erzähler aufschwingt, funktioniert wesentlich schlechter als die Flusspastorale des Anfangs. Die allegorischen Ebenen, die "Die Maisinsel" vorher aufgeworfen hat, werden personalisiert und entlang vorhersehbarer Routen gnadenlos ausbuchstabiert, bis keine Fragen mehr offen sind.
Den territorialen Grenzkämpfen stellt Ovashvili eine nomadische Form der Landwirtschaft entgegen, die an Grund und Boden nur vorübergehenden Halt findet. Man weiß (weil ein informativer Zwischentitel es antizipiert), was am Ende kommen wird. Dennoch ist man nicht darauf vorbereitet, wenn die Insel, nachdem der Bauer und seine Enkelin einen ganzen Sommer auf ihr geschuftet haben, urplötzlich erodiert, von den Wassermassen auseinandergebrochen wird und schließlich, stückweise, in den Schnellen verschwindet. Ein großartiges Schlußbild wäre das, wenn Ovashvili nicht, wie so oft, noch eins nachsetzen müsste, damit es ja alle verstehen: Der Kreis schließt sich.
Nikolaus Perneczky
Die Maisinsel - Georgien 2014 - Originaltitel: Simindis kundzuli - Regie: George Ovashvili - Darsteller: Ilyas Salman, Mariam Buturishvili, Irakli Samushia, Tamer Levent - Laufzeit: 100 Minuten.
4 Kommentare