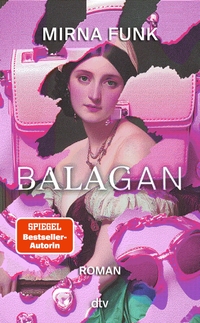Magazinrundschau
Teils Bruegel, teils Goya
Ein Blick in internationale Magazine. Jeden Dienstag Mittag
11.11.2025. Granta vermisst den indischen Literaturkontinent. HVG trauert um Peter György. Der New Yorker ist jetzt schon frustriert beim Gedanken an das 250-Jahr-Jubiläum der amerikanischen Unabhängigkeit. New Lines betrachtet fasziniert Fotos der jesidischen Bevölkerung Iraks in den 1930ern. In Eurozine erklärt der Historiker Gary Gerstle, wo sich Donald Trump und Bernie Sanders ähneln. Die New York Times vermisst die Golden Hour auf den Schlachtfeldern in der Ukraine.
Granta (UK), 11.11.2025
 Grantas neue Ausgabe ist den indischen Sprachen gewidmet. Hintergrund ist, dass indische Autoren nicht mehr auf Englisch schreiben müssen, um in ihrem eigenen Land mit seinen allein 23 Amtsprachen gelesen oder international wahrgenommen zu werden (hier Thomas Meaneys Einführung). Eine sehr gute Entwicklung, findet Salman Rushdie im Interview: "Ich denke, es sind drei Dinge passiert. Erstens ist die Verlagsbranche in Indien mittlerweile viel etablierter. Sie ist größer als je zuvor. Zweitens fängt man an, zu übersetzen. Eines der großen Probleme in Indien war immer die Übersetzung zwischen den indischen Sprachen. Wenn man auf Bengali schrieb, konnte niemand auf Hindi lesen, was auch für Tagore galt. Die vorhandenen Übersetzungen waren oft nicht besonders gut. All das hat sich stark verbessert, sodass die Menschen nicht mehr auf die gleiche Weise auf den Sprachraum beschränkt sind - sie können Grenzen überschreiten, so wie Englisch Grenzen überschreitet. Und drittens hat sich das Schreiben in englischer Sprache in so vielen Formen verbreitet; es sind nicht mehr nur literarische Romane. Jetzt gibt es Trivialliteratur, Liebesromane, erotische Romane, sodass das Spektrum des Verlagswesens viel breiter geworden ist, was gesünder ist. Ich glaube, junge Schriftsteller, die heute in Indien anfangen, empfinden vielleicht nicht mehr das, was ich empfunden habe, nämlich dass ich dort eigentlich nicht anfangen konnte, weil es keine literarische Welt gab. Jetzt gibt es eine literarische Welt."
Grantas neue Ausgabe ist den indischen Sprachen gewidmet. Hintergrund ist, dass indische Autoren nicht mehr auf Englisch schreiben müssen, um in ihrem eigenen Land mit seinen allein 23 Amtsprachen gelesen oder international wahrgenommen zu werden (hier Thomas Meaneys Einführung). Eine sehr gute Entwicklung, findet Salman Rushdie im Interview: "Ich denke, es sind drei Dinge passiert. Erstens ist die Verlagsbranche in Indien mittlerweile viel etablierter. Sie ist größer als je zuvor. Zweitens fängt man an, zu übersetzen. Eines der großen Probleme in Indien war immer die Übersetzung zwischen den indischen Sprachen. Wenn man auf Bengali schrieb, konnte niemand auf Hindi lesen, was auch für Tagore galt. Die vorhandenen Übersetzungen waren oft nicht besonders gut. All das hat sich stark verbessert, sodass die Menschen nicht mehr auf die gleiche Weise auf den Sprachraum beschränkt sind - sie können Grenzen überschreiten, so wie Englisch Grenzen überschreitet. Und drittens hat sich das Schreiben in englischer Sprache in so vielen Formen verbreitet; es sind nicht mehr nur literarische Romane. Jetzt gibt es Trivialliteratur, Liebesromane, erotische Romane, sodass das Spektrum des Verlagswesens viel breiter geworden ist, was gesünder ist. Ich glaube, junge Schriftsteller, die heute in Indien anfangen, empfinden vielleicht nicht mehr das, was ich empfunden habe, nämlich dass ich dort eigentlich nicht anfangen konnte, weil es keine literarische Welt gab. Jetzt gibt es eine literarische Welt."Einfach ist es allerdings nicht, gibt der Übersetzer Jerry Pinto zu: "In Indien bedeutet Übersetzen, sich dieser verschiedenen Ebenen bewusst zu sein - Religion, Kaste, Klasse, Region, Geschlecht. Es ist ein Land, in dem vier große Religionen entstanden sind, in das das Christentum noch vor Rom gelangte und in dem die drittgrößte muslimische Bevölkerung der Welt lebt. Man beginnt mit einem einzigen Buchstaben - रे - und bewegt sich schließlich durch Kasten, Klassen und Zugehörigkeiten."
Was man allerdings komplett vergessen kann, ist die Reinheit einer Sprache, meint der Autor Aatish Taseer, selbst halb Inder, halb Pakistani. "Hindi und Urdu sind wie zwei fließende, sich wandelnde Schwestern, Yin und Yang, von denen jede einen Teil der anderen in sich trägt. Ihre Syntax und Struktur sind identisch, aber während Urdu seinen Wortschatz aus dem Persischen und Arabischen bezieht, hat sich Hindi im Indien nach der Teilung sanskritisiert", so Taseer, der selbst spät Urdu lernte. "Zafar Moradabadi, mein Dichterlehrer, war ein zierlicher Mann in einem Safari-Anzug, Sonnenbrille und weißer Schirmmütze. Er war voller Trauer über die Spaltung der Sprache in religiöse Lager. Aber trotz all seiner Melancholie lehnte er die Idee ab, Urdu in Devanagari-Schrift zu schreiben - was in Indien seit Jahrzehnten praktiziert wird. 'Eine Schrift', sagte er und reagierte gereizt auf meine Unverschämtheit, 'enthält den Geist einer Sprache.' Obwohl er es nicht gutheißen wollte, dass Urdu in Hindi geschrieben wurde, war er fest davon überzeugt, dass die Seele des Urdu nicht in seiner Reinheit, sondern in seiner Umgangssprache lag. Er erzählte gerne die Geschichte eines englischen Verwaltungsbeamten, der behauptete, das Urdu perfekt zu beherrschen, und sich einem Dichter näherte, um mit seiner Leistung zu prahlen. 'Dann wissen Sie doch sicher, was ein Divot ist?', fragte der Dichter. Der Engländer war verwirrt. Der Dichter wollte ihm klar machen, dass dieses alltägliche englische Wort genauso viel Recht hatte, Teil des Urdu-Wortschatzes zu sein wie großartige Wörter aus dem Persischen und Arabischen. Ich erinnere mich, dass ich einmal den Urdu-Texter Javed Akhtar fragte, ob ich für 'Tod' das Hindi-Wort dehant oder das Urdu-Wort inteqal verwenden sollte. Javed sah mich entsetzt an. 'Du darfst nur das englische Wort death verwenden', sagte er, 'unki death ho gayi - ihr Tod ist eingetreten.' Urdu war die Antwort auf das Rätsel der dreiteiligen Geschichte Indiens - britisch, muslimisch, hinduistisch. Seine Lebendigkeit bezog es aus seiner Fähigkeit, sich an den natürlichen Sprachgebrauch jeder neuen Zeit anzupassen."
Hier das Inhaltsverzeichnis dieser Ausgabe: Noch sind viele Artikel freigeschaltet, das wird sich vermutlich bald ändern.
Eurozine (Österreich), 10.11.2025
 In einem ausführlichen und sehr lesenswerten Interview unterhält sich Misha Glenny, Rektor des Imperial War Museum, mit dem Historiker Gary Gerstle über die USA, ihre Geschichte und natürlich über Donald Trump. Gerstle argumentiert, dass für dessen Siegeszug der wirtschaftliche Niedergang der Arbeiterklasse mitverantwortlich ist: "Diese verlor nicht nur ihre rassistische Vorherrschaft, sondern auch ihre Arbeitsplätze. Trump versteht, dass der Wohlstand der Arbeiterklasse in den 1950er und 1960er Jahren auf der Industrie und den damit verbundenen Einkommen beruhte." Diese erodierten - bedingt durch den Neoliberalismus, so Gerstle, peu a peu, und in den ersten beiden Jahrzehnten des 21. Jahrhunderts dann "erlebten junge und mittelalte weiße Männer in Amerika eine demografische Umkehrung, die bis dahin nirgendwo sonst in der nordatlantischen Welt stattgefunden hatte, außer in Kriegszeiten: Ihre Sterblichkeitsrate stieg sprunghaft an. ... Warum? Alkoholismus, Drogen, Selbstmord. Was einige Ökonomen als 'Todesfälle aus Verzweiflung' bezeichnet haben. Die Familien und Freunde dieser verstorbenen Männer gehörten zu den leidenschaftlichsten Anhängern von Trump." In einer Rede, die Trump 2016 vor Stahlarbeitern im Westen Pennsylvanias hielt, stellt Gerstle Erstaunliches fest: "Wenn man nicht wüsste, wer die Rede hält, könnte man nicht sagen, ob es Donald Trump oder Bernie Sanders ist. Trump und Sanders waren sich in dieser Hinsicht sehr ähnlich: Sie gaben einem Teil Amerikas eine Stimme, der seine Chancen verloren hatte und sich dessen bewusst war. Viele von Trumps Anhängern hatten zudem das Gefühl, dass ihre Chancen durch die Kampagnen für die Verbesserung der Lebensbedingungen von Minderheiten, die Obama ins Weiße Haus gebracht hatten, geschmälert worden waren. All das geschieht gleichzeitig. Und genau das macht Trumps Wahlkampf - der meiner Meinung nach in seinem Wirtschaftsprogramm durchaus berechtigte Elemente enthält - so vergiftet und schädlich. Das Gefühl, dass Weiße das Nachsehen haben, weil People of Color profitieren."
In einem ausführlichen und sehr lesenswerten Interview unterhält sich Misha Glenny, Rektor des Imperial War Museum, mit dem Historiker Gary Gerstle über die USA, ihre Geschichte und natürlich über Donald Trump. Gerstle argumentiert, dass für dessen Siegeszug der wirtschaftliche Niedergang der Arbeiterklasse mitverantwortlich ist: "Diese verlor nicht nur ihre rassistische Vorherrschaft, sondern auch ihre Arbeitsplätze. Trump versteht, dass der Wohlstand der Arbeiterklasse in den 1950er und 1960er Jahren auf der Industrie und den damit verbundenen Einkommen beruhte." Diese erodierten - bedingt durch den Neoliberalismus, so Gerstle, peu a peu, und in den ersten beiden Jahrzehnten des 21. Jahrhunderts dann "erlebten junge und mittelalte weiße Männer in Amerika eine demografische Umkehrung, die bis dahin nirgendwo sonst in der nordatlantischen Welt stattgefunden hatte, außer in Kriegszeiten: Ihre Sterblichkeitsrate stieg sprunghaft an. ... Warum? Alkoholismus, Drogen, Selbstmord. Was einige Ökonomen als 'Todesfälle aus Verzweiflung' bezeichnet haben. Die Familien und Freunde dieser verstorbenen Männer gehörten zu den leidenschaftlichsten Anhängern von Trump." In einer Rede, die Trump 2016 vor Stahlarbeitern im Westen Pennsylvanias hielt, stellt Gerstle Erstaunliches fest: "Wenn man nicht wüsste, wer die Rede hält, könnte man nicht sagen, ob es Donald Trump oder Bernie Sanders ist. Trump und Sanders waren sich in dieser Hinsicht sehr ähnlich: Sie gaben einem Teil Amerikas eine Stimme, der seine Chancen verloren hatte und sich dessen bewusst war. Viele von Trumps Anhängern hatten zudem das Gefühl, dass ihre Chancen durch die Kampagnen für die Verbesserung der Lebensbedingungen von Minderheiten, die Obama ins Weiße Haus gebracht hatten, geschmälert worden waren. All das geschieht gleichzeitig. Und genau das macht Trumps Wahlkampf - der meiner Meinung nach in seinem Wirtschaftsprogramm durchaus berechtigte Elemente enthält - so vergiftet und schädlich. Das Gefühl, dass Weiße das Nachsehen haben, weil People of Color profitieren."New Yorker (USA), 11.11.2025
 Jill Lepore macht sich im New Yorker Gedanken über das anstehende Jubiläum der amerikanischen Unabhängigkeit - und über die Serie "The American Revolution" von Ken Burns: "Die Geschichte, die 'The American Revolution' erzählt, handelt davon, wie einige der wichtigsten Ideen der modernen Welt aufkommen, erkämpft in einer blutigen und mutigen Rebellion gegen Tyrannei, die gleichzeitig ein Bürgerkrieg und globaler Krieg war und die mit ihren Ideen von Freiheit, Sklaverei, Eroberung und Unabhängigkeit die Schicksale britischer Soldaten, amerikanischer Milizmänner, Diplomaten der Lenape, Kämpfer der Seneca, deutscher Söldner, französischer Seemänner, Männer der Akan, Frauen der Igbo, Pioniere im Hinterland, Stadtfrauen, Freien, Unfreien, Reichen und Armen miteinander verbunden hat. Es ist eine Leinwand, teils Bruegel, teils Goya, ein politisches Karussell, eine wimmelnde, bewegende, erschreckende Geschichte (…). Das Verdienst der Serie liegt darin, die Würde und die Bedeutung der revolutionären Ideale der Gründer ebenso zu honorieren wie die Opfer aller, die dafür gekämpft haben und zudem auch einen schonungslosen Blick auf die Grausamkeiten und Kosten des Krieges zu werfen, insbesondere für Frauen, schwarze Amerikaner und Ureinwohner, denen die Freiheit, Gleichheit und Herrschaft versagt wurde, die die Revolution versprochen hatte. Die Revolution, die versagt hat, ist die Revolution, von der Trump-Regierung nicht will, dass die Amerikaner sie kennen und bedauern. Die Revolution, die geglückt ist, ist die, die manche amerikanischen Institutionen fest entschlossen sind zu ignorieren."
Jill Lepore macht sich im New Yorker Gedanken über das anstehende Jubiläum der amerikanischen Unabhängigkeit - und über die Serie "The American Revolution" von Ken Burns: "Die Geschichte, die 'The American Revolution' erzählt, handelt davon, wie einige der wichtigsten Ideen der modernen Welt aufkommen, erkämpft in einer blutigen und mutigen Rebellion gegen Tyrannei, die gleichzeitig ein Bürgerkrieg und globaler Krieg war und die mit ihren Ideen von Freiheit, Sklaverei, Eroberung und Unabhängigkeit die Schicksale britischer Soldaten, amerikanischer Milizmänner, Diplomaten der Lenape, Kämpfer der Seneca, deutscher Söldner, französischer Seemänner, Männer der Akan, Frauen der Igbo, Pioniere im Hinterland, Stadtfrauen, Freien, Unfreien, Reichen und Armen miteinander verbunden hat. Es ist eine Leinwand, teils Bruegel, teils Goya, ein politisches Karussell, eine wimmelnde, bewegende, erschreckende Geschichte (…). Das Verdienst der Serie liegt darin, die Würde und die Bedeutung der revolutionären Ideale der Gründer ebenso zu honorieren wie die Opfer aller, die dafür gekämpft haben und zudem auch einen schonungslosen Blick auf die Grausamkeiten und Kosten des Krieges zu werfen, insbesondere für Frauen, schwarze Amerikaner und Ureinwohner, denen die Freiheit, Gleichheit und Herrschaft versagt wurde, die die Revolution versprochen hatte. Die Revolution, die versagt hat, ist die Revolution, von der Trump-Regierung nicht will, dass die Amerikaner sie kennen und bedauern. Die Revolution, die geglückt ist, ist die, die manche amerikanischen Institutionen fest entschlossen sind zu ignorieren."HVG (Ungarn), 06.11.2025
 Letzte Woche ist der Ästhet, Kunsthistoriker ud Medienwissenschaftler Péter György im Alter von 71 Jahren gestorben. György war Begründer und zeitweise Leiter des Lehrstuhls für Medienwissenschaften an der Budapester ELTE Universität, Gründer des Nachrichtenportals Origo, das nach 2010 von regierungsnahen Unternehmen einverleibt und neu ausgerichtet wurde, der Verfasser von etwa 30 Büchern zur historischen Aufarbeitung und Kunstkritiker. Die Publizistin Boróka Parászka erinnert an einen der letzten öffentlichen Intellektuellen: "War das gesamte Lebenswerk von Péter György umsonst? Waren Freiheitsdrang, Selbstreflexion und Aufarbeitung der Wende von 1989 - und darin auch die Arbeit von Péter György - ein gescheitertes öffentliches Schauspiel? Wir sind von den Lügen Kádárs über 1956 zu den Lügen Orbáns über 1956 in eine ähnlich öde historische Landschaft gelangt. Von nirgendwo nach nirgendwohin? Im Gegenteil! Die im institutionellen und starren Sinne nicht existierende Schule von Péter György ist sehr real, und seine Schüler, die sein Erbe weiterführen, haben zwei Dinge von ihm gelernt: Jeder kann seiner Rechte beraubt werden, jede Spur kann ausgelöscht und überschrieben werden. Aber der Geist des (Tat)Ortes lässt sich nicht zum Schweigen bringen. Deshalb muss man präsent sein. Man muss die Topografie der Konzentrationslager kennen, die imaginären und realen Orte Transsilvaniens, das Reich des Popkönigs von Csepel und die Parzelle 301. All das zusammen ist unsere Heimat. Und wenn es Anwesenheit und genügend Aufmerksamkeit gib, spricht der Geist des Ortes. Er enthüllt, er versöhnt. In unserer permanenten Heimatlosigkeit finden wir so nach Hause."
Letzte Woche ist der Ästhet, Kunsthistoriker ud Medienwissenschaftler Péter György im Alter von 71 Jahren gestorben. György war Begründer und zeitweise Leiter des Lehrstuhls für Medienwissenschaften an der Budapester ELTE Universität, Gründer des Nachrichtenportals Origo, das nach 2010 von regierungsnahen Unternehmen einverleibt und neu ausgerichtet wurde, der Verfasser von etwa 30 Büchern zur historischen Aufarbeitung und Kunstkritiker. Die Publizistin Boróka Parászka erinnert an einen der letzten öffentlichen Intellektuellen: "War das gesamte Lebenswerk von Péter György umsonst? Waren Freiheitsdrang, Selbstreflexion und Aufarbeitung der Wende von 1989 - und darin auch die Arbeit von Péter György - ein gescheitertes öffentliches Schauspiel? Wir sind von den Lügen Kádárs über 1956 zu den Lügen Orbáns über 1956 in eine ähnlich öde historische Landschaft gelangt. Von nirgendwo nach nirgendwohin? Im Gegenteil! Die im institutionellen und starren Sinne nicht existierende Schule von Péter György ist sehr real, und seine Schüler, die sein Erbe weiterführen, haben zwei Dinge von ihm gelernt: Jeder kann seiner Rechte beraubt werden, jede Spur kann ausgelöscht und überschrieben werden. Aber der Geist des (Tat)Ortes lässt sich nicht zum Schweigen bringen. Deshalb muss man präsent sein. Man muss die Topografie der Konzentrationslager kennen, die imaginären und realen Orte Transsilvaniens, das Reich des Popkönigs von Csepel und die Parzelle 301. All das zusammen ist unsere Heimat. Und wenn es Anwesenheit und genügend Aufmerksamkeit gib, spricht der Geist des Ortes. Er enthüllt, er versöhnt. In unserer permanenten Heimatlosigkeit finden wir so nach Hause."Guardian (UK), 11.11.2025
Le Grand Continent (Frankreich), 09.11.2025
London Review of Books (UK), 06.11.2025
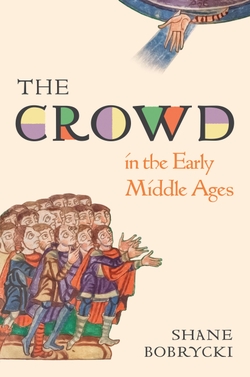
New Lines Magazine (USA), 10.11.2025

Von 1931 bis 1938 führte ein Forscherteam unter der Leitung der American Schools of Oriental Research archäologische Ausgrabungen in Tepe Gawra und Tell Billa im Norden des Irak durch, erzählt William Gourlay. Dabei machten die Forscher über dreihundert Fotografien der ortsansässigen jesidischen Bevölkerung. Nach Abschluss der Arbeiten verschwanden die Fotos im Archiv der Pennsylvania Universität und wurden vergessen, bis Marc Marin Webb im Jahr 2022 zufällig im Rahmen seiner Forschungen zum Genozid an den Jesiden durch den IS im Jahr 2014 auf die Fotografien stieß. Unter der Mitarbeit von Jesiden und anderen Menschen aus dem Nordirak entstand so das "Sersal-Projekt": Webb ließ die Bilder an den Orten ihrer Entstehung zeigen, was für große Freude und Aufmerksamkeit bei den Ansässigen sorgte, unter anderem, weil viele verstorbene Verwandten auf den Fotografien entdeckten: "Die Jesiden sind sich einig, dass sie im Laufe ihrer Geschichte 74 'Fermans' (Völkermorden) zum Opfer gefallen sind. Daher betrachten sie Verfolgung - und das Ertragen dieser - als einen zentralen Bestandteil ihrer Identität. Die gewaltsamen Angriffe des Islamischen Staates im Jahr 2014 waren der letzte dieser Völkermorde. Im Gegensatz dazu zeigen die Fotografien der University of Pennsylvania eine Zeit relativer Ruhe. Ab 1921 unter britischer Mandatsverwaltung, erlangte der Irak 1932 seine Unabhängigkeit. Faisal al-Haschimi, der neu ernannte erste König des Irak, garantierte den Schutz ethnischer und religiöser Minderheiten (...) Eines seiner Ziele war die Schaffung einer nationalen Identität, die die Vielfalt der religiösen und ethnischen Gemeinschaften im Irak integrieren konnte. Die Hochzeitszüge, gemeinschaftlichen Tänze und Momentaufnahmen des Dorflebens im Fotoarchiv zeigen Jesiden in diesem politischen Umfeld, einer Zeit des Optimismus. Das Sersal-Projekt unter der Leitung von Marin Webb und Brunt ist somit ein wertvolles Zeugnis dieser Ära. Es hat aber auch weiterreichende Bedeutung für die Jesiden selbst und die irakische Bevölkerung insgesamt. Es zeigt die Jesiden nicht nur als Opfer von Verfolgung und Gewalt, sondern gibt ihnen ein Gesicht."
New York Times (USA), 09.11.2025
 Dies ist eine amerikanische Reportage, wie sie früher waren, nüchtern, ohne Kitsch wie er im deutschen Seite-3-Stil üblich ist, düster, aber packend. Christopher John Chivers erzählt von der Rettung des ukrainischen Soldaten Aleksandr, dem von einer Drohne die Wade und die Hand zerschossen wurden, und von der endlosen Nacht, die er zubringen musste, bevor ihm eine ukrainische Drohne den Weg zur Rettung wies. Er hatte Glück. Viele werden nach Stunden des Wartens von Drohnen aufgespürt und zerfetzt. Das Gebiet zwischen den Fronten und vor der Front ist ständiger Überwachung durch die Drohnen ausgesetzt, eine völlig neue Qualität, so Chivers. Bis zum Afghanistan-Krieg gab es auf Schlachtfeldern die Faustregel der "Golden Hour". Innerhalb dieser Zeit sollte für verletzte Soldaten Rettung kommen, die Überlebenschancen waren so relativ gut. "Der zunehmende Einsatz von Drohnen über der Ukraine hat solche Ideale völlig auf den Kopf gestellt. Die Wartezeit eines verwundeten Soldaten, bis er einen Arzt erreicht, dauert nun oft so lange wie zu den schlimmsten Zeiten des Ersten Weltkriegs. 'Aufgrund der hohen Drohnenaktivität kann es manchmal ein, zwei oder drei Tage dauern, bis ein Soldat evakuiert werden kann', sagt Oberleutnant Daria, Anästhesistin in einer versteckten Notaufnahme oder Stabilisierungsstation in der Nähe von Charkiw… Laut Lt. Daria halten sich russische Drohnenteams nicht an die gesetzlichen Schutzbestimmungen für medizinisches Personal. 'In unserem Militärfachbereich an der Universität haben wir gelernt, dass laut den Genfer Konventionen Sanitäter auf dem Schlachtfeld nicht angegriffen werden dürfen', sagt sie. 'In diesem Krieg funktioniert das nicht. Evakuierungsteams sind für Russland wichtige Ziele.'"
Dies ist eine amerikanische Reportage, wie sie früher waren, nüchtern, ohne Kitsch wie er im deutschen Seite-3-Stil üblich ist, düster, aber packend. Christopher John Chivers erzählt von der Rettung des ukrainischen Soldaten Aleksandr, dem von einer Drohne die Wade und die Hand zerschossen wurden, und von der endlosen Nacht, die er zubringen musste, bevor ihm eine ukrainische Drohne den Weg zur Rettung wies. Er hatte Glück. Viele werden nach Stunden des Wartens von Drohnen aufgespürt und zerfetzt. Das Gebiet zwischen den Fronten und vor der Front ist ständiger Überwachung durch die Drohnen ausgesetzt, eine völlig neue Qualität, so Chivers. Bis zum Afghanistan-Krieg gab es auf Schlachtfeldern die Faustregel der "Golden Hour". Innerhalb dieser Zeit sollte für verletzte Soldaten Rettung kommen, die Überlebenschancen waren so relativ gut. "Der zunehmende Einsatz von Drohnen über der Ukraine hat solche Ideale völlig auf den Kopf gestellt. Die Wartezeit eines verwundeten Soldaten, bis er einen Arzt erreicht, dauert nun oft so lange wie zu den schlimmsten Zeiten des Ersten Weltkriegs. 'Aufgrund der hohen Drohnenaktivität kann es manchmal ein, zwei oder drei Tage dauern, bis ein Soldat evakuiert werden kann', sagt Oberleutnant Daria, Anästhesistin in einer versteckten Notaufnahme oder Stabilisierungsstation in der Nähe von Charkiw… Laut Lt. Daria halten sich russische Drohnenteams nicht an die gesetzlichen Schutzbestimmungen für medizinisches Personal. 'In unserem Militärfachbereich an der Universität haben wir gelernt, dass laut den Genfer Konventionen Sanitäter auf dem Schlachtfeld nicht angegriffen werden dürfen', sagt sie. 'In diesem Krieg funktioniert das nicht. Evakuierungsteams sind für Russland wichtige Ziele.'"
Kommentieren