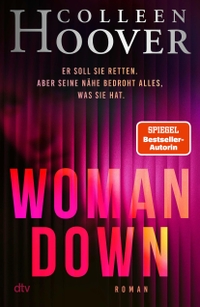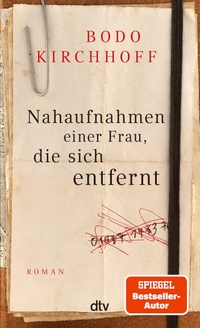Magazinrundschau
Auf den Knien kann man nicht leben
Ein Blick in internationale Magazine. Jeden Dienstag Mittag
20.01.2026. Im New Yorker schildert der Dichter Armando Ledezma das Fegefeuer der Venezolaner. Aktualne erinnert an den tschechischen Fotografen und Guru František Drtikol. HVG und Elet Irodalom trauern um Bela Tarr. Die London Review rekapituliert den Werdegang Xi Jinpings, kennt aber wenigstens einen lebenden Staatsmann, dem sie noch weniger vertraut. In New Lines fragt sich der srilankische Journalist und Politik-Professor Shyam Tekwani, wie man über einen Bürgerkrieg schreiben kann. Der Dlf fragt sich, wie ein neuer Literaturkanon aussehen könnte.
New Yorker (USA), 19.01.2026
 Der britisch-venezolanische Essayist und Dichter Armando Ledezma erzählt in einem Brief aus Caracas, wie zerrissen und ängstlich das eh schon krisengebeutelte Venezuela ist, nachdem Trump den Diktator Maduro entführen ließ: "Wir in Venezuela wissen sehr wohl Bescheid, was die Misshandlung lateinamerikanischer Immigranten in den USA unter der Trump-Regierung angeht, die 252 venezolanischen Männer eingeschlossen, die ins CECOT geschickt wurden, das Hochsicherheitsgefängnis in El Salvador, wo ihre Köpfe bei der Ankunft rasiert und einige von ihnen schwer geschlagen wurden. ... Trumps Rhetorik hat sich auffällig verschoben von der Prävention des Drogenschmuggels hin zu Kontroll- und Ressourcengewinn und unterstreicht damit, dass es bei seiner Operation nie um Demokratie oder das Recht der Venezolaner auf Selbstbestimmung ging. Nachdem Trump kürzlich in einem Times-Interview bekanntgegeben hat, dass die USA Venezuela regieren werden, offenbar für Jahre, und auf Truth Social ein fotomontiertes Bild einer Wikipedia-Seite gepostet hat, das ihn als 'regierenden Präsidenten Venezuelas' ausweist, fürchten manche von uns, dass ein nicht gewählter Despot durch einen anderen ausgetauscht wurde und dass es uns möglicherweise so gehen wird wie Hawaii und Puerto Rico." Und so wissen viele Venezolaner nicht mehr, was sie denken sollen. "Gleichzeitig wütend auf Maduros diktatorisches Regime und ohne Vertrauen in die USA, haben sie das Gefühl, eine Seite wählen zu müssen, obwohl es keine guten Optionen gibt. Die Extremisten auf beiden Seiten - hier die glühenden Unterstützer der bolivianischen Linken um Evo Morales und dort die entrechtete herrschende Klasse, die die Revolution seit ihren demokratischen Anfängen gehasst hat, lange bevor sie in eine Diktatur abgeglitten ist - sind unverhältnismäßig laut und zeichnen ein Bild des Landes und seiner Leute, das viel ideologischer ist als die Realität. Auch die Angehörigen der Diaspora, mit vor den staatlichen Repressionen sicher sind, verbreiten ein verzerrtes Bild."
Der britisch-venezolanische Essayist und Dichter Armando Ledezma erzählt in einem Brief aus Caracas, wie zerrissen und ängstlich das eh schon krisengebeutelte Venezuela ist, nachdem Trump den Diktator Maduro entführen ließ: "Wir in Venezuela wissen sehr wohl Bescheid, was die Misshandlung lateinamerikanischer Immigranten in den USA unter der Trump-Regierung angeht, die 252 venezolanischen Männer eingeschlossen, die ins CECOT geschickt wurden, das Hochsicherheitsgefängnis in El Salvador, wo ihre Köpfe bei der Ankunft rasiert und einige von ihnen schwer geschlagen wurden. ... Trumps Rhetorik hat sich auffällig verschoben von der Prävention des Drogenschmuggels hin zu Kontroll- und Ressourcengewinn und unterstreicht damit, dass es bei seiner Operation nie um Demokratie oder das Recht der Venezolaner auf Selbstbestimmung ging. Nachdem Trump kürzlich in einem Times-Interview bekanntgegeben hat, dass die USA Venezuela regieren werden, offenbar für Jahre, und auf Truth Social ein fotomontiertes Bild einer Wikipedia-Seite gepostet hat, das ihn als 'regierenden Präsidenten Venezuelas' ausweist, fürchten manche von uns, dass ein nicht gewählter Despot durch einen anderen ausgetauscht wurde und dass es uns möglicherweise so gehen wird wie Hawaii und Puerto Rico." Und so wissen viele Venezolaner nicht mehr, was sie denken sollen. "Gleichzeitig wütend auf Maduros diktatorisches Regime und ohne Vertrauen in die USA, haben sie das Gefühl, eine Seite wählen zu müssen, obwohl es keine guten Optionen gibt. Die Extremisten auf beiden Seiten - hier die glühenden Unterstützer der bolivianischen Linken um Evo Morales und dort die entrechtete herrschende Klasse, die die Revolution seit ihren demokratischen Anfängen gehasst hat, lange bevor sie in eine Diktatur abgeglitten ist - sind unverhältnismäßig laut und zeichnen ein Bild des Landes und seiner Leute, das viel ideologischer ist als die Realität. Auch die Angehörigen der Diaspora, mit vor den staatlichen Repressionen sicher sind, verbreiten ein verzerrtes Bild."Ian Frazier erzählt, wie in den 1980ern Bürgerdiplomatie in Alaska dazu führte, den eisigen Vorhang zwischen Russland und den USA zu lüpfen. Einfach war es nicht, zumal die kulturellen Unterschiede riesig waren, aber es gab doch regelmäßige Begegnungen. Vor allem durften die Ureinwohner sich ohne Visum gegenseitig besuchen. In den 90ern kühlten die Beziehungen ab und nach dem russischen Überfall auf die Krim war fast ganz Schluss. Frazier fragt unter anderen Mead Treadwell, der seit siebenundvierzig Jahren in Alaska lebt und in vielen Arktis-Kommissionen saß, "was heute zu tun sei. Er weiß keine Antwort. 'Ich sage immer, dass die Bürgerdiplomatie in den achtziger Jahren die Grenze geöffnet hat', so Treadwell. 'Und das Versagen der Großmachtdiplomatie trug zu ihrer Schließung bei, die mit Putin im Jahr 2000 begann. ... 'Aber es gibt immer Veränderungen', fuhr er fort. 'Eine Delegation von Geschäftsleuten begleitete Putin kürzlich zu seinem Gipfeltreffen mit Trump in Alaska. Ich weiß nicht, welche Themen besprochen wurden. Aber auf internationaler Ebene kann viel getan werden in den Bereichen Bergbau, Schifffahrt, Fischerei, Energiegewinnung und Tourismus in unserer gemeinsamen Arktis. Nur weil unsere russische Grenze weitgehend geschlossen zu sein scheint, sollte man nicht denken, dass die Menschen nicht über eine andere Zukunft nachdenken und planen.'" Man hätte gern noch erfahren, welche Rolle Grönland in diesem Rahmen spielt, aber dazu sagt Frazier nichts.
Aktualne (Tschechien), 20.01.2026

HVG (Ungarn), 15.01.2026
 In HVG nimmt der junge Regisseur Jákob Ladányi Jancsó Abschied von Béla Tarr, stellvertretend für dessen Schüler: "Als ich Castings machte und ihm die Aufnahmen brachte, sagte er immer nur: 'gut', 'nicht gut', und man konnte ihm nie eine Begründung entlocken, denn er urteilte nach seinem Bauchgefühl. Und am Ende hatte er immer Recht. Er sah den Menschen sehr präzise und mit tiefer Empathie, das war sein Geheimnis. Auch uns, seine Schüler. Zu jedem hatte er eine gänzlich andere Beziehung, denn er hatte keine festen Methoden. Für ihn waren diese Beziehungen zwischenmenschlicher Natur, die jeweils ihre eigenen Dynamiken hatten. Das bedeutete natürlich nicht, dass er ein netter, in allem unterstützender Lehreronkel war. Er konnte sehr streng, ja sogar grausam sein. Ein Problem oder ein Gedanke hielt ihn oft die ganze Nacht wach, und dann rief er an. (...) Oft weckte er mich mitten in der Nacht mit einer Idee oder einem Gedanken. Einmal, weil ihm etwas nicht gefiel. Im Halbschlaf antwortete ich ihm: 'Fick dich, Béla, wenn du mich schon mitten in der Nacht weckst, könntest du dann wenigstens ein bisschen netter sein?' Darauf antwortete er, dass es in diesem Moment ein Problem wäre, wenn er nett wäre, denn das würde bedeuten, dass er nicht mehr an mich glaube. Zu meinem Glück war er nie nett. Aber seine Unterstützung, seine Aufmerksamkeit und seine Lehren werden mein Leben bis zum Ende prägen. (…) Er hat mir gezeigt, mit welcher Haltung man leben und Filme machen muss und nicht das 'wie'. Zum 'wie' sagte er immer nur, wir sollten Neues schaffen und unsere eigene Sprache finden. Er hat uns immer dazu ermutigt, aus der Reihe zu tanzen und mutig zu sein. Oft hat er uns wütend zugerufen: 'Ihr seid die Jungen, schnappt euch ein verdammtes Handy und erfindet die Filmsprache neu!' Und er war wirklich punkiger und rebellischer als alle anderen. Er hasste die Filmindustrie, hat sich ihr nie unterworfen, genauso wenig wie irgendeinem System, der Zensur oder der Politik. 'Auf den Knien kann man nicht leben und niemals einen echten Film machen.'"
In HVG nimmt der junge Regisseur Jákob Ladányi Jancsó Abschied von Béla Tarr, stellvertretend für dessen Schüler: "Als ich Castings machte und ihm die Aufnahmen brachte, sagte er immer nur: 'gut', 'nicht gut', und man konnte ihm nie eine Begründung entlocken, denn er urteilte nach seinem Bauchgefühl. Und am Ende hatte er immer Recht. Er sah den Menschen sehr präzise und mit tiefer Empathie, das war sein Geheimnis. Auch uns, seine Schüler. Zu jedem hatte er eine gänzlich andere Beziehung, denn er hatte keine festen Methoden. Für ihn waren diese Beziehungen zwischenmenschlicher Natur, die jeweils ihre eigenen Dynamiken hatten. Das bedeutete natürlich nicht, dass er ein netter, in allem unterstützender Lehreronkel war. Er konnte sehr streng, ja sogar grausam sein. Ein Problem oder ein Gedanke hielt ihn oft die ganze Nacht wach, und dann rief er an. (...) Oft weckte er mich mitten in der Nacht mit einer Idee oder einem Gedanken. Einmal, weil ihm etwas nicht gefiel. Im Halbschlaf antwortete ich ihm: 'Fick dich, Béla, wenn du mich schon mitten in der Nacht weckst, könntest du dann wenigstens ein bisschen netter sein?' Darauf antwortete er, dass es in diesem Moment ein Problem wäre, wenn er nett wäre, denn das würde bedeuten, dass er nicht mehr an mich glaube. Zu meinem Glück war er nie nett. Aber seine Unterstützung, seine Aufmerksamkeit und seine Lehren werden mein Leben bis zum Ende prägen. (…) Er hat mir gezeigt, mit welcher Haltung man leben und Filme machen muss und nicht das 'wie'. Zum 'wie' sagte er immer nur, wir sollten Neues schaffen und unsere eigene Sprache finden. Er hat uns immer dazu ermutigt, aus der Reihe zu tanzen und mutig zu sein. Oft hat er uns wütend zugerufen: 'Ihr seid die Jungen, schnappt euch ein verdammtes Handy und erfindet die Filmsprache neu!' Und er war wirklich punkiger und rebellischer als alle anderen. Er hasste die Filmindustrie, hat sich ihr nie unterworfen, genauso wenig wie irgendeinem System, der Zensur oder der Politik. 'Auf den Knien kann man nicht leben und niemals einen echten Film machen.'"London Review of Books (UK), 20.01.2026
 Tom Stevenson liest drei Bücher, die sich mit Xi Jinping befassen bzw. dessen Vater Xi Zhongxun. Insgesamt, findet er, kommt Xi zu schlecht weg: Er sei weder ein neuer König, noch einfach ein Nationalist, der den Westen hasse, wie der ehemalige australische Premierminister Kevin Rudd in seinem Buch behaupte. Xis Brutalität nimmt Stevenson zur Kenntnis, doch benimmt sich eine andere Großmacht nicht gerade viel schlechter? "In seinen Reden spricht Xi von einer 'unabhängigen Friedenspolitik' und einem Bekenntnis zur UN-Charta. Chinas Global Governance Initiative soll 'Demokratie in den internationalen Beziehungen', Multilateralismus und Rechtsstaatlichkeit fördern. Für Rudd laufen diese Verpflichtungen jedoch lediglich darauf hinaus, 'die internationale moralische Überlegenheit' anzustreben. Dahinter verbirgt sich ein ehrgeiziges 'Megaprojekt zur Neugestaltung des gesamten internationalen Systems'. Er spekuliert ohne konkrete Beweise, dass China versuchen könnte, die UN-Charta durch eine 'neue, auf China ausgerichtete Struktur' zu ersetzen. Diese Ansicht wird in gewisser Weise durch Chinas territoriale Ansprüche auf Inseln im Südchinesischen Meer, seine Übergriffe auf den taiwanesischen Luftraum und seine Grenzkonflikte mit Indien gestützt. Als Xi im September zusammen mit Putin und Kim Jong-un auf der Balustrade des Tiananmen-Tors posierte, um den achtzigsten Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs zu feiern, reagierten die China-Falken in den USA heftig. Aber China ist dem Status quo der internationalen Institutionen stärker verpflichtet als Amerika. Man würde vergeblich nach Berichten suchen, dass China tagelang Somalia bombardiert, Luftangriffe auf unbekannte Boote in der Karibik fliegt oder den Präsidenten eines anderen Landes entführt und nach Peking verschleppt."
Tom Stevenson liest drei Bücher, die sich mit Xi Jinping befassen bzw. dessen Vater Xi Zhongxun. Insgesamt, findet er, kommt Xi zu schlecht weg: Er sei weder ein neuer König, noch einfach ein Nationalist, der den Westen hasse, wie der ehemalige australische Premierminister Kevin Rudd in seinem Buch behaupte. Xis Brutalität nimmt Stevenson zur Kenntnis, doch benimmt sich eine andere Großmacht nicht gerade viel schlechter? "In seinen Reden spricht Xi von einer 'unabhängigen Friedenspolitik' und einem Bekenntnis zur UN-Charta. Chinas Global Governance Initiative soll 'Demokratie in den internationalen Beziehungen', Multilateralismus und Rechtsstaatlichkeit fördern. Für Rudd laufen diese Verpflichtungen jedoch lediglich darauf hinaus, 'die internationale moralische Überlegenheit' anzustreben. Dahinter verbirgt sich ein ehrgeiziges 'Megaprojekt zur Neugestaltung des gesamten internationalen Systems'. Er spekuliert ohne konkrete Beweise, dass China versuchen könnte, die UN-Charta durch eine 'neue, auf China ausgerichtete Struktur' zu ersetzen. Diese Ansicht wird in gewisser Weise durch Chinas territoriale Ansprüche auf Inseln im Südchinesischen Meer, seine Übergriffe auf den taiwanesischen Luftraum und seine Grenzkonflikte mit Indien gestützt. Als Xi im September zusammen mit Putin und Kim Jong-un auf der Balustrade des Tiananmen-Tors posierte, um den achtzigsten Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs zu feiern, reagierten die China-Falken in den USA heftig. Aber China ist dem Status quo der internationalen Institutionen stärker verpflichtet als Amerika. Man würde vergeblich nach Berichten suchen, dass China tagelang Somalia bombardiert, Luftangriffe auf unbekannte Boote in der Karibik fliegt oder den Präsidenten eines anderen Landes entführt und nach Peking verschleppt."Thomas Meaney rekapituliert im Rahmen einer Besprechung eines Buches von Sam Tanenhaus die Karriere William F. Buckleys. Der war einerseits ein passionierter Polemiker der amerikanischen Konservativen, dessen Zeitschrift National Review gegen die Bürgerrechtsbewegung Stellung bezog und jede Menge antikommunistischer Feldzüge führte; und andererseits ein New Yorker Dandy, der den von ihm verachteten Liberalen in vieler Hinsicht näher war, als er selbst zuzugeben bereit war. Sein Einfluss auf die jüngere Geschichte der amerikanischen Rechten ist nicht zu unterschätzen, meint Meaney: "Als Trump erstmals an die Macht kam, war es unter der republikanischen alten Garde - darunter Buckleys Sohn Christopher - üblich, Buckleys Eleganz und Mäßigung mit Trumps Vulgarität und Extremismus zu kontrastieren. Als Beweisstück wurde stets ein Essay Buckleys aus dem Jahr 2000 genannt, in dem er feststellte, dass die Nation anfällig für demagogische Kräfte sei - wenngleich er glaubte, dass Trump zumindest niemals ein hohes Amt bekleiden würde. Aber ist es nicht so, dass kaum jemand mehr Vorarbeit für MAGA geleistet hat als Buckley?"
Mit einem anderen äußerst amerikanischen Lebenslauf beschäftigt sich Chal Ravens: Britney Spears war nach ihrem Durchbruch 1999 ein paar Jahre lang der größte Popstar der Welt, bevor sie mit einem öffentlichen Zusammenbruch ins Bodenlose stürzte. Sie wurde geschieden, verlor das Sorgerecht für ihre Kinder und schließlich, mit 26 Jahren, entmündigt und in der Folge ein Jahrzehnt lang von ihrem Vater und dessen Armee von Anwälten kontrolliert wurde; heute ist sie wieder #freeBritney. Ravens überlegt sich, nach Lektüre einer Spears-Biografie von Jeff Weiss und Spears' Autobiografie "The Woman in Me", ohne viel Sympathie für den Popstar, was das alles zu bedeuten hat: "Als Kind sexualisiert und als Erwachsene infantilisiert, versuchte Britney mit ihrem Status als Sexsymbol klar zu kommen, indem sie in Interviews so tat, als sei sie keines. ... Ironischerweise war Weiblichkeit immer ein Kostüm, das Britney nur unbeholfen trug. Sie war Basketballspielerin, keine Cheerleaderin; ein selbsternannter Wildfang; albern statt anmutig. Ihr Sexappeal war von Janet Jackson und Madonna entliehen, doch sie schrieb ihre Hausaufgaben ab, ohne die Aufgaben zu lösen. Sie wirkte nicht kaltblütig genug für das Showbusiness".
The Nation (USA), 19.01.2026
 Adam Hochschild empfiehlt die Netflix-Doku "Cover up" über eine der beeindruckendsten, aber auch umstrittensten Journalisten-Persönlichkeiten: Seymour Hersh. Hersh war vor allem jemand, der dem journalistischen "Herdentrieb" widerstand, schreibt Hochschild. Seine Enthüllungen über das Massaker von My Lai, die Watergate-Affäre und die Folter von irakischen Gefangenen durch US-Militärs im Gefängnis Abu Ghraib erschütterten die Welt und hatten politisch großen Einfluss. Für die Veröffentlichungen musste sich Hersh immer wieder gegen die Forderungen seiner Vorgesetzten und den politischen Konsens behaupten: "'Als ich für Associated Press im Pentagon war', erzählt er den Regisseuren Mark Obenhaus Laura Poitras während er sich seine frühen Tage als Reporter erinnert, 'ging ich nicht mit meinen Kollegen zum Mittagessen, sondern suchte junge Offiziere auf. Ich unterhielt mich ein wenig über Football, lernte sie kennen ... Irgendwann fingen die Soldaten an zu sagen: 'Nun, dort in Vietnam herrscht ein Mörder-Kommando'. Es dauerte nicht lange, bis Hersh sich von Associated Press trennte (später tat er dasselbe mit der New York Times und stellte seine Veröffentlichungen im New Yorker ein) ... Die Enthüllung gab der Antikriegsbewegung enormen Auftrieb. Sie begründete auch Hershs Karriere als einer der größten investigativen Reporter, die dieses Land je gesehen hat." Die Kritik an Hersh kommt in der Doku vielleicht ein wenig zu kurz, meint Hochschild. Dass er Baschar al-Assads brutale Diktatur in Syrien unterschätzte und entschuldigte "('Ich habe ihn nie für Mutter Teresa gehalten', gibt Hersh den Filmemachern zu, 'aber ich fand ihn in Ordnung')", wird in der Doku zu wenig ins Licht gerückt. Trotzdem, findet Hochschild, die Verdienste dieses Ausnahme-Reporters überwiegen.
Adam Hochschild empfiehlt die Netflix-Doku "Cover up" über eine der beeindruckendsten, aber auch umstrittensten Journalisten-Persönlichkeiten: Seymour Hersh. Hersh war vor allem jemand, der dem journalistischen "Herdentrieb" widerstand, schreibt Hochschild. Seine Enthüllungen über das Massaker von My Lai, die Watergate-Affäre und die Folter von irakischen Gefangenen durch US-Militärs im Gefängnis Abu Ghraib erschütterten die Welt und hatten politisch großen Einfluss. Für die Veröffentlichungen musste sich Hersh immer wieder gegen die Forderungen seiner Vorgesetzten und den politischen Konsens behaupten: "'Als ich für Associated Press im Pentagon war', erzählt er den Regisseuren Mark Obenhaus Laura Poitras während er sich seine frühen Tage als Reporter erinnert, 'ging ich nicht mit meinen Kollegen zum Mittagessen, sondern suchte junge Offiziere auf. Ich unterhielt mich ein wenig über Football, lernte sie kennen ... Irgendwann fingen die Soldaten an zu sagen: 'Nun, dort in Vietnam herrscht ein Mörder-Kommando'. Es dauerte nicht lange, bis Hersh sich von Associated Press trennte (später tat er dasselbe mit der New York Times und stellte seine Veröffentlichungen im New Yorker ein) ... Die Enthüllung gab der Antikriegsbewegung enormen Auftrieb. Sie begründete auch Hershs Karriere als einer der größten investigativen Reporter, die dieses Land je gesehen hat." Die Kritik an Hersh kommt in der Doku vielleicht ein wenig zu kurz, meint Hochschild. Dass er Baschar al-Assads brutale Diktatur in Syrien unterschätzte und entschuldigte "('Ich habe ihn nie für Mutter Teresa gehalten', gibt Hersh den Filmemachern zu, 'aber ich fand ihn in Ordnung')", wird in der Doku zu wenig ins Licht gerückt. Trotzdem, findet Hochschild, die Verdienste dieses Ausnahme-Reporters überwiegen.New Lines Magazine (USA), 19.01.2026

Kleine Anmerkung der Redaktion: Seltsamerweise findet sich im New Lines Magazine, das seinen Schwerpunkt unter anderem auf Nahost legt, nicht ein einziger Artikel zu den grausam niedergeschlagenen Protesten der Iraner und Iranerinnen gegen das islamistische Regime (unsere Resümees hier). Aber auch im New Yorker, The Nation, New Republic, Prospect oder The Atlantic findet sich kaum etwas zu den Vorgängen im Iran.
Dlf - Essay und Diskurs (Deutschland), 18.01.2026
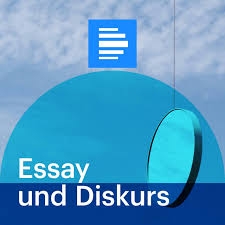 An einem Literaturkanon führt, im guten wie im schlechten, kaum ein Weg vorbei, schreibt der Literaturwissenschaftler Peter Pohl. Umso wichtiger, dass darum gestritten wird, Problematiken klar benannt sowie Kritierien immer wieder neu überprüft und neue hinzugezogen werden, findet er. Dass exemplarische Literaturgeschichte lange Zeit etwa hauptsächlich Literatur von Männern umfasste, ist eine Schieflage, auf die Pohl gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen schon vor Jahren hingewiesen hat. Damit gehen jedoch - alte wie neue - Probleme einher. So stellt sich "die Frage, welche Texte zum Beispiel von Frauen für die Kanonerweiterung auszuwählen wären. Sollen es Texte sein, die sich an die Wertungsschemata des gängigen Kanons anpassen? Dann müssten sie ... einem 'sex-gender-System' entsprechen, das Frauen diskriminiert. Oder wäre ein eigener, zum Beispiel queerer Kanon, der queeres Protestpotential nach (queer-)feminstischen Erwartungen entfaltet, die richtige Option? Dann gäbe es bald so viele Kanones wie Akteursgruppen, die nach Repräsentation verlangen. Oder müsste man die aufgrund der historischen Macht- und Bildungsstrukturen nahezu ausschließlich männlichen kanonisierten Autoren auf ihre subversive Kraft hin lesen?" Damit "wäre jedoch die Gleichsetzung von biologischem Geschlecht und sozialem Gender aufzugeben." Derzeit jedoch "ist die Fokussierung auf diskriminierte Personengruppen, sei es als Produzenten, sei es als literarische Figuren, in der universitären Lehre höchst erfolgreich. Die Schablonen der Diversität und die persönliche Betroffenheit von Diskriminierten erleichtern es vielen Studierenden, sich Literatur identifikatorisch anzunähern. ... Damit, dass Individuen derart über physische und kontingente Merkmale, also essenzialistisch, erfasst werden, hat man scheinbar kein Problem. Dass Literatur gerade durch ihre ästhetische Eigenheit oder Verfahren der Verfremdung es erlaubt, Urteilsfähigkeit zu schulen, indem sie routinisierte Wertungsmuster in Frage stellt, indem sie irritiert und verunsichert, erscheint aktuell eher als hinderlicher Gedanke." Pohls Plädoyer: "Literaturwissenschaft sollte der Ort sein oder wieder werden, an dem aufbauend auf literaturgeschichtlichen und -theoretischen Kenntnissen anhand von Motivik, narrativen und rhetorischen Analysen sowie Vergleichen gewertet wird und an dem über Wertungen gestritten werden darf und soll. Nicht die Herstellung einer gewünschten sozialen Realität durch Literaturauswahl und -interpretation sollte ihr Ziel sein, sondern die Kenntnis und Analyse der hierbei historisch wie gegenwärtig eingesetzten Strategien."
An einem Literaturkanon führt, im guten wie im schlechten, kaum ein Weg vorbei, schreibt der Literaturwissenschaftler Peter Pohl. Umso wichtiger, dass darum gestritten wird, Problematiken klar benannt sowie Kritierien immer wieder neu überprüft und neue hinzugezogen werden, findet er. Dass exemplarische Literaturgeschichte lange Zeit etwa hauptsächlich Literatur von Männern umfasste, ist eine Schieflage, auf die Pohl gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen schon vor Jahren hingewiesen hat. Damit gehen jedoch - alte wie neue - Probleme einher. So stellt sich "die Frage, welche Texte zum Beispiel von Frauen für die Kanonerweiterung auszuwählen wären. Sollen es Texte sein, die sich an die Wertungsschemata des gängigen Kanons anpassen? Dann müssten sie ... einem 'sex-gender-System' entsprechen, das Frauen diskriminiert. Oder wäre ein eigener, zum Beispiel queerer Kanon, der queeres Protestpotential nach (queer-)feminstischen Erwartungen entfaltet, die richtige Option? Dann gäbe es bald so viele Kanones wie Akteursgruppen, die nach Repräsentation verlangen. Oder müsste man die aufgrund der historischen Macht- und Bildungsstrukturen nahezu ausschließlich männlichen kanonisierten Autoren auf ihre subversive Kraft hin lesen?" Damit "wäre jedoch die Gleichsetzung von biologischem Geschlecht und sozialem Gender aufzugeben." Derzeit jedoch "ist die Fokussierung auf diskriminierte Personengruppen, sei es als Produzenten, sei es als literarische Figuren, in der universitären Lehre höchst erfolgreich. Die Schablonen der Diversität und die persönliche Betroffenheit von Diskriminierten erleichtern es vielen Studierenden, sich Literatur identifikatorisch anzunähern. ... Damit, dass Individuen derart über physische und kontingente Merkmale, also essenzialistisch, erfasst werden, hat man scheinbar kein Problem. Dass Literatur gerade durch ihre ästhetische Eigenheit oder Verfahren der Verfremdung es erlaubt, Urteilsfähigkeit zu schulen, indem sie routinisierte Wertungsmuster in Frage stellt, indem sie irritiert und verunsichert, erscheint aktuell eher als hinderlicher Gedanke." Pohls Plädoyer: "Literaturwissenschaft sollte der Ort sein oder wieder werden, an dem aufbauend auf literaturgeschichtlichen und -theoretischen Kenntnissen anhand von Motivik, narrativen und rhetorischen Analysen sowie Vergleichen gewertet wird und an dem über Wertungen gestritten werden darf und soll. Nicht die Herstellung einer gewünschten sozialen Realität durch Literaturauswahl und -interpretation sollte ihr Ziel sein, sondern die Kenntnis und Analyse der hierbei historisch wie gegenwärtig eingesetzten Strategien."Elet es Irodalom (Ungarn), 16.01.2026
 Der Regisseur Béla Tarr verstarb am 6. Januar 2026 (unsere Resümees). In der Wochenzeitschrift Élet és Irodalom nehmen Weggefährten des Regisseurs Abschied, so auch der Schriftsteller László Krasznahorkai: "Der Tod von Béla Tarr ist für uns alle ein großer Verlust, auch für mich persönlich. Ich habe einen sehr engen Freund verloren, einen Partner in der visuellen Magie, die er auf die Leinwand des dunklen Kinos gezaubert hat, und überhaupt: Ich habe ein dunkles Kino verloren, in dem es nicht mehr so viel Licht geben wird, wie Béla es dort geschaffen hat. Es bleibt mir und uns das Kino, leer. Eine neue Welt bricht an, neue Winde wehen. Das Leben rechnet mit uns einzelnen ab. Béla Tarr war einer der größten Künstler unserer Zeit. Unbändig, brutal, unzerbrechlich. Jetzt hat ihn das Schicksal doch gebremst. Wenn die Kunst einen so radikalen Schöpfer verliert, scheint es für eine Weile, als würde alles furchtbar langweilig werden. Wer wird der nächste Rebell sein? Wer meldet sich? Wer wird das Bestehende zerschlagen? Leute. Niemand meldet sich. Was wird aus uns? Béla, komm zurück."
Der Regisseur Béla Tarr verstarb am 6. Januar 2026 (unsere Resümees). In der Wochenzeitschrift Élet és Irodalom nehmen Weggefährten des Regisseurs Abschied, so auch der Schriftsteller László Krasznahorkai: "Der Tod von Béla Tarr ist für uns alle ein großer Verlust, auch für mich persönlich. Ich habe einen sehr engen Freund verloren, einen Partner in der visuellen Magie, die er auf die Leinwand des dunklen Kinos gezaubert hat, und überhaupt: Ich habe ein dunkles Kino verloren, in dem es nicht mehr so viel Licht geben wird, wie Béla es dort geschaffen hat. Es bleibt mir und uns das Kino, leer. Eine neue Welt bricht an, neue Winde wehen. Das Leben rechnet mit uns einzelnen ab. Béla Tarr war einer der größten Künstler unserer Zeit. Unbändig, brutal, unzerbrechlich. Jetzt hat ihn das Schicksal doch gebremst. Wenn die Kunst einen so radikalen Schöpfer verliert, scheint es für eine Weile, als würde alles furchtbar langweilig werden. Wer wird der nächste Rebell sein? Wer meldet sich? Wer wird das Bestehende zerschlagen? Leute. Niemand meldet sich. Was wird aus uns? Béla, komm zurück."Le Grand Continent (Frankreich), 13.01.2026
Das Magazin Le Grand Continent, das immerhin von der äußerst renommierten Ecole Normale Supérieure betrieben wird und das uns nie als besonders "links" auffiel, übersetzt ein Porträt über Reza Pahlavi, das ursprünglich in der Boston Review erschienen war. Der Artikel des Anthropologen Alex Shams liest sich allerdings über weite Strecken, als wäre er von einem Anhänger des Mullah-Regimes geschrieben worden. Pahlavi erscheint darin als schiere Marionette Netanjahus, Trumps und des saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman. Shams wirft allen drei Mächten vor, einen Regimewechsel zu wollen, während er nahelegt, dass sowohl die Iraner als auch die Exiliraner einen "Wandel durch Annäherung" befürworteten. Dass Israel an einem Regimewechsel interessiert sein könnte, weil der Iran der größte Sponsor eines neuen Holocaust ist, und welche Rolle das Bündnis der iranischen Linken mit den Islamisten spielte, erwähnt Shams nicht. Nur dies: "Israel verfügt über die nötige Feuerkraft, um die iranische Regierung im Alleingang zu stürzen, und das ausgedehnte Netzwerk aus Lobbyisten und Bot-Armeen hat dazu beigetragen, Pahlavi das zu verschaffen, wovon er immer geträumt hat, aber nie hatte: den Anschein von Unterstützung durch das Volk."
Die Zeitschrift Iran im Diskurs war dem Perlentaucher bisher unbekannt, sie scheint der Figur des Schahs (1919-1980) wesentlich gewogener zu sein. Hier erschien schon im letzten Jahr ein Artikel, der mit vielen Details, Zitaten und Informationen zur deutschen 68er Bewegung und ihrem Verhältnis zum Iran aufwartet. Ob man die Verteidigung des Schahs nun teilt oder nicht, der Autor Hossein Pourseifi kommt auf das Bündnis auch der westlichen Linken mit den Islamisten zurück, das viel älter ist als Foucaults immer wieder zitierte begeisterte Äußerungen über die iranische Revolution. Und gerade für die Geschichte der Bundesrepublik war es prägend: Pourseifi schildert die engen Beziehungen zwischen der berühmten Publizistin Ulrike Meinhof, dem Studentenführer Rudi Dutschke und dem iranischstämmigen Studenten Bahman Nirumand. Nirumands Bestseller "Persien, Modell eines Entwicklungslandes oder Die Diktatur der freien Welt" und die Propagierung des Buchs durch Meinhof und Dutschke spielten eine zentrale Rolle für die Demo am 2. Juni 1967, bei der bekanntlich Benno Ohnesorg erschossen wurde. Pourseifi behauptet, dass Nirumand falsch über den Schah informiert hätte, er greift einen großen Artikel des Spiegel von 1967 auf, der auf Nirumand antwortet und ein ganz anderes Bild vom Iran unter dem Schah zeichnet. Und er kommt auf die schmerzhafte Tatsache zurück, dass auch Nirumand jener revolutionären linksextremen "Konföderation Iranischer Studenten (CISNU)" angehörte, die zusammen mit Khomeini die iranische Revolution vorantrieb: "Die iranischen Studenten in der 'Konföderation' stilisierten Khomeini und die terroristischen Guerillagruppen, die gemordet und gebombt hatten und daher als Terroristen verfolgt wurden, zu Helden des Widerstands für Freiheit und Demokratie. Diese Mär von 'freiheitsliebenden Demokraten' im Kampf gegen die 'Diktatur des Schahs' wird auch heute von iranischen und deutschen Linken propagiert und von deutschen Medien als Fakt akzeptiert. Doch diese Radikalen wollten Freiheit und Demokratie auf die gleiche Weise wie die ETA, die RAF oder die Hamas." Einziger Trost an diesen Kontexten: die Einsicht, dass die Zeiten damals noch polarisierter waren als heute. Dutschke gestand im Spiegel ganz offen ein, dass er bedauerte, den Schah nicht erschossen zu haben. "Ihn hätten wir erschießen müssen, das wäre unsere menschliche und revolutionäre Pflicht als Vertreter der 'Neuen Internationale' gewesen. Kaum war einer von uns, einer des neuen Typus menschlichen Verhaltens, Benno Ohnesorg, erschossen worden, erschien im Spiegel das schöne, 'vom Schah entwickelte' Persien."
1 Kommentar