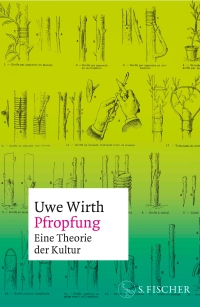Im Kino
Alles auf Null
Die Filmkolumne. Von Lukas Foerster, Thomas Groh
04.11.2015. Etwas geht zu Ende in Sam Mendes' "Spectre" - und vielleicht nicht nur Daniel Craigs Amtszeit als Bonddarsteller. Kivu Ruhorahozas präferiert in seinem faszinierenden Rätselfilm "Things of the Aimless Wanderer" die Seitwärtsbewegung."Vor dem Ende geht etwas zu Ende. … Aber noch gibt es Medien, gibt es Unterhaltung."
Friedrich Kittler: Grammophon Film Typewriter
"... these are a few of my favorite things."
Oscar Hammerstein II: My Favorite Things

"Die Toten sind lebendig": Eine programmatische Texttafel eröffnet das 24. Bond-Abenteuer, das vierte und vielleicht auch letzte der Craig-Phase. Diese erfährt mit "Spectre" Höhe- samt Fluchtpunkt und Abrundung zugleich, indem sich der Film als rahmendes, das Vorangegangene neu perspektivierendes Narrativ offenbart. Plausibilitäts- und Traditionsfanatiker, die auch im Fall von "Spectre" schon mäkeln, dass die Craig-Filme den einstigen, locker-leichten Bond-Camp-Fluff - Postkarten aus aller Welt, Connerys behaarte Männerbrust, Martini hier, Martini da und Roger Moore macht dazu einen tantig-britischen Witz - über Bord geworfen und aus dem einstigen Posterboy des 60s Chauvinismus einen grüblerischen Melancholiker gemacht haben, diese Plausibilitätsfanatiker merken zurecht an, dass diese Bewegung Richtung Epos (samt Familienfrühgeschichte und daraus folgenden schicksalhaften Verstrickungen) bloß Behauptung ist - tatsächlich ist sie das sogar buchstäblich. Dass die Ereignisse in "Casino Royale", "Ein Quantum Trost" und "Skyfall" von einer unsichtbaren Hand planmäßig gesteuert wurden, die sich nun als die (im Franchise seit "Diamonds Are Forever" nicht mehr erwähnte) Geheimorganisation "Spectre" zu erkennen gibt, muss man dem Film schlicht abnehmen. Doch geschenkt. "Spectre" macht es einem leicht, ein solches Manöver als schlichtes Zugeständnis an Erzählmoden abzutun, um den Blick auf interessantere Themen zu legen. Auch Sam Mendes, der nach dem gigantischen "Skyfall"-Erfolg noch einmal auf dem Regisseurstuhl Platz nahm, scheint das so zu handhaben.
Die Toten sind lebendig. Lebende Tote, Untote. Welche Toten? Da ist Bond selbst, der in "Skyfall" für tot erklärt wurde. Da sind die Toten aus den drei vorangegangenen Filmen, die als Heimsuchung unter der undurchdringlichen Panzerung, als die Craig seinen Körper auch hier wieder in den Dienst der Figur stellt, höchst lebendig an Bond nagen. Auch ist es das Franchise selbst, das hier - mehr noch als in den vorangegangenen Craig-Bonds - eine Art historisches Reservoir bildet: Der klassische Bondfilm als Untoter, der den Gegenwarts-Bond heimsucht und dem dieser in einer Vielzahl von Anspielungen und Zitaten Reverenz erweisen muss, obwohl doch die politischen und kulturellen Rahmenbedingungen längst andere sind als zu klassischen Connery/Moore-Zeiten. Gespenster, Zombies allenthalben. Und was ist ein Gespenst, mit Salman Rushdie gesprochen, schon anderes als "unfinished business"?
Vielleicht auch deshalb beginnt dieser Bond mit einer atemberaubenden, ultra-hochauflösenden Plansequenz beim mexikanischen "Día de los Muertos": Heerscharen als Tote verkleideter Menschen bilden die quicklebendig-wuselige Kulisse für den Startschuss dieses Abenteuers, das unseren Helden in bewährter Manier von einer Episode zur nächsten an des Pudels Kern bringt (auch Monica Bellucci, im Vorfeld als "ältestes Bond-Girl ever" gefeiert, stellt im übrigen nur eine Episode von einer Laufzeit im niedrig einstelligen Minutenbereich dar). Es geht um ein Thema von politischer Brisanz: Seit dem letzten Bond-Film "Skyfall" (Premiere im November 2012), der bereits von der Krise des handelnden Subjekts im Gadget-Zeitalter handelte, haben die Enthüllungen Edward Snowdens (seit Juni 2013) den utopischen Glanz des Internets und seiner Tools weiter ins Dystopische verschoben und nach den Glücksmomenten des Aufbegehrens im Iran und des sich anschließenden "Arabischen Frühlings", beide noch als Social-Media-Revolutionen eingestuft, eine handfeste Depression getriggert: Eben noch demokratisierten wir die Welt, schon befinden wir uns in einem hocheffizienten, transnationalen und deshalb kaum mehr greifbaren Überwachungsgebilde, das exakt jene Infrastruktur nutzt, die gerade noch ein Glücksversprechen barg.

Soweit die Realität, die in "Spectre" noch nicht geworden, aber im Entstehen begriffen ist: PRISM und andere Superprogramme der Five Eyes sind demnach eine Art Kuckucksei, das die Geheimorganisation Spectre den Geheimdiensten der westlichen Welt in mühseliger Kleinarbeit unterjubelt - eine Art Meta-Geheimdienst, der sämtliche Informationen und Datenkanäle in einen Strom überführt, an dessen Ende ein auch hier wieder auf seine Paraderolle als asig-sardonischer Bösewicht abonnierter Christoph Waltz sitzt, um per Knopfdruck die Weltherrschaft an sich zu reißen.
Dass es ausgerechnet die Recken des althergebrachten, als sympathisch altmodisch gekennzeichneten Geheimdienstes sind - Bond, M (Ralph Fiennes), Q (Ben Whishaw) und Moneypenny (Naomie Harris) -, die sich dem entgegenstellen, ist Ausdruck der spezifischen Melancholie, die den Film trägt: Wären es doch nicht die eigenen Leute gewesen, die das Unheil der Überwachung angerichtet hätten! Wären sie doch standhaft geblieben! Wo waren sie, die aufgeklärten Demokraten des Westens, als es darum ging, Position zu beziehen? Ein unerfülltes, unerfüllbares Sehnen liegt unter den atemberaubend fotografierten Bildern von "Spectre".
"Spectre" kennzeichnet den "Rise of the Machines", wie er im Terminator-Franchise noch lustvoll von der Hardware und hier von Big Data her imaginiert wird, als traumatisierend-einschneidendes Ereignis: In "Spectre" geht etwas zu Ende - der Traum vom historisch handelnden Subjekt. Die Protagonisten in "Spectre" haben eine Vergangenheit, die sie nicht loslässt, und blicken einer Zukunft entgegen, in der sie als Subjekt nicht mehr vorgesehen sind, sondern lediglich als Gegenstand von Messungen und Kalkulationen.

Vielleicht spielt der Film deshalb oft in verfallenen alten Gebäuden, die hart kontrastieren zu den gläsern-transparenten Bauten der neuen Zeit. Eine ganz eigene Wehmut beschleicht den Film, wenn er Bond im weißen Sakko und roter Knopflochblume und Léa Seydoux als klassischer Hollywood-Queen im pastellblauen Kleid in einer Art Orient-Express dinieren lässt und damit nahezu ungebrochen für einen Moment die klassische Bond-Ikonografie aufruft. Bevor der Medienpark der alten Zeit eingeht in die große Medienkonvergenz, erinnern sich die Leute daran, dass es einmal Medien gegeben hat, die noch nicht über einen Rückkanal verfügten, einen beim Lesen also nicht selbst gelesen haben: Immer wieder rücken alte Videokassetten und vergilbte Fotografien wie archäologische Fundstücke aus einer ja tatsächlich anderen Zeit ins Bild: Als nostalgische Referenz einer verschütteten Biografie einerseits, aber auch als materieller Beleg für eine Welt vor dem Zahlenhunger. "Wie wir alle wissen und nur nicht sagen, schreibt kein Mensch mehr", heißt es einmal bei Friedrich Kittler.
Bond, zurückgeworfen auf sich als Körper, der seiner (in einer Szene sogar buchstäblich) Subjektzerlegung nicht tatenlos zuschauen will, bildet selbst einen Schauplatz dieser Auseinandersetzungen: Die Gadgets, die ihm diesmal zur Seite stehen, beschränken sich auf eine simple Sprengkopf-Uhr und das ihm per Injektion verabreichte "Smartblood", das es gestattet, Bonds Körper weltweit zu orten. Die auch organische Implementierung der Medien und Tracking Devices ist im vollen Gang.
Etwas geht zu Ende. Von keiner anderen Ahnung wird "Spectre" getragen - das macht die Traurigkeit dieses Films aus. Ein letztes Mal diese global-raumgreifende Geste, bevor die physischen Arenen der politischen Auseinandersetzungen endgültig vom Algorithmus als obsolet ausgezählt wurden. Ein letztes Aufbäumen des Agentenkörpers. Ein letztes Mal Aufschub vor dem Sachzwang. Und ein-, nein, zweimal ein letztes Mal: Hollywood-Tränen, als letztes Zuflucht des Subjekts. Noch sind die Toten lebendig: Je nachdem, welche Perspektive man wählt, hat Zombiemeister George A. Romero einmal gesagt, sind wir alle Tote, die noch nicht gestorben sind - die lebenden Toten, das sind wir selbst. "Spectre" ist auf 35mm gedreht - die digitale 4K-Projektion sieht sagenhaft aus. Sein Happy End hat es nie gegeben.
Thomas Groh
Spectre - GB 2015 - Regie: Sam Mendes - Darsteller: Daniel Craig, Christopher Waltz, Léa Seydoux, Ralph Fiennes, Monica Bellucci, Ben Whishaw - Laufzeit: 148 Minuten.
---

Beobachtungsverhältnisse: Ein weißer, vollbärtiger, blauäugiger Mann in Khakihosen stapft durch den Dschungel und staunt, über das Grün der Bäume, das ihn umschließt, über das Sonnenlicht, das sich terrencemallickmäßig in den Blättern bricht, über einen tränenartig eine Felswand benetzenden Wasserfall. Verfolgt wird er von einem schwarzen, schlanken, hochgewachsenen Mann, der einen Lendenschurz trägt und mit einer Lanze bewaffnet ist. Einmal steht er mit erhobener Waffe über dem schlafenden Weißen, aber er schlägt nicht zu, bleibt auf Distanz. Ein andermal bläst er in ein Horn; die entstehenden Klänge wirken erst kräftig und bestimmt, verschleifen sich dann aber zu einem geisterhaft hallenden Soundtteppich. Schließlich taucht vor dem weißen Mann eine schwarze Frau auf, halbnackt, behängt mit traditionellem Schmuck. Die beiden stehen einander gegenüber, beobachten sich; und der andere Mann beobachtet aus dem Versteck dieses Beobachten.
Nachdem der Film die drei einige Sekunden lang fast bewegungslos stehen lässt, dringt, wie aus dem Nichts, ein anderes Bild in den Film ein, erst funkt es in ihn hinein wie ein Störartefakt, dann übernimmt es ihn komplett: Der schwarze Mann, oder zumindest der Schauspieler, der diesen Mann darstellt, befindet sich plötzlich an einem ganz anderen Ort, in einer Stadt der Gegenwart, in einem Club. Über sein Gesicht gleiten farbige Lichtreflexe. Die Beats dröhnen erst kräftig und bestimmt, verschleifen sich dann ebenfalls zu einem sphärischen Gelee. Ein Schnitt offenbart, dass der Mann schon wieder am Beobachten ist - und dass auch die Objekte seiner Beobachtung trotz des aprupten und auch im weiteren Verlauf nicht erklärten Ortswechsels stabil geblieben sind: An der Theke unterhält sich derselbe weiße Mann / Schauspieler, der im Dschungel auf Entdeckungstour war mit derselben schwarzen Frau / Schauspielerin, die schon im Dschungel Objekt der Begierde war. Auch in dieser zweiten Dreieckskonstellation bleibt eine Spannung: Die Frau nimmt dem Mann, mit dem sie sich unterhält, zwar kokett die Zigarette aus den Fingern, als er ihr dann aber seine Hand auf die Hüfte legt, drückt sie ihn weg.
Man könnte den überraschenden Szenenwechsel auch so beschreiben: In dem Moment, in dem man erwartet, dass sich eine hochgradig angespannte Situation in irgendeine Richtung auflösen, dass sich ein durch die momenthaft erzwungene Stillstellung erst recht erfühlbares Bewegungspotential entladen wird, verweigert sich der Film der Finalisierung, der Entladung; und macht statt dessen eine Seitwärtsbewegung. Das ist auch im Weiteren das, oder zumindest ein Grundprinzip des Films: Die Konstellation bleibt, die Körper auch, aber der Kontext verwandelt sich, bevor man ihn so recht zu fassen bekommt. Das geschieht mehrmals. Die drei Akteure erhalten keine stabile fiktionalen Identitäten, aber ihre vorfiktionalen Identitäten, ihre Körper, bleiben gleich, und auch ihr Verhältnis zueinander gehorcht stets ähnlichen Mustern: Immer wieder nähert sich der weiße Mann auf die eine oder andere Art der schwarzen Frau, immer wieder werden die beiden dabei von dem schwarzen Mann beobachtet. Und immer wieder "verschwindet" die Frau, wie es in einem dreimal wiederkehrenden Zwischentitel heißt.

Das hört sich alles noch schematischer und geläufiger an, als es tatsächlich ist. Kivu Ruhorahozas "Things of the Aimless Wanderer" ist ein Film, der seine Spielregeln stets genau dann, wenn man sie durchschaut zu haben glaubt, wieder über den Haufen wirft. Einmal steigt die Frau in ein Auto, dessen Fahrer man zunächst nicht sieht; es stellt sich dann heraus, dass diesmal der andere Mann drin sitzt, der, der eigentlich immer nur zuschaut. Und sie jetzt aber erwürgt. Die Leiche wird dann freilich wieder von dem Weißen entsorgt.
Ein anderes Beispiel: Mitten in dem bis dahin fast dialogfreien Film beginnt plötzlich ein Voice Over, der die vorher weitgehend opaken Geschehnisse aus der Perspektive des weißen Mannes zu ordnen scheint: Der ist Auslandsberichterstatter für eine europäische Zeitschrift und hat sich in eine geheimnisvolle Frau verliebt, die aus guter Familie stammt, heute aber als Prostituierte arbeitet. (Der andere Mann könnte ein Polizist oder Agent sein, zumindest gibt er in einer Szene telefonisch Ermittlungsergebnisse durch.) Aber je länger der Voice Over andauert, desto fahriger wird er, mal verläuft er sich in exotistischer Erotomanie, mal in Allgemeinplätzen über die korrupten Regime und die wütende Jugend Afrikas. Der weiße Journalist hat nur scheinbar die Deutungshoheit, seine Souveränität ist nur rhetorischer Natur. Am Ende verweigert sich der Film dem welterklärenden Wort genauso konsequent wie der kathartischen Handlung. Und auch alle erst einmal naheliegenden allegorischen Lesarten lässt Ruhorahoza ins Leere laufen - die postkolonialen Realitäten, die der Film zweifellos verhandelt, entziehen sich ebenso zweifellos jeglicher Figuration im Sinne von "x steht für y".
Was bleibt dann noch übrig? Schwer zu sagen… Strukturen, die nicht (nicht mehr? noch nicht?) lesbar - und die doch zweifellos Strukturen und nicht nur Rauschen - sind. Selbstbewusstes Rätselkino, gefasst in glasklare, perfekt geframte HD-Bilder, die an ihrer Oberfläche ganz und gar nicht opak erscheinen, die sich auch nicht in der kargen Verzichterästhetik gefallen, die nach wie vor weite Teile des Weltkinos in ihren Klauen hat, die ganz im Gegenteil, erst recht in Verbindung mit dem kunstvollen Sountrack, ausgesprochen sinnlich anmuten. Vor allem auch: eine Perspektive auf ein Land, das auf der Landkarte des Kinos bislang ein fast völlig blinder Fleck war. "Things of the Aimless Wanderer" wurde in Ruanda produziert, in einem Land, das ansonsten höchstens als Kulisse für Völkermord-Dramen herhalten darf.
Der vorherige Film Ruhorahozas, "Grey Matter", war der erste Langfilm überhaupt, den ein ruandischer Regisseur in seinem Heimatland verwirklichen konnte. Der Nachfolger begreift diese audiovisuelle tabula rasa nicht als Problem, sondern als Chance: Wo es keine Kinotraditionen gibt, muss man sich auch nicht zu ihnen verhalten. Und kann statt dessen, nicht in einem naiv-primitivistischen, gasparnoeschen Gewaltakt, sondern im Modus eines hochartifiziellen, raffinierten Spiels, alles auf Null setzen, auch filmästhetisch; einen Film drehen, wie als hätte es nie einen anderen gegeben. Im Filmblog Shadow and Act hat Ruhorahoza sein Credo formuliert.
Lukas Foerster
Things of the Aimless Wanderer - Ruanda 2015 - Regie: Kivu Ruhorahoza - Darsteller: Ramadhan Bizimana, Justin Mullikin, Grace Nikuze - Laufzeit: 78 Minuten.
"Things of the Aimless Wanderer" ist am 14.11. im Rahmen des Festivals Afrikamera im Berliner Kino Arsenal zu sehen. Mehr Informationen über Afrikamera finden Sie hier.
Friedrich Kittler: Grammophon Film Typewriter
"... these are a few of my favorite things."
Oscar Hammerstein II: My Favorite Things

"Die Toten sind lebendig": Eine programmatische Texttafel eröffnet das 24. Bond-Abenteuer, das vierte und vielleicht auch letzte der Craig-Phase. Diese erfährt mit "Spectre" Höhe- samt Fluchtpunkt und Abrundung zugleich, indem sich der Film als rahmendes, das Vorangegangene neu perspektivierendes Narrativ offenbart. Plausibilitäts- und Traditionsfanatiker, die auch im Fall von "Spectre" schon mäkeln, dass die Craig-Filme den einstigen, locker-leichten Bond-Camp-Fluff - Postkarten aus aller Welt, Connerys behaarte Männerbrust, Martini hier, Martini da und Roger Moore macht dazu einen tantig-britischen Witz - über Bord geworfen und aus dem einstigen Posterboy des 60s Chauvinismus einen grüblerischen Melancholiker gemacht haben, diese Plausibilitätsfanatiker merken zurecht an, dass diese Bewegung Richtung Epos (samt Familienfrühgeschichte und daraus folgenden schicksalhaften Verstrickungen) bloß Behauptung ist - tatsächlich ist sie das sogar buchstäblich. Dass die Ereignisse in "Casino Royale", "Ein Quantum Trost" und "Skyfall" von einer unsichtbaren Hand planmäßig gesteuert wurden, die sich nun als die (im Franchise seit "Diamonds Are Forever" nicht mehr erwähnte) Geheimorganisation "Spectre" zu erkennen gibt, muss man dem Film schlicht abnehmen. Doch geschenkt. "Spectre" macht es einem leicht, ein solches Manöver als schlichtes Zugeständnis an Erzählmoden abzutun, um den Blick auf interessantere Themen zu legen. Auch Sam Mendes, der nach dem gigantischen "Skyfall"-Erfolg noch einmal auf dem Regisseurstuhl Platz nahm, scheint das so zu handhaben.
Die Toten sind lebendig. Lebende Tote, Untote. Welche Toten? Da ist Bond selbst, der in "Skyfall" für tot erklärt wurde. Da sind die Toten aus den drei vorangegangenen Filmen, die als Heimsuchung unter der undurchdringlichen Panzerung, als die Craig seinen Körper auch hier wieder in den Dienst der Figur stellt, höchst lebendig an Bond nagen. Auch ist es das Franchise selbst, das hier - mehr noch als in den vorangegangenen Craig-Bonds - eine Art historisches Reservoir bildet: Der klassische Bondfilm als Untoter, der den Gegenwarts-Bond heimsucht und dem dieser in einer Vielzahl von Anspielungen und Zitaten Reverenz erweisen muss, obwohl doch die politischen und kulturellen Rahmenbedingungen längst andere sind als zu klassischen Connery/Moore-Zeiten. Gespenster, Zombies allenthalben. Und was ist ein Gespenst, mit Salman Rushdie gesprochen, schon anderes als "unfinished business"?
Vielleicht auch deshalb beginnt dieser Bond mit einer atemberaubenden, ultra-hochauflösenden Plansequenz beim mexikanischen "Día de los Muertos": Heerscharen als Tote verkleideter Menschen bilden die quicklebendig-wuselige Kulisse für den Startschuss dieses Abenteuers, das unseren Helden in bewährter Manier von einer Episode zur nächsten an des Pudels Kern bringt (auch Monica Bellucci, im Vorfeld als "ältestes Bond-Girl ever" gefeiert, stellt im übrigen nur eine Episode von einer Laufzeit im niedrig einstelligen Minutenbereich dar). Es geht um ein Thema von politischer Brisanz: Seit dem letzten Bond-Film "Skyfall" (Premiere im November 2012), der bereits von der Krise des handelnden Subjekts im Gadget-Zeitalter handelte, haben die Enthüllungen Edward Snowdens (seit Juni 2013) den utopischen Glanz des Internets und seiner Tools weiter ins Dystopische verschoben und nach den Glücksmomenten des Aufbegehrens im Iran und des sich anschließenden "Arabischen Frühlings", beide noch als Social-Media-Revolutionen eingestuft, eine handfeste Depression getriggert: Eben noch demokratisierten wir die Welt, schon befinden wir uns in einem hocheffizienten, transnationalen und deshalb kaum mehr greifbaren Überwachungsgebilde, das exakt jene Infrastruktur nutzt, die gerade noch ein Glücksversprechen barg.

Soweit die Realität, die in "Spectre" noch nicht geworden, aber im Entstehen begriffen ist: PRISM und andere Superprogramme der Five Eyes sind demnach eine Art Kuckucksei, das die Geheimorganisation Spectre den Geheimdiensten der westlichen Welt in mühseliger Kleinarbeit unterjubelt - eine Art Meta-Geheimdienst, der sämtliche Informationen und Datenkanäle in einen Strom überführt, an dessen Ende ein auch hier wieder auf seine Paraderolle als asig-sardonischer Bösewicht abonnierter Christoph Waltz sitzt, um per Knopfdruck die Weltherrschaft an sich zu reißen.
Dass es ausgerechnet die Recken des althergebrachten, als sympathisch altmodisch gekennzeichneten Geheimdienstes sind - Bond, M (Ralph Fiennes), Q (Ben Whishaw) und Moneypenny (Naomie Harris) -, die sich dem entgegenstellen, ist Ausdruck der spezifischen Melancholie, die den Film trägt: Wären es doch nicht die eigenen Leute gewesen, die das Unheil der Überwachung angerichtet hätten! Wären sie doch standhaft geblieben! Wo waren sie, die aufgeklärten Demokraten des Westens, als es darum ging, Position zu beziehen? Ein unerfülltes, unerfüllbares Sehnen liegt unter den atemberaubend fotografierten Bildern von "Spectre".
"Spectre" kennzeichnet den "Rise of the Machines", wie er im Terminator-Franchise noch lustvoll von der Hardware und hier von Big Data her imaginiert wird, als traumatisierend-einschneidendes Ereignis: In "Spectre" geht etwas zu Ende - der Traum vom historisch handelnden Subjekt. Die Protagonisten in "Spectre" haben eine Vergangenheit, die sie nicht loslässt, und blicken einer Zukunft entgegen, in der sie als Subjekt nicht mehr vorgesehen sind, sondern lediglich als Gegenstand von Messungen und Kalkulationen.

Vielleicht spielt der Film deshalb oft in verfallenen alten Gebäuden, die hart kontrastieren zu den gläsern-transparenten Bauten der neuen Zeit. Eine ganz eigene Wehmut beschleicht den Film, wenn er Bond im weißen Sakko und roter Knopflochblume und Léa Seydoux als klassischer Hollywood-Queen im pastellblauen Kleid in einer Art Orient-Express dinieren lässt und damit nahezu ungebrochen für einen Moment die klassische Bond-Ikonografie aufruft. Bevor der Medienpark der alten Zeit eingeht in die große Medienkonvergenz, erinnern sich die Leute daran, dass es einmal Medien gegeben hat, die noch nicht über einen Rückkanal verfügten, einen beim Lesen also nicht selbst gelesen haben: Immer wieder rücken alte Videokassetten und vergilbte Fotografien wie archäologische Fundstücke aus einer ja tatsächlich anderen Zeit ins Bild: Als nostalgische Referenz einer verschütteten Biografie einerseits, aber auch als materieller Beleg für eine Welt vor dem Zahlenhunger. "Wie wir alle wissen und nur nicht sagen, schreibt kein Mensch mehr", heißt es einmal bei Friedrich Kittler.
Bond, zurückgeworfen auf sich als Körper, der seiner (in einer Szene sogar buchstäblich) Subjektzerlegung nicht tatenlos zuschauen will, bildet selbst einen Schauplatz dieser Auseinandersetzungen: Die Gadgets, die ihm diesmal zur Seite stehen, beschränken sich auf eine simple Sprengkopf-Uhr und das ihm per Injektion verabreichte "Smartblood", das es gestattet, Bonds Körper weltweit zu orten. Die auch organische Implementierung der Medien und Tracking Devices ist im vollen Gang.
Etwas geht zu Ende. Von keiner anderen Ahnung wird "Spectre" getragen - das macht die Traurigkeit dieses Films aus. Ein letztes Mal diese global-raumgreifende Geste, bevor die physischen Arenen der politischen Auseinandersetzungen endgültig vom Algorithmus als obsolet ausgezählt wurden. Ein letztes Aufbäumen des Agentenkörpers. Ein letztes Mal Aufschub vor dem Sachzwang. Und ein-, nein, zweimal ein letztes Mal: Hollywood-Tränen, als letztes Zuflucht des Subjekts. Noch sind die Toten lebendig: Je nachdem, welche Perspektive man wählt, hat Zombiemeister George A. Romero einmal gesagt, sind wir alle Tote, die noch nicht gestorben sind - die lebenden Toten, das sind wir selbst. "Spectre" ist auf 35mm gedreht - die digitale 4K-Projektion sieht sagenhaft aus. Sein Happy End hat es nie gegeben.
Thomas Groh
Spectre - GB 2015 - Regie: Sam Mendes - Darsteller: Daniel Craig, Christopher Waltz, Léa Seydoux, Ralph Fiennes, Monica Bellucci, Ben Whishaw - Laufzeit: 148 Minuten.
---

Beobachtungsverhältnisse: Ein weißer, vollbärtiger, blauäugiger Mann in Khakihosen stapft durch den Dschungel und staunt, über das Grün der Bäume, das ihn umschließt, über das Sonnenlicht, das sich terrencemallickmäßig in den Blättern bricht, über einen tränenartig eine Felswand benetzenden Wasserfall. Verfolgt wird er von einem schwarzen, schlanken, hochgewachsenen Mann, der einen Lendenschurz trägt und mit einer Lanze bewaffnet ist. Einmal steht er mit erhobener Waffe über dem schlafenden Weißen, aber er schlägt nicht zu, bleibt auf Distanz. Ein andermal bläst er in ein Horn; die entstehenden Klänge wirken erst kräftig und bestimmt, verschleifen sich dann aber zu einem geisterhaft hallenden Soundtteppich. Schließlich taucht vor dem weißen Mann eine schwarze Frau auf, halbnackt, behängt mit traditionellem Schmuck. Die beiden stehen einander gegenüber, beobachten sich; und der andere Mann beobachtet aus dem Versteck dieses Beobachten.
Nachdem der Film die drei einige Sekunden lang fast bewegungslos stehen lässt, dringt, wie aus dem Nichts, ein anderes Bild in den Film ein, erst funkt es in ihn hinein wie ein Störartefakt, dann übernimmt es ihn komplett: Der schwarze Mann, oder zumindest der Schauspieler, der diesen Mann darstellt, befindet sich plötzlich an einem ganz anderen Ort, in einer Stadt der Gegenwart, in einem Club. Über sein Gesicht gleiten farbige Lichtreflexe. Die Beats dröhnen erst kräftig und bestimmt, verschleifen sich dann ebenfalls zu einem sphärischen Gelee. Ein Schnitt offenbart, dass der Mann schon wieder am Beobachten ist - und dass auch die Objekte seiner Beobachtung trotz des aprupten und auch im weiteren Verlauf nicht erklärten Ortswechsels stabil geblieben sind: An der Theke unterhält sich derselbe weiße Mann / Schauspieler, der im Dschungel auf Entdeckungstour war mit derselben schwarzen Frau / Schauspielerin, die schon im Dschungel Objekt der Begierde war. Auch in dieser zweiten Dreieckskonstellation bleibt eine Spannung: Die Frau nimmt dem Mann, mit dem sie sich unterhält, zwar kokett die Zigarette aus den Fingern, als er ihr dann aber seine Hand auf die Hüfte legt, drückt sie ihn weg.
Man könnte den überraschenden Szenenwechsel auch so beschreiben: In dem Moment, in dem man erwartet, dass sich eine hochgradig angespannte Situation in irgendeine Richtung auflösen, dass sich ein durch die momenthaft erzwungene Stillstellung erst recht erfühlbares Bewegungspotential entladen wird, verweigert sich der Film der Finalisierung, der Entladung; und macht statt dessen eine Seitwärtsbewegung. Das ist auch im Weiteren das, oder zumindest ein Grundprinzip des Films: Die Konstellation bleibt, die Körper auch, aber der Kontext verwandelt sich, bevor man ihn so recht zu fassen bekommt. Das geschieht mehrmals. Die drei Akteure erhalten keine stabile fiktionalen Identitäten, aber ihre vorfiktionalen Identitäten, ihre Körper, bleiben gleich, und auch ihr Verhältnis zueinander gehorcht stets ähnlichen Mustern: Immer wieder nähert sich der weiße Mann auf die eine oder andere Art der schwarzen Frau, immer wieder werden die beiden dabei von dem schwarzen Mann beobachtet. Und immer wieder "verschwindet" die Frau, wie es in einem dreimal wiederkehrenden Zwischentitel heißt.

Das hört sich alles noch schematischer und geläufiger an, als es tatsächlich ist. Kivu Ruhorahozas "Things of the Aimless Wanderer" ist ein Film, der seine Spielregeln stets genau dann, wenn man sie durchschaut zu haben glaubt, wieder über den Haufen wirft. Einmal steigt die Frau in ein Auto, dessen Fahrer man zunächst nicht sieht; es stellt sich dann heraus, dass diesmal der andere Mann drin sitzt, der, der eigentlich immer nur zuschaut. Und sie jetzt aber erwürgt. Die Leiche wird dann freilich wieder von dem Weißen entsorgt.
Ein anderes Beispiel: Mitten in dem bis dahin fast dialogfreien Film beginnt plötzlich ein Voice Over, der die vorher weitgehend opaken Geschehnisse aus der Perspektive des weißen Mannes zu ordnen scheint: Der ist Auslandsberichterstatter für eine europäische Zeitschrift und hat sich in eine geheimnisvolle Frau verliebt, die aus guter Familie stammt, heute aber als Prostituierte arbeitet. (Der andere Mann könnte ein Polizist oder Agent sein, zumindest gibt er in einer Szene telefonisch Ermittlungsergebnisse durch.) Aber je länger der Voice Over andauert, desto fahriger wird er, mal verläuft er sich in exotistischer Erotomanie, mal in Allgemeinplätzen über die korrupten Regime und die wütende Jugend Afrikas. Der weiße Journalist hat nur scheinbar die Deutungshoheit, seine Souveränität ist nur rhetorischer Natur. Am Ende verweigert sich der Film dem welterklärenden Wort genauso konsequent wie der kathartischen Handlung. Und auch alle erst einmal naheliegenden allegorischen Lesarten lässt Ruhorahoza ins Leere laufen - die postkolonialen Realitäten, die der Film zweifellos verhandelt, entziehen sich ebenso zweifellos jeglicher Figuration im Sinne von "x steht für y".
Was bleibt dann noch übrig? Schwer zu sagen… Strukturen, die nicht (nicht mehr? noch nicht?) lesbar - und die doch zweifellos Strukturen und nicht nur Rauschen - sind. Selbstbewusstes Rätselkino, gefasst in glasklare, perfekt geframte HD-Bilder, die an ihrer Oberfläche ganz und gar nicht opak erscheinen, die sich auch nicht in der kargen Verzichterästhetik gefallen, die nach wie vor weite Teile des Weltkinos in ihren Klauen hat, die ganz im Gegenteil, erst recht in Verbindung mit dem kunstvollen Sountrack, ausgesprochen sinnlich anmuten. Vor allem auch: eine Perspektive auf ein Land, das auf der Landkarte des Kinos bislang ein fast völlig blinder Fleck war. "Things of the Aimless Wanderer" wurde in Ruanda produziert, in einem Land, das ansonsten höchstens als Kulisse für Völkermord-Dramen herhalten darf.
Der vorherige Film Ruhorahozas, "Grey Matter", war der erste Langfilm überhaupt, den ein ruandischer Regisseur in seinem Heimatland verwirklichen konnte. Der Nachfolger begreift diese audiovisuelle tabula rasa nicht als Problem, sondern als Chance: Wo es keine Kinotraditionen gibt, muss man sich auch nicht zu ihnen verhalten. Und kann statt dessen, nicht in einem naiv-primitivistischen, gasparnoeschen Gewaltakt, sondern im Modus eines hochartifiziellen, raffinierten Spiels, alles auf Null setzen, auch filmästhetisch; einen Film drehen, wie als hätte es nie einen anderen gegeben. Im Filmblog Shadow and Act hat Ruhorahoza sein Credo formuliert.
Lukas Foerster
Things of the Aimless Wanderer - Ruanda 2015 - Regie: Kivu Ruhorahoza - Darsteller: Ramadhan Bizimana, Justin Mullikin, Grace Nikuze - Laufzeit: 78 Minuten.
"Things of the Aimless Wanderer" ist am 14.11. im Rahmen des Festivals Afrikamera im Berliner Kino Arsenal zu sehen. Mehr Informationen über Afrikamera finden Sie hier.
Kommentieren