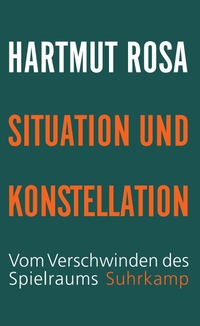Im Kino
Auf das Mittelmeer hin entworfen
Die Filmkolumne. Von Lukas Foerster, Nikolaus Perneczky
28.09.2011. Jean-Luc Godard findet in seinem "Film Socialisme" kleine, leuchtende Bilder für das große Ganze des europäischen 20. Jahrhunderts. Matthew Porterfield dagegen bleibt auch in seinem zweiten Film "Putty Hill" in Baltimore und registriert Spuren, die ein Mensch in der Welt hinterlassen hat.
Eine erstaunlich geradlinige Exposition dessen, was man als das Projekt des späten Godard bezeichnen könnte, findet sich in dessen "King Lear" von 1987. Die irgendwie vertraute, dabei aber doch stetig sich erneuernde Matrix aus Wörtern, Tönen und Bildern wird darin mit dem Schweigen von Lears Tochter Cordelia in Verbindung gebracht, welches kein "NOTHING", sondern "NO THING" sei; nicht reine Negation des sprachlichen Ausdrucks, sondern ein kritisches Befragen und ein Aufbrechen seines verdinglichenden Moments.
Wenn man das als eine bündige Definition, freilich eine unter vielen anderen, des Spätwerks (des Godard der "Histoire(s) du Cinema") stehen lässt, dann kann man ohne Übertreibung sagen, dass dieser Entwurf in "Film Socialisme" zu so etwas wie seiner reifen Form gefunden hat. Oder besser noch: dass der späte Godard sich hier, nicht zum ersten Mal, aber so nachdrücklich wie noch nie, als generatives Prinzip von seiner Autorenschaft emanzipiert und so, in der Art eines Testaments, die Bedingungen dazu schafft, dass Godard (die Idee des Kinos) Godard (den Menschen des Kinos) überlebe.
"Film Socialisme", das lose Nebeneinander der beiden alles und nichts bedeutenden Begriffe im Titel deutet es bereits an, spricht nicht in ganzen, grammatisch zugerichteten Sätzen zu uns, sondern in vetraut-unheimlichen, zwischen Enigma und Evidenz changierenden Ton/Bild/Schrift-Konstellationen. Die Auslassung zwischen dem Film und dem Sozialismus entspricht dem Schnitt zwischen zwei Bildern, der einmal das Verbindende, ein andermal das Trennende des von ihm in Beziehung Gesetzten bedeuten kann.

Wir befinden uns auf einem Kreuzfahrtschiff, auf dem Godard eine ganze Welt entfaltet. Diese Welt ist Europa, seine Geschichte und Gegenwart, sein Gutes und sein Schlechtes auf das Mittelmeer hin entworfen, von diesem seine Kräfte, seinen Antrieb empfangend. Das Meer, von dem "Film Socialisme" seinen Ausgang nimmt, und auf das der Film wieder und wieder zurückkommt - in vom Wellenschlag beherrschten Einstellungen und solchen, worin die Wogen so etwas wie die Grenze, den Saum einer Welt bilden, die sich für grenzenlos und allumfassend hält - dieses Meer kann beides sein, das Offene oder der Abgrund. Für die Dauer von "Film Socialisme" ist es einmal wirklich, wofür der lahme Kalauer aus dem Reiseprospekt es uns verkaufen will: ein Mehr, das über die verfestigten Formen des All(zu)täglichen hinausreicht.
Die ägyptische, israelische und griechische Küste entlang, dann über den Bosporus bis nach Odessa führt die Route des Kreuzfahrtschiffs. Trotzdem ist der Reiseleiter Godard in gewisser Weise ein Eurozentrist, aber eben einer, dem es um die Fliehkräfte weg vom Zentrum geht. Von der Wiege der westlichen Zivilisation über ihre Katastrophe (die Shoa) und ihr Fanal (die russische Revolution) im 20. Jahrhundert bis in eine Gegenwart, für die Godard kleine, leuchtende Bilder findet, die zum manchmal Großspurigen seines Geschichtsentwurfs in einem sympathisch schiefen Verhältnis stehen: Youtube-Kätzchen meets Panzerkreuzer Potemkin.
Die Familie Martin, die den überraschenden Mittelpunkt der zweiten Hälfte von "Film Socialisme" bildet, ist, wie eine Einblendung am Schluss erhellt, in Wirklichkeit eine "Familie". Die Anführungszeichen ziehen das von ihnen Umklammerte in Zweifel, und halten zugleich an ihm - an etwas an ihm - fest in einer dialektischen Bewegung, wie sie selten so unaufdringlich anschaulich wurde. Zitiert wird hier der Deckname einer Zelle der Resistance, deren Wahlspruch "liberer et federer", befreien und vereinigen, lautete. Welche Rolle Vater, Mutter und die beiden Kinder in der Godard'schen Familiensimulation innehaben, wird daher gleich zu Beginn radikal infrage gestellt. Die Kinder fordern den Bruch mit der alten Ordnung, verweigern (wie Cordelia in "King Lear") den Eltern nicht die Liebe, aber ihren selbstverständlichen Ausdruck. Wie man spricht, denkt, sieht, sich bewegt, beisammen ist: alles soll zur Verhandlungsmasse werden in ihrem mit großen Ernst vorgeführten Spiel. Auf die in Bewegung geratene Familie stürzt sich ein zweiköpfiges Fernsehteam eines französischen Regionalsenders, dessen Versuche, die politischen Prozesse im Inneren der Familie abzubilden, ein ums andere Mal abgeschmettert werden.
Das Idiom des späten Godard mag einem vertraut vorkommen, aber es ist in sich so wendig und universell anwendbar, dass seine Ausdruckskraft sich nicht zu erschöpfen scheint. In "Film Socialisme" kommt zum bekannten Formeninventar aber noch eine Erfindung hinzu, die sich in so vollendeter Komplementarität an Godards Bildersprache des "NO THING" anschmiegt, dass man sich staunend fragen muss, weshalb sie ihm nicht schon früher eingefallen ist. Die Rede ist von der (von Godard selbst so bezeichneten) "Navajo English"-Untertitelung, die, anstatt ganze Sätze wiederzugeben, oft nur aus einigen unverbundenen, den ungefähren Sinn oder die Sinnrichtung einer Szene angebenden Wörtern besteht. Das fügt sich nicht nur theoretisch ins übergreifenden Montagekalkül (das ja auch syntagmatisch-grammatikalisch uneindeutige Verbindungen stiftet), sondern erweist sich darüberhinaus auch auf der Ebene intuitiver, spontaner Kontaktnahme mit der Oberfläche des Films als durch und durch schlüssiges Verfahren. Ein Glück, dass "Film Socialisme" in Berlin nun regulär, wenn zunächst auch nur in zwei Kinos, startet.
Nikolaus Perneczky
***

"Putty Hill" ist der zweite Film des jungen amerikanischen Regisseurs Matthew Porterfield. Wie der erste, "Hamilton" (2006), spielt er in einem Vorort Baltimores und porträtierte eine Gruppe von Menschen am Rande - aber noch nicht außerhalb - der Gesellschaft. Anders als der sehr frei erzählte Vorgänger, in dem man manche Verwandtschaftsverhältnisse bis zum Schluss nicht so ohne weiteres durchschauen konnte, hat "Putty Hill" ein eindeutiges Zentrum: Eine Beerdigung hält den Film zusammen. Der Tote hieß Cory, war 24 Jahre alt und starb an einer Überdosis.
Der Film definiert seine - in Ermangelung eines besseren Ausdrucks, so recht passt das nicht in diesem Film - Figuren einerseits über ihr Verhältnis zu Cory, andererseits platziert er sie von Anfang an in der Welt. Der Bruder spielt im Wald Paintball. Der Vater arbeitet in seiner Wohnung als Tätowierer. Die Schwester reist aus Delaware an und antwortet auf die Frage, ob sie Baltimore vermisse, wie aus der Pistole geschossen: "Nein!". Einige Jugendfreundinnen des Toten gehen im Wald spazieren. Daneben stehen kleine Details, die keine Anschlüsse haben: die Suche nach einem Bankräuber, ein muskulöser Mann auf einem Rasenmäher. Manchmal werden die Schauspieler, wie im Dokumentarfilm oder im Reality-TV, aus dem Off angesprochen und reden dann direkt ins Publikum. Das Dokumentarische an diesen Bildern bezieht sich nicht auf die eindeutig und vollständig fiktionale Filmhandlung, sondern auf die (allesamt nichtprofessionellen) Schauspieler selbst, auf ihre Redeweise, auf ihr Verhalten zur Kamera.

Einige Räume des Films: ein Wald, ein Skatepark, ein (kalter) Pool im Garten, ein See, in dem einige Jugendliche baden und Drogen nehmen, Innenräume, die oft nicht besonders wohnlich oder auch nur bewohnt wirken. Keiner dieser Räume ist nur neutraler Behälter für Handlung, keiner auch einfach nur Milieu, das sich an die Figuren anschmiegt und sie definiert. Der Film ist zu neugierig auf diese Räume, sie behalten eine Fremdheit, einen Eigenwert, der sich zum Beispiel im Sonneneinfall auf eine karge Wand (mit der der Film beginnt) oder in langsamen Kamerafahrten durch die Zimmer der Jugendlichen herstellt.
Aus ähnlichen Gründen ist der Film all das nicht, was er, seiner Inhaltsangabe zufolge, sehr leicht sein könnte: kein Sozialdrama, keine Milieustudie, kein Generationenporträt. Solche Zuordnungen würden voraussetzen, dass die Sinneseindrücke, die "Putty Hill" beschreibt und ermöglicht, schon vorgeordnet, auf eine These hin kalkuliert wären. Statt dessen wird ihr Verhältnis zueinander ständig neu bestimmt. Zum Beispiel schieben sich immer wieder Geräusche vor die Dialoge: Das Summen einer Tätowiernadel, das Rauschen eines Bachs oder der Motor eines Rasenmähers. Das Tondesign ist in deswegen aber nicht einfach nur naturalistisch; in einer anderen Szene entfernen sich zwei Skater von der Kamera, verschwinden fast zwischen den Häusern, ihre Stimmen aber bleiben ganz nah. Es scheint in beiden Fällen darum zu gehen, Sprache nicht nur als Kommunikationsmedium zu begreifen, sondern das Sprechen als materiellen Akt sichtbar zu machen.
Einen dramatischen Bogen gibt es nicht. Die einzelnen Szenen ordnen sich locker um den Abwesenden, den Toten, von dem nur einmal, gegen Ende, eine Fotografie auftaucht, die seltsam defizitär erscheint als Zeichen für einen Menschen, von dessen Weltverhältnissen man vorher viel kennengelernt zu haben glaubt. Möglicherweise ist dieses gefühlte "zu wenig" des Bildes tatsächlich eine schlüssige Abbildung von Verlust, eine schlüssigere zumindest als das schief gesungene "I Will Always Love You" auf der Beerdigung oder der eine, große Zusammenbruch auf dem Balkon, die beiden einzigen Szenen, in denen der Film seiner eigenen Ästhetik zu misstrauen scheint und sich konventioneller dramaturgischer Mittel bedient (gegen die, darum geht es nicht, an sich nichts spricht, die diesem Film aber äußerlich bleiben). Verbindungen innerhalb des Films stiften sich oft weniger durch einen Handlungszusammenhang, als über nur auf den ersten Blick abstrakte Ähnlichkeiten von Bewegungen und Handlungen: Die Tattoos, die mit der Nadel in die Haut geritzt werden finden ihren Widerhall in Buchstaben, die mit dem Messer in eine Baumrinde geritzt werden. Physische Spuren, die Schmerzen verursachen, weil sie die Oberfläche verletzen. Andere Spuren, wie das "Rest in Peace"-Graffitti am Skatepark, verursachen weniger oder gar keine Schmerzen, aber sie werden auch schneller verschwinden. Wieder andere, wie die Paintball-Treffer, kann man sofort wegwischen. Aber der Aufprall der Farbgeschosse muss erst einmal gefühlt, registriert werden.
Lukas Foerster
Film Socialisme - Schweiz 2010 - Regie: Jean-Luc Godard - Darsteller: Catherine Tanvier, Christian Sinniger, Jean Marc Stehle, Patti Smith, Robert Maloubier, Nadege Beausson-Diagne - Länge: 102 min.
Putty Hill - USA 2010 - Regie: Matthew Porterfield - Darsteller: Sky Ferreira, Zoe Vance, James Siebor Jr., Dustin Ray, Charles "Spike" Sauers, Catherine Evans, Virginia Heath, Cody Ray, Casey Weibust, Drew Harris, Marina Siebor - Länge: 87 min.
Kommentieren