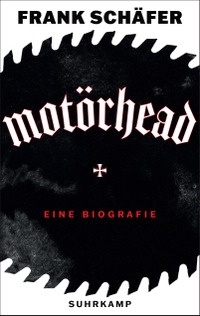Im Kino
Eine Prise Meta
Die Filmkolumne. Von Thomas Groh, Friederike Horstmann
26.03.2014. Systematische Uneindeutigkeiten produziert Abbas Kiarostami in seinem ersten in Japan produzierten Film "Like Someone in Love". Paul W.S. Anderson interessiert sich in "Pompeii" nicht für feuilletonistische Feigenblätter, sondern für Kinofetische der plebeischeren Art.
In seinem ersten in Japan gedrehten Film "Like Someone in Love" genügt dem iranischen Regisseur Abbas Kirostami eine starre Einstellung, um ein Spiel um Sichtbares und Unsichtbares zu etablieren, das Verhältnis von Visuellem und Akustischem prekär werden zu lassen, den Blick zu verunsichern. In einer Tokioter Nachtbar erklingt Jazzmusik, Geschirr klirrt, Gespräche vermurmeln. Über diese Bargeräusche legt sich eine Frauenstimme. Sie kann weder den am Tisch sitzenden noch den im Gang stehenden Gästen zugeordnet werden, auch von der Frau im Halbprofil, deren Gesicht zunächst durch kinnlanges Haar verhangen ist, wird sie nicht erzeugt. Eine Stimme, nicht festzulegen woher sie kommt, wem sie gehört. Sie sucht rechtfertigend nach Ausflüchten, beteuert wiederholt die Wahrhaftigkeit ihrer Aussagen. Der Gegenschuss vollzieht einen kategorialen Sprung, eine Umwidmung des nächtlichen Barraums, zeigt eine telefonierende junge Frau, die zuvor außerhalb der Rahmung lag: Ein Telefongespräch mit dem Freund, dem Akiko eine Abendplanung vorschwindelt. Auch die ersten Einstellungen von Kirostami zeigen keine verlässlich reproduzierte Realität. Vielmehr wirkt der Wahrnehmungsraum trügerisch, denn die Trennung von Bild und Ton wirft eine doppelte Perspektive. Die Irritationen aus dem Jenseits des Bildrahmens nutzt Kirostami, um die Desorientierung an der Wahrnehmung des Kinopublikums selbst zu exekutieren. Durch seine Blickverweigerung ist der eigene Standpunkt kaum mehr sicher.
Auf dem Rücksitz eines Taxis durchquert Akiko wenig später Tokio, um als Callgirl zu einem Kunden zu fahren, der außerhalb der Stadt wohnt. Eine Autofahrt durch die Dunkelheit, ein nächtliches Rauschen, ein irrlichterndes Flimmern von Neonschriftzügen - die visuelle Strahlkraft der fluoreszierend leuchtenden Stadt. Während der Autofahrt hört Akiko diverse Combox-Nachrichten, die vor allem ihre sorgenvolle, aus der Provinz angereiste Großmutter ganztägig hinterlassen hat. Ein erneuter Off-Text, der den vergeblichen Versuch dokumentiert, die Enkelin zu treffen. Kirostami dekliniert Blickmöglichkeiten, wie Mensch, Auto und deren großstädtische Umgebung zueinander in Beziehung gesetzt werden können: Blick in den Innenraum des Autos auf Akiko, auf ihr Gesicht mit wechselnden Licht- und Schattenverhältnissen, dann der Gegenschuss, der Streifblick aus dem Fenster nach draußen auf fluktuierende Lichter und schließlich ein Blick von draußen durchs Fenster, auf dessen Glas die Großstadtilluminationen reflektieren und schillernd über Akikos Gesicht hinweg huschen, sich ineinander spiegeln, wodurch Tiefe zur Fläche wird. Dramaturgisch gesteigert wechselt der Rhythmus dieser unterschiedlichen Blickanordnungen rascher, bis Akiko an ihrer Großmutter vorbeifährt, die auf einer Kreisverkehrsinsel unter einer übermächtig großen Statue vergebens wartet.

In vielen festen Einstellungen durchmisst die Kamera die Figurenkonstellation um Akiko, ihren eifersüchtigen Freund Noriaki und einen emeritierten Soziologieprofessor Takashi. Dabei werden Figuren durch Autoscheiben, Vorhänge oder Bildbegrenzungen isoliert. Kirostami entwirft eine Geschichte, in der sich verschiedene soziale Rollen verdichten und verschieben. Im Lauf des Films entstehen immer wieder neue Begegnungen, durch voreilige Vorstellungen und Vorurteile werden neue Identitäten auch untereinander überschrieben, unterschiedliche Rollen angenommen. In dieser falschen Seifenoper betreiben auch die Andeutungen und Auslassungen den vexierhaften Wandel der Identitäten. Die Handlung nachzuerzählen, die Dialogsätze wie Botschaften zu zitieren, gäbe ein verqueres Bild. Ob der verwitwete Soziologieprofessor wirklich ein Kunde von Akiko ist, verbleibt im vieldeutigen Verweissystem unklar. Später wird er zu ihrem Surrogat-Großvater. Kirostami zeigt zwiespältige Figuren, auf die der Film sich keine eindeutige Perspektive gestattet. Auch Berufsbezeichnungen vereindeutigen unzulässig. Sie vermitteln eilfertige Identifikationen und falsche Objektivitäten, haften den Personen an wie Labels, die abgezogen werden können. Die oft durch Spiegelungen geglätteten Distanzen verbleiben ähnlich uneindeutig wie der Status der Bilder und ihr Verhältnis zu den Tönen.
Immer wieder stören gerade die Kommunikationsmittel: Telefone klingeln ohne Unterlass, unterbrechen Gespräche, Faxe fiepen, an der Haustür wird geläutet, durch die Sprechanlage wird kommuniziert, ein Anrufbeantworter schalten sich ein. Immer wieder auf der Tonspur Autogeräusche und Hupen, ein permanentes Rauschen schallt von Draußen in Takashis Wohnung. Immer wieder fallen Visuelles und Akustisches auseinander, verhalten sich brüchig und unstimmig. Töne, Geräusche und Stimmen sind gerade nicht im Bild, sind ins Off versetzt, ins Nicht-Sichtbare. Durch diese dissonante Struktur zwischen Bild und Ton, zwischen On und Off, Innen und Außen inszeniert Kirostami systematisch Uneindeutigkeiten. Dazu drängen wiederkehrende Motive ins Bild, Ähnlichkeiten und Kontiguitäten werden an anderen Bildmedien, an Fotografie und Malerei geknüpft und formieren so eine Kompression an Bildern, die Verwechselungen und Vergleiche produziert. Häufig wiederkehrende Jazzkompositionen klingen gleichzeitig wie elegische und Spielerei insinuierende Töne. Nach einem Lied von Ella Fitzgerald benannt demonstriert schon der Filmtitel eine zitierende, auf Vergleich abzielende Bauweise. Analogien setzen das Spiel der Verschiebungen in Gang. Dass Takashi nicht nur Soziologe, sondern auch Übersetzer ist, unterstreicht die Übertragungen. Immer wieder geht es um Kommunikation, deren Verfehlungen und Verschleierungen. Von Anfang an wird die Differenz zwischen Sichtbarem und Nichtsichtbarem mit der Frage nach der Vorstellbarkeit und Imagination auch für das Visuelle dramaturgisch bedeutsam gemacht. Dieses Verfahren entdeckt die eigene Position nicht als Standpunkt des Überblicks, sondern als eine variable Position unter anderen - als Relation.
Friederike Horstmann
Like Someone in Love - Frankreich / Japan 2012 - Regie: Abbas Kiarostami - Darsteller: Tadashi Okuno, Rin Takanashi, Ryo Kase, Denden, Reiko Mori - Laufzeit: 109 Minuten.
---

Natürlich weiß man, wie ein Film ausgehen wird, der sich den Titel "Pompeii" gibt. Entsprechend dräuend zieht die Kamera immer wieder von den Ereignissen in der titelgebenden Stadt hin zum erhabenen Vesuv, der wie ein Menetekel (oder auch: wie die Bekräftigung eines geleisteten Versprechens) auf das verweist, was ein Film dieses Titels in Aussicht stellt und für das man, wenn man ehrlich ist, auch ins Kino gekommen ist: eine kataklysmische Zerstörungsorgie, in diesem Fall zwar historisch rückgebunden, aber vielleicht gerade durch die antike Kulisse soweit ins Unverbindliche gerückt, dass man unbeschwert und reinsten Gewissens zusehen kann, wie eine Stadt in Schutt und Asche gelegt wird.
Bis dahin gibt es übliche Kost aus dem Sandalenfilm, die sich auf den drei Ebenen einer Gladiatoren-Arena abspielt: Oben in den höheren Rängen gibt es Intrigengetändel zwischen Rom und der Provinz, unten auf der planen Fläche die üblichen handfesten Auseinandersetzungen zwischen den Todgeweihten, die wider Willen und zum Wohlgefallen des politischen Dünkels aufeinandergehetzt werden, und darunter, in den Katakomben, wo die Gladiatoren untergebracht sind, Verbrüderungen gegen die da oben.
"Pompeii" beginnt als erstaunlich nonchalante Direktübernahme der Prämisse aus John Milius' großartigem ersten "Conan"-Film: Römische Legionen ziehen brandschatzend und mordend durch keltisches Gebiet, allein ein kleiner Junge, Milo (später von Kit Harington dargestellt), überlebt und schwört, da er den Tod seiner Eltern mitansehen musste, Rache am römischen Befehlshaber Corvus (Kiefer Sutherland). Zunächst aber fällt er in die Hände von Menschenhändlern und steigt zum Star in der Gladiatorenszene auf. In Pompeji schließlich, im Schatten des Vulkans kurz vor dem Ausbruch, kreuzen sich alle Wege: Die von Milo und Corvus, aber auch die von Milo und Cassia (Emily Browning) - und nicht zuletzt die von Milo und Atticus (Adewale Akinnuoye-Agbaje), einem weiteren Star-Gladiator, den nur noch ein siegreich bestandener Kampf vom freien Leben eines römischen Bürgers trennt.
Man kann das alles ohne weiteres einfallsarm nennen. Auch die darstellerischen Leistungen bewegen sich im überschaubaren Bereich. Und doch ringt es zumindest Respekt ab, mit welcher geradlinigen Konsequenz, auch mit welcher Effektivität Paul W.S. Anderson an einem Begriff des reinen Genrekinos arbeitet. Der Erfolg der HBO-Serie "Game of Thrones" mag die Produktion eines weiteren, im Grunde genommen recht üblichen, wenn auch handwerklich einigermaßen auf den Stand der Technik gebrachten Beitrag zum Sandalenfilm, einem Genre also, das im Unterhaltungskino lange sehr präsent war, in den letzten Jahrzehnten aber nur in Form vereinzelter Schlaglichter bedient wurde, begünstigt haben. Doch wo das Quality-TV versucht, die profanen, aber legitimen Gelüste populärer Stoffe mittels Shakespeare-artiger Intrigenspiele in den Bereich der Hochkultur zu rücken, fehlen "Pompeii" vergleichbare Ambitionen.

Der Film bietet, wie es einst die Prämisse des klassischen Genrekinos war, auf gutem Niveau "more of the same": Weder verkauft er sich als postmodernes Spiel der Zeichen und Codes, noch behauptet er für sich - wie zuletzt etwa das auch deswegen schauderhaft gescheiterte "RoboCop"-Reboot - mittels übergestreuter Aktualismen irgendeine Form von Debattenrelevanz. "Pompeii" will kein Kunstwerk sein und auch keine neue technologische Meisterleistung, sondern vor allem von fürs Feuilleton attraktiven Feigenblättern unverdeckte Sensationen liefern.
Auch zu den mehr oder weniger sanften Sadismen, die die Form des "Destruction Porn" mit sich bringt, steht Andersons "Pompeii" ungebrochen: Genüsslich legt er seine Gladiatorentruppe in der Arena erst noch in Ketten, bevor der sardonische Corvus eine Horde Legionäre auf sie hetzt. Auch eine für die etwas dunklere Form des Begehrens im Sandalenkino klassische Szene darf nicht fehlen: Natürlich wird der muskulöse Held Milo in einer Szene genüsslich ausgepeitscht (ein Kinofetisch, der mittlerweile auch in Buchform gewürdigt wird). Natürlich macht es auch dem aufgeklärtesten Publikum heutiger Tage noch irgendwie Spaß, von sicherer Position aus dabei zuzusehen, wie für andere alles den Bach runtergeht - auch wenn man hofft, dass es "die Guten" doch noch schaffen. Und dass die schöne Cassia im Zuge der allgemeinen Vulkankatastrophe zusehends im Asche-Schmutz versinkt, feiert der Film als ganz eigenes Spektakel.
Zupass kommt da die Gladiatorenthematik, die dem Film doch fast noch eine Prise Meta unterhebt: Sehr eigentlich schaut man als Kinozuschauer beim Blick in die Publikumsränge der Arena auf seine eigenen kulturhistorischen Vorfahren. Und man denkt sich: So viel hat sich eigentlich nicht geändert - im Kino, der noch immer plebeischsten Kunstform unserer Tage, ist man mit "Daumen hoch" oder "Daumen runter" noch immer schnell dabei und hat seinen Spaß daran, wenn Wucht auf Menschenkörper einwirkt. Wobei sich aber doch eine ganze Menge geändert hat: Das Kino baut auf eine Geschichte der Zivilisierung auf und dort, wo es einem eine historische Keimzelle heutiger Spektakellust direkt vor Augen führt, beruhigt es einen im Kinosessel immer auch im Flüsterton: "No human beings were harmed during the making of this movie." Ist ja eh alles nur digital.
Thomas Groh
Pompeii - USA 2014 - Regie: Paul W.S. Anderson - Darsteller: Kit Harington, Carrie-Anne Moss, Emily Browning, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Jessica Lucas, Jared Harris, Kiefer Sutherland - Laufzeit: 105 Minuten.
Kommentieren