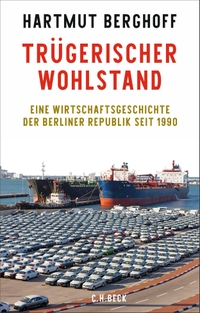Im Kino
Ein Medium der Scham
Die Filmkolumne. Von Lukas Foerster, Jochen Werner
16.05.2012. Emmanuel Mourets Episodenfilm "Die Kunst zu lieben" weiß um die Komplexität der Liebe wie der Ästhetik. Olias Barcos schwarzhumorige Groteske "Kill Me Please" seziert eine Servicemaschinerie des Tötens.
Das Schamgefühl, so wird an einer Stelle in Emmanuel Mourets "Die Kunst zu lieben" aus der Zeitung verlesen, sitzt im Gesichts- und im Gehörsinn. Diese Behauptung hat eine konkrete Funktion im Plot: Um die eigene Scham zu überwinden, macht Amélie ihrem von ihr besessenen Kollegen Boris das Angebot: sie werde zwar ein einziges mal mit ihm schlafen - aber nur in einem komplett verdunkelten Raum und bei komplettem Sprechverbot; es folgen die erwartbaren Missverständnisse. Man kann diese "wissenschaftliche Erkenntnis" jedoch auch zum Anlass nehmen für ein Gedankenspiel: Das Kino zielt, als audiovisuelles Medium, eben und ausschließlich auf Gesichts- und Gehörsinn, ist also, nach Mouret, in der Gesamtheit der Bilder und Töne, die es hervorbringt, ein Medium der Scham. Steht damit das Audiovisuelle des Kinos vielleicht automatisch in einem Gegensatz zum Pornografischen? Man muss das nicht als Kritik der Pornografie nehmen - auch die Rebellion gegen den schamvollen Blick hat ihre Berechtigung; was mit dieser Unterscheidung aber möglicherweise erklärt werden kann, ist die Fülle und Vielgestaltigkeit, die das Kino gerade durch den Aufschub und die fetischistische Übertragung von Begehren und auch durch den gerade noch rechtzeitig abgewendeten Blick gewinnt.
Die einzelnen Geschichten, die Mourets Episodenfilm elegant nebeneinander ordnet und gelegentlich miteinander verschränkt, ohne dass er sie ganz ineinander aufgehen lassen würde, könnten fast jeden Moment ins Pornografische kippen, mehr noch, sie nehmen ihren Ausgangspunkt direkt bei Klischees des Pornofilms: Da ist zum Beispiel die Frau, die ihrer seit einem Jahr sexlosen Freundin anbietet, mit ihrem Freund zu schlafen; oder die naive, offenherzige junge Nachbarin (Mourets Lieblingsschauspielerin Frédérique Bel, in einer Paraderolle), die, wie aus heiterem Himmel, im Nachthemd gekleidet bei einem älteren Single vor der Tür steht, weil sie ihren Wohnungsschlüssel vergessen hat - und die diesem dann gleich unaufgefordert erzählt, dass sie auf der Suche nach einer Affäre ist, um über ihren Ex hinweg zu kommen; oder die Frau fortgeschrittenen Alters, die ihren Ehemann liebt, aber sich von ihm trennen will, weil sie ihre Libido nicht mehr unterdrücken kann.
Es kommt dann aber immer dazwischen: der menschliche Eigensinn als semantische Volte der Verzögerung. Die Freundin schlägt das großzügige Angebot aus, eben weil es ihrer eigenen Wunschphantasie perfekt entspricht; die leichtbekleidete Nachbarin verwehrt sich gegen die Avancen ihres Verehrers gerade deshalb, weil sie sie herausgefordert hat und weil sie deshalb nicht Ausdruck eines "natürlichen", spontanen Begehrens sein können; die ältere Frau bekommt von ihrem Ehemann alle Freiheiten und nutzt sie dann, genau deswegen, doch nicht. "Eben weil", "gerade deshalb", "genau deswegen": das sind Formeln für die Reflexivität, die der Film in die Sexualität einzieht und über die sich die Liebe - primär nicht als Gefühl, sondern als Form kommunikativen Handelns - einnistet. Die Liebe ändert sich, wenn man über sie - oder: in ihr - redet. Mit jedem Wort. Und, wenn man über sie einen Film dreht, mit jedem Bild.

Den einzelnen Kapiteln sind kurze Titel vorangestellt, zu kurz für Sprichwörter, zu lang für Lexikoneinträge - "Es gibt keine Liebe ohne Musik" etwa, "Schlage nie ein Angebot aus" oder einfach nur "Geduld, Geduld". Auch eine souveräne Erzählerstimme mischt sich gelegentlich ein. An die Tradition des ironischen Gesellschaftsromans schließt der Film ebenso an wie an die des Boulevardtheaters; aber "literarisch" ist "Die Kunst zu lieben" nur in Mourets Sensibilität für die Komplexität von Sprache und in der Art, wie er sich selbst romanhaft, kommunikativ, über Dialoge von Bild und Ton, von Erzähl- und Figurenstimme, von on- und offscreen organisiert; und auch "theaterartig" nur im besten Sinne - als intelligente, geistreiche Konstruktion und Bildwerdung eines in sich konstanten Raums. Mourets Film privilegiert die Montage innerhalb der Einstellung über den Filmschnitt. Immer wieder lässt er zum Beispiel eine Trennwand, oder eine Tür im Zentrum des Bildes stehen anstatt seinen Figuren zu folgen. Die Liebe organisiert sich dann um diesen Widerstand herum.
Eigentlich kaum zu glauben, dass Emmanuel Mouret noch immer höchstens ein Geheimtipp ist: Schon sechs spielerische Langfilme über die (bourgeoise, heterosexuelle) Liebe hat er seit 2000 gedreht, mit tollen Figurenensembles, die er oft selbst anführt, als linkischer Romantiker, ein wenig wie der junge Woody Allen, nur ohne dessen Snobismus (in "Die Kunst zu lieben" bleibt es bei einer Nebenrolle), und das im neuen Film vor allem die wunderbar verhuschte Julie Depardieu um eine wundervolle neue Facette bereichert. Sechs großartige Filme sind das, einer besser als der andere; der allerschönste ist vielleicht der traumartige, melancholische "Vénus et Fleur" (2004), der lustigste die Slapstick-Farce "Fais-moi plaisir!" (2008), "Die Kunst zu lieben" nun ist zweifellos der souveränste und klügste; ein Film, bei dem man durchaus an den mittleren Éric Rohmer (den Rohmer der "Komödien und Sprichwörter") denken darf, oder an den späten Alain Resnais (den Resnais von "Vorsicht Sehnsucht" zum Beispiel), an jenes Autorenkino also, das populäre Formen gleichzeitig perfekt emuliert und durchreflektiert; an ein Kino, das manchen als ein konservativer Verrat an der nouvelle vague erscheint, das aber doch nur mit deren schon immer fragwürdigen Aufbruchsrhetorik bricht. Weil es um die Komplexität nicht nur der Liebe, sondern auch der Ästhetik weiß. Ist der erste Satz gesprochen, der erste Blick gewechselt, kann eine Beziehung nicht mehr auf Null gesetzt werden. Und ist der erste Film gedreht, dann auch die Filmgeschichte nicht mehr.
Lukas Foerster
---

Am Anfang tritt Benoît Poelvoorde auf, im Grunde als eine depressive Karikatur seiner selbst: ein erfolgreicher Kinokomiker, der sich nach der Trennung von seiner Freundin entschließt, seinem Leben ein Ende zu setzen. Der Schauspieler, an den sich die meisten französischen Kinozuschauer wohl vor allem durch jüngere Rollen in Erfolgskomödien wie "Nichts zu verzollen" oder "Die anonymen Romantiker" erinnern werden, der aber eben auch eindrucksvoll den Serienkiller im Mockumentary-Klassiker "Mann beißt Hund" gab, möchte zu diesem Zweck die Dienste von Dr. Krueger in Anspruch nehmen - und muss hierfür eine tödliche Krankheit vortäuschen, denn Kruegers exklusive Spezialklinik für Sterbehilfe steht nicht jedem offen, sondern funktioniert nach Maßgabe eines knallharten Auswahlprozesses. Immer wieder zeigt Regisseur Olias Barco den Klinikleiter dabei, wie er in seinem Büro Bewerbungsvideos sichtet und Kandidaten selektiert. Welche Kriterien in dieser Auslese eine Rolle spielen, das legt "Kill Me Please" erst spät offen.
Die erste Eskalation tritt bereits im Prolog ein, als sich der von Poelvoorde verkörperte Schauspieler Demanet nach der Zurückweisung durch Dr. Krueger im Badezimmer einsperrt und die Pulsadern aufschneidet - diese rabiate Art des Suizids ist hier nicht vorgesehen. Stattdessen geht es um eine Idee des "würdevollen Sterbens", die mit aggressionsauslösendem Mitgefühl und einer aufdringlichen Humanität präsentiert wird. Nach Erfüllung eines letzten Wunsches - eine letzte Nummer mit einer jugendlichen Prostituierten, ein letztes Festmahl oder auch ein letztes Mal vor Publikum die Marseillaise schmettern - sieht dieses geplante Sterben die sanfte Einschläferung durch ein schnell und schmerzfrei wirkendes Gift vor. Herausgefordert wird dieses System, noch vor den blutigen Eskalationen der zweiten Filmhälfte, zunächst in Form verschiedener Zwischenfälle von innen heraus.
Nach der zwar effektiven, aber als würdelos empfundenen Selbsttötung Demanets versucht Dr. Krueger, wieder business as usual einkehren zu lassen und schwört die entsetzte Belegschaft seiner Klinik darauf ein, den Klienten zwar Empathie, aber niemals Freundschaft entgegenzubringen. Die nächste Erschütterung steht jedoch buchstäblich bereits vor der Tür, in Gestalt eines Paintball-Aficionados, der sich nichts sehnlicher wünscht als einen martialischen Abgang in der Hitze des Gefechts. Offene Gewalt als Todesursache führt Dr. Kruegers Klinik jedoch nicht im Angebot, und so muss letztlich der Zufall eingreifen, um sie in die kühl berechneten Todesbilanzen einzubringen: Bei einem Feuer in der Klinik stirbt nicht nur ein Patient vor seiner Zeit - und unterbricht so die streng-"gerechte" Reihenfolge der Selbstmordkandidaten, was einige Verstimmungen bewirkt -, durch die Zerstörungen gerät auch die auf reibungsloses Funktionieren ausgerichtete Servicemaschinerie des Tötens ins Stocken.

Die Atmosphäre ist bereits bis zum Äußersten angespannt, die Konflikte unter den länger als geplant zusammengepferchten Lebensmüden sind längst ausgebrochen, als dann auch noch die Bedrohung von außen hinzutritt. Wie aus dem Nichts fällt der erste Schuss, liegt eine weitere - nicht unbedingt die erste - Leiche mit durchschossener Stirn auf dem Waldweg. Von diesem Punkt an ändert sich alles: das Verhältnis zwischen Leben und Tod, Mord und Selbstmord, Souveränität und Machtlosigkeit steht im Zentrum der makabren Vignetten, die Barco zu einer hin und wieder etwas arg zum Auseinanderdriften neigenden Filmerzählung zusammenschnürt. Denn Lebensüberdruss ist nicht gleich Lebensüberdruss, und das Getötetwerden ist etwas grundlegend anderes als der Suizid.
In der von bleischweren Grautönen dominierten Inszenierung von "Kill Me Please" macht Regisseur Olias Barco, der nach eigener Auskunft infolge seines Debüts "Snowboarder" (2003) selbst von suizidalen Gedanken geplagt wurde, stets klar, dass ihm an der Auseinandersetzung mit den philosophischen Implikationen des Stoffes im Grunde mehr liegt als an der bloßen Aneinanderreihung schwarzhumoriger bis zynischer Pointen. Folgerichtig ist dann auch der in zunehmend hysterisches Chaos ausufernde Showdown der am wenigsten überzeugende Teil des Filmes, der dann aber mit einer letzten, unversöhnlichen Pointe schließt. Mit Bitternis entlarvt diese die tatsächlichen Motivationen des sich hinter humanistischer Camouflage verbergenden Sterbehelfers. Ein treffsicherer und schmerzhafter Schlusspunkt für einen Film, der zwar nicht makellos ist (und nicht nach Makellosigkeit strebt), der jedoch in dem Beharren auf einer eigenständigen, entschieden ungeschliffenen Formgebung eine beträchtliche Wucht entwickelt.
Jochen Werner
Die Kunst zu lieben - Frankreich 2011 - Originaltitel: L'art d'aimer - Regie: Emmanuel Mouret - Darsteller: François Cluzet, Frédérique Bel, Julie Depardieu, Emmanuel Mouret, Ariane Ascaride, Pascale Arbillot, Judith Godrèche - Länge: 88 min.
Kill Me Please - Frankreich / Belgien 2010 - Regie: Olias Barco - Darsteller: Aurélien Recoing, Virgile Bramly, Daniel Cohen, Virginie Efira, Bouli Lanners, Saul Rubinek, Zazie de Paris, Clara Cleymans, Philippe Nahon - Länge: 95 min.
Kommentieren