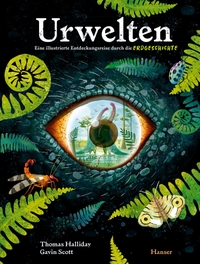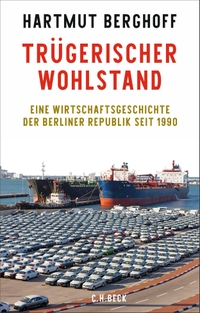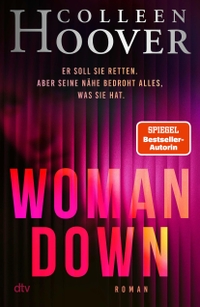Im Kino
Sinnlich greifbares Traumland
Die Filmkolumne. Von Lukas Foerster
01.04.2025. Viel mehr als nur eine Zeitkapsel ist Thomas Strucks pre-9/11-New-York-Film "Walk Don't Walk". Er filmt die Metropole aus Fußperspektive - und verzaubert damit alles, was ihm vor die Linse kommt.
Ja genau, da stehen sie noch. Gleich in der ersten Einstellung hakt der Film die beiden Türme des World Trade Centers ab, die am 11. September 2001 infolge eines Terroranschlags kollabierten. Der Film entstand kurz vorher, die zeitliche Nähe zu 9/11 - einer Zeitenwende, die seither, das ist der Lauf der Zeit, durch andere Zeitenwenden relativiert wurde - verleiht ihm Zeitkapselqualitäten; in denen Thomas Strucks "Walk Don't Walk" freilich keineswegs aufgeht.
Durchaus hält der Film einen moment in time fest, das schon. Ein weitgehend unbeschwertes, regelrecht euphorisches, zielstrebig in alle Richtungen wuselndes New York nämlich - würde man es heute noch ebenso frisch und fröhlich vor die Kamera bekommen? Wer weiß. Und doch ist unser Blick, wenn wir den Film heute sehen, kein rein historisierender. Das Versprechen, das in seinen Bildern steckt, ist zeitlos. Man schaut sich diesen Film an und will hinterher, zumindest ein paar Stunden, vielleicht gar Tage oder Wochen lang, sofort nach New York ziehen, Mietenexplosion hin, Trump her.
New York feet. Aus Beinen besteht Strucks Film hauptsächlich. In den Blick bekommen hat er sie dank einer ebenso simplen wie genialen Blickapparatur: eine consumer grade video camera, die, an einer Stange befestigt, knapp über dem Boden schwebt und per Fernbedienung bewegt werden kann. Erstaunlich elegant und wackelfrei sind diese Bilder auf Fußhöhe, und sie verwandeln alles, was sie in den Blick bekommen: Jeder Schuh ist glamourös aus dieser Perspektive, Beine werden zu erhabenen Säulen, wenn Menschen ausnahmsweise mal ganz ins Bild kommen, haben sie etwas Statueskes, Aufregendes, Erhabenes. Frauen vor allem schauen oft ein bisschen aus wie die Darstellerinnen in den Filmen der Sexploitation-Regisseurin Doris Wishman.

Der Blick, das gleich dazu gesagt, ist ohne Zweifel und tollerweise auch ohne Scham ein männlicher. Lange, sportlich schlanke, selbstbewusst eilende, bestrumpfhoste Frauenbeine ziehen ihn geradezu magnetisch an und wenn er dann an einer Frau nach oben gleitet und die in die Kamera spricht: "Ich bin Modell, mein Job hat viel mit Füßen zu tun", dann begleitet der Film sie nur zu gern zu diesem Job, der sich als ein Fetisch-Fotoshooting entpuppt. Bei dem es ordentlich zur Sache geht: "Let your pussy drip on the chair".
Dauerhorny ist der Film keineswegs. Das wäre viel zu viel Stillstellung, Strucks Bilder sind immer in Bewegung, das Sexuelle arretiert den Blick nicht (wie in Laura Mulveys feministischer Filmtheorie), es ist Teil einer Bewegungsenergie. Allerdings schon ein ziemlich entscheidender Teil, wie Dian Hanson im Film Struck und uns mitteilt. Hanson ist, lese ich im Presseheft, eine "Sex-Redakteurin", sie verlegt vor allem Fetisch-Pornomagazine. Sie redet darüber, warum Füße besonders häufig zum Fetischobjekt werden und auch darüber, warum Fetischismus zum Beispiel in Deutschland besonders weit verbreitet ist: weil er ein Ventil darstellt für verdrängtes Begehren. In ihrem eigenen Land schaut es nicht viel anders aus: "We're the perfect country to develop perversion", meint die Amerikanerin, und lacht dazu. Weil sie weiß: So schlimm ist das gar nicht, erst recht nicht aus der Perspektive einer Sex-Redakteurin. Eher im Gegenteil. Man muss die Repression nicht mögen, um sich an der Perversion, die auf sie antwortet, zu erfreuen, beziehungsweise zu bereichern.
Auch viele andere New Yorker sprechen zwischen den Fuß-, Bein- und Laufmontagen in Strucks Kamera. Meist darüber, warum Füße ihnen wichtig sind, ihre eigenen oder auch die der anderen Menschen da draußen in der Stadt. Ein Vorteil des Fußfetischismus, auch darauf kommt jemand zu sprechen, ist ja: Füße sind überall, der Fußfetischist muss nur vor die Tür gehen und schon befindet er sich im Paradies. Liegt in seinem (die Geschlechtergrenzen sind noch nicht allzu fluide in diesem Film, die Frau als Fetischsubjekt vor allem kommt nicht zur Sprache) Blick auch ein Gewaltverhältnis begründet? Nein, meint die Sex-Redakteurin, oder jedenfalls nicht so, wie der Feminismus es lehrt. High Heels zum Beispiel sind aus Fetischistenperspektive gerade keine Vergewaltigungsermöglichungsschuhe. Vielmehr ist die Lust, die sich am Blick auf High Heels entzündet, eine Angstlust. Jeder Schritt auf den phallischen Absätzen eine Kastrationsdrohung. Sich der auszusetzen: heißt das nicht, die eigene Schwäche zu umarmen? So berückend schlicht der Film gebaut ist, so hübsch durcheinander geraten in ihm immer wieder die libidinösen und auch emotionalen Register.
Füße, Beine, Beine, Füße. Und noch einmal: nicht nur von schicken jungen Frauen. Vielleicht hat der Mangel an nackten Männerbeinen auch schlicht modehistorische Gründe. Shorts und Flip Flops: Das trug Mann offensichtlich zumindest in New York noch nicht im Jahr 2001, nicht einmal im heißesten Sommer. Jedenfalls bleibt die Kamera auch an den Beinen der Obdachlosen hängen, an Beinprothesen, an Kinder-, sogar an Hundebeinen. Fast zu enzyklopädisch wird es manchmal: Rollschuhbeine, Beine auf Laufbändern, Step-Dance-Beine, ja, das gibt es auch alles. Genau, wie es verschiedene Schrittrhythmen gibt. Der Wall-Street-Rhythmus, für den Schritte Geld sind, ist zum Beispiel ein ganz anderer als der hippe, swaggende St.-Mark's-Place-Rhythmus. Wobei sich der Film eher für das Verbindende als für die Differenz interessiert. Verantwortlich dafür ist nicht zuletzt Don Byron, ein Jazzmusiker, der den beglückenden, treibenden, variablen Score des Films arrangiert hat und als Co-Auteur des Films geführt werden sollte.
Erst Bild und Ton - nicht zu vergessen: das Geräusch der Schritte, die die Jazz-Synkopen noch einmal punktieren - gemeinsam fügen sich zu einem Flow, der im Kino, in der glücklichen Stunde, die der Film nur dauert, das eine oder andere contact high auslösen dürfte. Oder auch, wie eingangs erwähnt: jede Menge Fernweh. New York rhythm. Nie im Leben könnte ein Film wie dieser im trampeligen Berlin, im schluffigen Köln entstehen. Wobei die räumliche Differenz gleichfalls wichtig ist: Thomas Struck, Filmemacher aus dem kühlen Hamburg, der in den Hexenkessel New York eintaucht und dort ein sinnlich greifbares Traumland vorfindet. Ein bisschen wie Roland Klicks "Derby-Fever USA", ein weiteres Kleinod undogmatischer teutonischer Amerikabegeisterung, das es unbedingt wiederzuentdecken gilt. Aber eins nach dem anderen, jetzt erst einmal: "Walk Don't Walk". Toll, dass dieser Film im Rahmen seiner digitalen Restaurierung noch einmal einen Kinoeinsatz erhält.
Lukas Foerster
Walk Don't Walk - Regie: Thomas Struck - Laufzeit: 60 Minuten.
Kommentieren