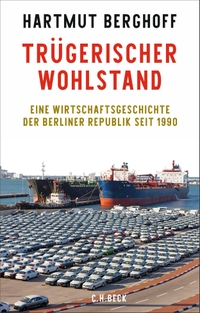Im Kino
Glückliche Stunden im Bett
Die Filmkolumne. Von Lukas Foerster, Thomas Groh
07.05.2014. Eine zwischen Anspannung und Ermattung oszillierende Kate Winslet gehört zu den Attraktionen von Jason Reitmans schönem emotionalen Exzessfilm "Labor Day". Nicht mehr als HBO light bietet dagegen Jérôme Salles Südafrikathriller "Zulu".
Zwar erfährt man über Sex alle grundlegenden Fakten im Sexualkundeunterricht, erklärt die alleinerziehende und seit der Trennung von ihrem Gatten schwer depressive Mutter Adele (Kate Winslet) ihrem Sohn Henry (Gattlin Griffith): Man lernt, was dabei vor sich geht, und was man beachten sollte. Doch sie erzählen einem dabei nichts über die sinnliche Komponente: Wie es sich anfühlt, von einem Menschen begehrt, von diesem berührt zu werden, wie es sich anfühlt, sich danach zu sehnen. Adele erklärt dies ihrem Sohn in einer Rückblende, die sich unmittelbar daran anschließt, wie der aus dem Gefängnis geflohene Frank (Josh Brolin) Adele mit einem Seil an einen Stuhl in ihrer Küche fesselt - liebevoll, im Grunde genommen schon zärtlich, einfach um die Fassade zu wahren. Eigentlich will er Adele und Henry nichts tun, benötigt aber für seine Flucht ein Versteck auf Zeit. Wenn Adele im Nachhinein behaupten will, er habe sie und ihren Sohn überwältigt und gefesselt, so sei dies wenigstens nicht gelogen. Wenig später wird er die gefesselte Adele füttern - und nach dem Exkurs über Sexualität und körperliche Nähe fällt es schwer, darin etwas anderes als ein in seinem Kern liebevolles Rollenspiel um Dominanz und Unterwerfung zu sehen, das dem ersten Impuls der körperlichen Begegnung bei der Fesselung folgt.
Wegen des Labor Day und eines Brückentages wird es ein langes Spätsommer-Wochenende mit einem Geiselnehmer, der sich im Nu als Vater und Ehemann auf Zeit - oder einfach: als Mr. Häusliches Glück par excellence - entpuppt: Schnell behebt Frank Mängel am Haus, steht Henry väterlich zur Seite, backt den besten Pfirsich-Kuchen der Welt, bietet der verschwitzt-ermatteten Adele eine starke Schulter zum Anlehnen und schließlich auch - wie der Film in vermittelnder Aussparung kenntlich macht - glückliche gemeinsame Stunden im Bett. Zwar wirkt es auf heutige Gender-Sensibiliäten befremdlich, wie sich dieser unaufgeregt in sich ruhende, spätsommerliche Schmachtfetzen um die Leerstelle dreht, die ein fehlender Mann im Hause hinterlässt, und in welchem Übermaß "Labor Day" Emotionen und Sentimentalitäten investiert, sobald Frank diese Leerstelle besetzt. Andererseits liegen die Stärken dieses doch sehr schönen Films gerade im melodramatischen Überschuss seiner hochkonzentrierten Momentaufnahmen von einer insbesondere auch körperlich-taktilen Annäherung, in denen sich eine von Regisseur Reitman unbedingt ernst genommene Sehnsucht Bahn bricht, deren Erfüllung der Umstände wegen nur eine auf Zeit sein kann, auch wenn sie rasch Fortdauer für sich beansprucht: Nach wenigen Tagen reift in Adele der Entschluss, sich Frank anzuschließen.

Als sanft von Douglas Sirk inspiriertes Melodram ist "Labor Day" in der ausgestellten Künstlichkeit seiner Konstruktion als emotionales Exzesskino ohne weiteres gelungen, vom altbackenen Geschlechterbild und einigen Spitzen ins Überkandidelte abgesehen: Einmal spricht Frank gegenüber Adele davon, dass er gekommen sei, um sie zu retten, an anderer Stelle heißt es, er würde stets wieder auf Jahre ins Gefängnis wandern, um noch einmal solche Tage mit ihr erleben zu können. Schön ist aber auch, wie der Film seine Darsteller und deren Körper inszeniert: Josh Brolin hat die Statur eines sanften Bären und strahlt abwechselnd latente Bedrohung und manifeste Geborgenheit aus. Kate Winslet, einst als jugendliche Schönheit im Kino gefeiert, gibt einmal mehr - und ziemlich hervorragend - eine reife Frau, in deren Körper sich das Leben und seine Entbehrungen eingraviert haben: Wie sie zwischen Anspannung, Erschöpfung und schließlich gelassener Ermattung oszilliert und wie ihr dabei die verschwitzten Haare ins Gesicht hängen, verleiht dieser Figur einen ganz eigenen Glanz. Und nicht zuletzt: Wenn sie sich einmal auf der Couch sanft an Frank anlehnt und der Film ein paar Sekunden lang nichts anderes festhält als den so beiläufigen, wie intensiven Moment zärtlich-körperlichen Zutrauens, vermittelt sich auch etwas davon, was schön daran ist, einen Mann zu lieben, und was schön daran ist, als Mann geliebt zu werden.
Thomas Groh
Labor Day - USA 2014 - Regie: Jason Reitman - Darsteller: Kate Winslet, Josh Brolin, Gattlin Griffith, Tobey Maguire, Tom Lipinski, Maika Monroe - Laufzeit: 111 Minuten.
---

Es dauert erstaunlich lange, eine gute Viertelstunde, bis sich in "Zulu", einem aufwändig produzierten französischen Arthausfilm über Südafrika, die Politik zu Wort meldet. "Ich würde Gerechtigkeit vorziehen", meint dann eine wütende Frau (die außerdem scheints an Krebs erkrankt ist und eine Chemotherapie über sich ergehen lassen muss; und zwar nur, weil der Film seiner eigenen Geschichte nicht über den Weg traut und sie bei jeder Gelgenheit mit Zusatzdramatik aufmöbeln will). Der Polizist Ali Sokhela (ein hoffnungslos unterforderter Forest Whitaker), der in "Zulu" den Mord an zwei Mädchen aufzuklären hat und bei der Gelegenheit allerlei Machenschaften zutage fördert, zitiert als Antwort lieber Nelson Mandela und redet der Versöhnung das Wort. Dass Ali diese frommen Sprüche nicht durchhalten wird, wissen wir schon seit dem Prolog, der ihm fein säuberlich einen inneren Dämon eingepflanzt hat.
Genau, wie wir schon seit dessen erstem Auftritt wissen, dass Alis Kollege Brian Epkeen (Orlando Bloom in einer durchaus Fremdscham-tauglichen Performance) seinem Lotterleben zum Trotz nicht nur ein guter Cop, sondern auch ein toller Typ ist. Interesse an den Figuren (oder den Schauspielern…), ihrer Art zu sprechen, sich aufeinander (nicht) einzulassen, zeigt "Zulu" kein bisschen. Und es überrascht dann auch nicht, dass die politischen Ambitionen sich auf das Wiederdurcharbeiten einer altbekannten Geschichte der Gewalt beschränken: Es gibt immer irgendein Verdrängtes, dessen wabernd überinszenierte Rückkehr alleine aus einem unterdurchschnittlichen Thriller keinen politisch brisanten Film macht.
Die Ermittlung selbst hält einen, weil halbwegs flink erzählt, gerade eben bei der Stange. Man fühlt sich wie in einer überlangen Episode einer neueren amerikanischen Krimiserie; einer überambitionierten Krimiserie noch dazu, die meint, auf klassische Spannungskonstruktionen verzichten zu können (und deshalb schon früh entscheidende Informationen vorweg nimmt), weil es eigentlich um "soziale Panoramen" oder gar irgendwelche sozioökonomische Strukturzusammenhänge gehen sollte. Die allerdings weitgehend durch Abwesenheit glänzen, höchstens auf sehr allgemein in der Figurenpsychologie aufgehoben werden: Zerrüttete Innerlichkeit als Spiegel einer zerrütteten Gesellschaft - das funktioniert zumindest dann nicht, wenn gleichzeitig trotzdem erzählt werden soll, wie Orlando Bloom sein ohnehin nur leicht aus der Bahn geratenes Leben langsam wieder, nach bürgerlichen Maßstäben, auf die Reihe bekommt. Die Whitaker-Figur ist theoretisch interessanter, hat aber zu viel Gravitas für dieses Leichtgewicht von einem Film; Alis Szenen fühlen sich unterinszeniert und wie zu früh abgebrochen an, was vor allem im Finale unangenehm auffällt, wo plötzlich mythische (Western-)Register aufgerufen werden sollen, die mit dem vorhergehenden Film kein bisschen kompatibel sind.

Das Problem ist teilweise struktureller Natur: Fernsehserien können zumindest rudimentäres Vorwissen über die Figuren, auch über die Struktur der Erzählung voraussetzen; das schafft Freiheiten im Kleinen, für Details der Figurenzeichnung, für Alltagsgeplauder. "Zulu" muss, gerade weil der Film mehr sein will als nur ein weiterer Polizeifilm, alles fein säuberlich auserzählen: Wenn beim gemeinsamen Abendessen unter Kollegen darauf hingewiesen wird, dass Ali niemals eine weibliche Begleitung zu solchen Veranstaltungen mitbringt, kann man sicher sein, dass schon ein paar Minuten später das nicht ganz durchnormierte Liebesleben des Dienstältesten thematisiert wird. Besonders ungelenk wirkt dieser letztlich doch selbstauferlegte Zwang, alle Handlungen und Gefühle korrekt zu motivieren, in Momenten, in denen zufällig des Weges kommende Kollegen gerade rechtzeitig neue Plotinformationen streuen; regelrecht ärgerlich wird er, wenn andere Nebenfiguren in fadenscheinigen dramaturgischen Manövern abgemurkst werden, nur um für alle Beteiligten die emotionalen Einsätze zu erhöhen.
Auch in stilistischer Hinsicht ist "Zulu" HBO light: Effektbewusst greift der Regisseur Jérôme Salle die visuellen Attraktionen Südafrika ab, schon in der ersten Minute taucht eine großspurige Helikopteraufnahme Kapstadts auf, die townships sehen aus wie Gangsta-Rap-Musikvideos entnommen (irgendwie Diorama-artig, in Posen erstarrte Gruppenbilder), wie sich das Leben an solchen Orten organisieren könnte, erfährt man im Film kein bisschen; immerhin hat Salle die Actionszenen recht ordentlich hinbekommen, er zerhackt die Bewegungen nicht, sondern zieht einen mit kontinuierlichen tracking shots und flächiger Musikuntermalung in die Szene.
Ansonsten kann man sich, um die knapp zwei Stunden einigermaßen interessiert zu überstehen, an Nebenfiguren klammern: Orlando Blooms Filmexfrau hat nur wenige, dafür aber sehr eindringliche Momente; auch eine Stripperin, die sich zu einem angedeuteten love interest Whitakers entwickelt, ruft in ihren paar Filmminuten mehr echte Emotionen auf, als Bloom über die gesamte Laufzeit. Ein dritter Polizist (Conrad Kemp) hat ein interessantes, unverbrauchtes Gesicht und bringt, in den wenigen Szenen, die ihm vergönnt sind, in diesen falsch abgeklärten Film erfrischende Naivität ein. Das Erzählkino, merkt man in diesen paar Minuten, ist eine so großartige, reichhaltige poetische Form, dass man sie auch mit dem unbeholfensten Drehbuch und der unpersönlichsten Inszenierung nicht ganz klein bekommt. Was den Verrat, den ein Film wie "Zulu" an dieser Form begeht, andererseits nicht leichter wiegen lässt. Im Gegenteil.
Lukas Foerster
Zulu - Frankreich 2013 - Regie: Jérôme Salle - Darsteller: Orlando Bloom, Forest Whitaker, Tanya van Graan, Natasha Loring, Roxanne Prentice, Conrad Kemp - Laufzeit: 110 Minuten.
Kommentieren