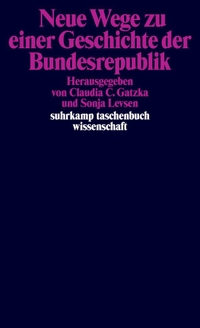Im Kino
Heldinnen in Primärfarben
Die Filmkolumne. Von Lukas Foerster, Elena Meilicke
04.04.2012. In Tarsem Singhs "Spieglein, Spieglein" fehlt der Apfel, dafür gibt es aber einen fantastischen Color Designer. In Klaus Lemkes ambivalenter Jungsfantasien "Berlin für Helden" muss man die widerständigen Details gegen das falsche Ganze verteidigen.
Endlich mal wieder ein Film mit Color Designer! Dass sich Regisseur Tarsem Singh einen Angestellten leistet, dessen Job einzig und allein in der Selektion von Farbpaletten und der Feinabstimmung von Farbtönen liegt, macht deutlich, worum es in dieser Schneewittchen-Adaption in erster Linie geht: um visuelle Opulenz, um Farben und Formen, um Schauwert statt Story. Ein Ball und zwei Hochzeitsgesellschaften bieten genügend Anlass, um ein Heer von Statisten zu monochromen Tableaus zu arrangieren. Unzählige Cremeweiß-Schattierungen, durchsetzt von zartem Türkis und pastelligem Lila, gerinnen zu Filmbildern, die an süße Zuckerware erinnern: Cupcake-Kompositionen. Durch diese Ton-in-Ton-Tableaus trapsen dann Film-Heldinnen in Primärfarben: Lily Collins (die Tochter von Phil Collins!) als Schneewittchen und Julia Roberts als böse Stiefmutter tragen prachtvolle, ausladende Roben in sattem Gelb, Blau und Rot, üppig fließende Stoffmassen, garniert mit überdimensionierten Schleifen und Spitzen.

Keine Frage, hier sind Spektakel-Experten am Werk: Szenenbildner Tom Foden hat bereits an Musikvideos für Michael Jackson und Madonna mitgearbeitet und Kostümbildnerin Eiko Ishioka Outfits für Björk und Grace Jones entworfen. Gerade Ishioka, im Januar gestorben, war berühmt für ihre erotischen Commercials (unvergesslich ein Film für die Modekette Parco, in dem Faye Dunaway ein Ei schält) surreal-abseitige Kreationen, für Kostüme, die ihre Trägerinnen in hybride Gestalten irgendwo zwischen Mensch, Monster und Maschine verwandeln. Für "Spieglein, Spieglein" hat Ishioka unter anderem fantastische Tiermasken entworfen und Hüte, die zugleich Miniatur-Kanonenboote sind. Tarsem Singh und sein Team tun also das einzig Vernünftige, was man mit einem altbekannten Märchenstoff anstellen kann: sie nehmen ihn als Lizenz zu exzessivem Farb- und Formrausch, als Lizenz zum Fantasieren und Delirieren.

Blöd ist nur, dass das Drehbuch so viel visueller Schaffenskraft nicht das Wasser reicht. Es eiert mal hierhin, mal dorthin, fügt dem Grimm'schen Märchen ohne innere Notwendigkeit an der einen Stelle ein bisschen hinzu, lässt an der anderen ein wenig weg. So beginnt "Spieglein, Spieglein" zum Beispiel mit der Erzählstimme der bösen Stiefmutter, entscheidet sich dann aber doch ganz schnell gegen eine Erzählung aus deren Perspektive, und am Ende kriegt Julia Roberts Königin die märchentypische Misogynie wieder mit voller Härte ab - Chorus: "The queen is gone, the king is back!" An anderen Stellen dagegen versucht sich der Film vorsichtig an mehr Geschlechtergerechtigkeit, ist ja auch zeitgemäßer, und lässt Schneewittchen den Prinzen (Armie Hammer, schöner junger Mann, bekannt aus "The Social Network" und "J. Edgar") wachküssen, statt umgekehrt.

Variationen wie diese aber sind so penetrant selbstironisch und augenzwinkernd inszeniert, dass man sich die gute alte Märchen-Floskelhaftigkeit zurückwünscht. Ich jedenfalls habe irgendwann nur noch auf die erhabene Zeile "Weiß wie Schnee, rot wie Blut und schwarz wie Ebenholz" hingefiebert; sie kam nicht. Und das Kind, das im Kino neben mir saß, hat sich mehrmals laut gefragt, wann denn der Apfel kommt. Egal, manches fällt bei Neuadaptionen eben unter den Tisch.

Dafür endet "Spieglein, Spieglein" mit einer schönen Bollywood-Tanzszene, unterlegt von einem Song, den Singh vermutlich oft gehört hat, als er in den 1970ern in der indischen Provinz Punjab aufwuchs. Der einigermaßen hysterische Song mit dem Titel "I Believe in Love" wurde damals von Googoosh gesungen, einer Sängerin, die unter Kennern als "Madonna des Iran" gilt. Wow - Schneewittchen, Bollywood, Madonna, Iran: einem Film mit derart hybrider Credit-Sequenz sei manche Schwäche verziehen.
Elena Meilicke
---

"Staatsknete", so wird Klaus Lemke nicht müde zu verkünden, ist das Unheil des deutschen Films. Wenn die Produzenten nicht Fördergelder beantragen, sondern wieder auf eigenes Risiko drehen würden, könnte das hießige Kino, meint er, im nu wieder etwas her machen. Man mag von dieser These, abseits ihrer lautsprecherischen Präsentation und dem hemdsärmelig-nationalistischen Unterton ("Exakt seit letzten Sonntag finde ich Deutschland nicht mehr uncool"), halten, was man will; man sollte aber zumindest daran erinnern, dass Klaus Lemke selbst seit "Negresco - eine tödliche Affäre" aus dem Jahr 1968 keinen einzigen Film mehr gemacht hat, der sich am von ihm beschworenen Markt bewähren musste. Und vermutlich auch keinen, der sich da hätte bewähren können. Lemke lebt vom Wohlwollen einiger Redakteure öffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalten, die ihm seine billig produzierten Filme Jahr für Jahr aufs neue abkaufen. Auch die ewiggleichen Interviews und Setberichte, die die Legende vom einsamen Nonkonformisten in der plattgeförderten Staatskinowelt verbreiten, sind in erster Linie Teil eines - und sei es auch noch so randständigen - Geschäftsmodells, das nicht auf einen revolutionären Umsturz des deutschen Filmschaffens zielt, sondern auf seine eigene Fortführung.
Man kann die Lemke-Filme eigentlich nur gegen ihren Regisseur verteidigen; dessen Machogehabe heben seine besten Arbeiten auf in ambivalenten Jungsfantasien, die einerseits ihren projektiven Charakter nicht leugnen, andererseits aber das, was an ihnen Pose ist, immer wieder abgleichen an der Körperlichkeit, insbesondere auch an der körperlichen Unbeholfenheit ihrer Laiendarsteller. Und Lemkes Tiraden gegen den Rest der Kinowelt stehen in einem sonderbaren Missverhältnis zu den cinephilen Gesten, die selbst in den "on the fly", also ohne Drehbuch entstandenen urbanen Fantasien der letzten Jahre allgegenwärtig sind.
Im Fall von "Berlin für Helden" funktioniert eine solche Verteidigung leider nicht mehr richtig: Das Lemke-Kino ist nun fast komplett auf die Seite der Projektion, der Pose gekippt und entwickelt kaum noch Spannkraft. Da stolpert einfach nur noch eine Handvoll junger Leute durch Berlin und am Ende werden alle mit allen (wobei: immer nur strikt gegengeschlechtlich) geschlafen haben. Was diese auf vage Art prekären Existenzen im echten Leben so vorhaben könnten, interessiert den Film kaum: einer der Männer dreht Musikvideos, ein anderer ist Schauspielschüler, die Frauen besorgen vor allem den Abwasch. Dass das Berlinerische nur über schlecht nachgemachte, wie halluzinierte Dialektfärbungen in einen Film dringt, der offensichtlich nicht den geringsten Bezug zu seinem Schauplatz aufzubauen vermag, würde "Berlin für Helden" dagegen fast schon wieder sympathisch machen - wenn Lemke nicht andererseits andauernd "Lokalkolorit" behaupten und in touristischer Manier alle Szenekieze auf einmal abarbeiten würde. Schlimm ist auch die Musik: "Berlin für Helden" deckt jene Brüche in der Erzählung, die frühere Lemke-Filme gerade in ihrer dreisten Unvermitteltheit auszeichneten, zu mit einem fast lückenlosen Soundteppich, der hauptsächlich aus drei, vier ständig wiederkehrenden Motiven besteht, von denen höchstens eine intim ins Ohr gepfiffene Folk-Nummer hängen bleibt.

Im Fall von "Berlin für Helden" kann man höchstens noch - das ist vielleicht ohnehin die edelste Aufgabe der Filmkritik - einzelne, versprengte, widerständige Details gegen das falsche Ganze verteidigen. Zum Beispiel die Nebenfiguren, die, wie aus dem Strom der Passanten rekrutiert, in den Film hinein- und ebenso schnell wieder aus ihm herausfallen: widerwillige Zigarettenspender, bärbeißige Hausmeister, derangierte Straßensänger; Lemkes Kino hat die Bereitschaft, sich immer wieder von sich selbst überraschen zu lassen, noch nicht ganz verloren. Auch die trotzig-naive, kurzhaarige Anna Anderegg, die einzige interessante Schauspielerin in "Berlin für Helden", möchte man gegen den Film, in dem sie auftritt, in Schutz nehmen: wutschnaubend rennt sie von einem tumben Mann zum nächsten, fällt dann leider - aber irgendwie auch folgerichtigerweise - bald fast vollständig aus der konfusen Handlung heraus und überlässt der diesmal leider ziemlich aufdringlich-divenhaften Lemke-Muse Saralisa Volm das Feld.
Dass nun ausgerechnet "Berlin für Helden", einer der schwächsten Filme Lemkes, den Kinostart erhält, den zum Beispiel "Undercover Ibiza" oder "Finale" viel eher verdient gehabt hätten, hängt ironischerweise wohl vor allem damit zusammen, dass das ZDF als Koproduzent an Bord war und der unbedingt förderkinoaffine Senator-Ableger deutschfilm (siehe Ekkehard Knörer) den Verleih übernommen hat. Sprich: Die Staatsknete ist schuld.
Lukas Foerster
Berlin für Helden - Deutschland 2012 - Regie: Klaus Lemke - Darsteller: Saralisa Volm, Marco Barotti, Anna Anderegg, Henning Gronkowski, Andreas Bichler, Dagobert Jäger, Thomas Mahmoud, Karl Schneider - Länge: 80 min.
Spieglein, Spieglein. Die wirklich wahre Geschichte von Schneewittchen - USA 2012 - Originaltitel: Mirror Mirror - Regie: Tarsem Singh - Darsteller: Lily Collins, Julia Roberts, Armie Hammer, Nathan Lane, Mare Winningham, Martin Klebba - Länge: 106 min.
Kommentieren